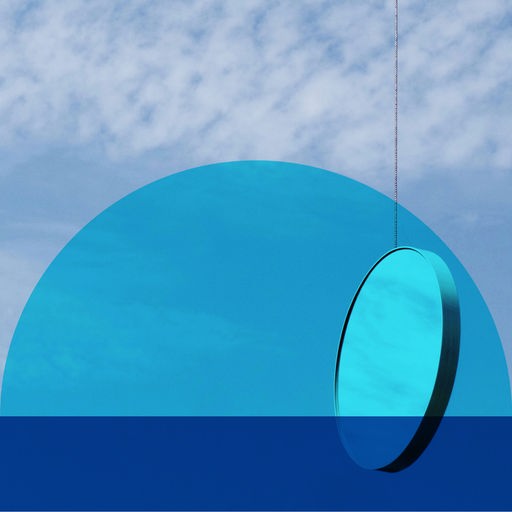Zahlreiche Diskurse haben die Gesellschaftsbildung der deutschen Einheit über 30 Jahre in Ost und West begleitet, kontrovers diskutiert, auch skeptisch hinterfragt - alle fünf Jahre ergab sich dadurch ein neues Bild über das Zusammenwachsen. Was sehen wir heute? "Essay und Diskurs" führt Gespräche zu Einheits- und Zukunftsfragen mit Literatur-, Kulinarik-, Popkultur- und Wende-Menschen.
Die Ost-West-Rolle - eine Gesprächsreihe in sechs Teilen
- Edward Larkey, Professor für Populärkultur, über den Sound der DDR (06.09.2020)
- Die Schriftstellerin Heike Geißler ist bekennende Sächsin ist, trotz der politischen Probleme, die sie damit hat. (13.09.2020)
- Neues Erzählen von der DDR - eine Gesprächsrunde vom Kölner Kongress 2019 (20.09.2020)
- Der Schriftsteller Martin Gross zog im Januar 1990 vom Westen in die DDR (27.09.2020)
- Die Köchin Maria Groß führt das Restaurant Bachstelze unter dem Label "Maria Ostzone" (03.10.2020)
- Die Publizistin Greta Taubert hat mit Ostmännern von heute gesprochen (04.10.2020)
Pascal Fischer: Wir nehmen 30 Jahre Deutsche Einheit zum Anlass, einmal nachzufragen: Sind wir wiedervereinigt, wie sehen sich Ost- und Westdeutsche heute, sehen sie sich überhaupt noch als Angehörige von ehemaligen Landeshälften oder als Gesamtdeutsche – und was bedeutet das dann? Heute widmen wir uns insbesondere den Biografien von Männern, die noch in der DDR geboren sind. Und eingeladen ins Studio habe ich Greta Taubert, eine Expertin für und selbst erklärter Fan von, Zitat, Ossi-Boys. Sie ist Jahrgang 1983, geboren in Frauenwald am Rennsteig in Thüringen, hat Journalistik und Politikwissenschaft in Leipzig und Breslau studiert und bei der "Berliner Zeitung" volontiert. Sie schreibt unter anderem preisgekrönte Reportagen für das "SZ Magazin", "Vice" und "Die Zeit", außerdem hat sie Bücher veröffentlicht, in denen sie versucht, aus dem Hamsterrad des Konsums auszusteigen oder klüger mit ihrer Lebenszeit umzugehen. Und 2020 ist nun im Aufbau Verlag erschienen: "Guten Morgen, du Schöner – Begegnungen mit ostdeutschen Männern". Schön, dass wir uns begegnen hier, herzlich willkommen, Greta Taubert!
Greta Taubert: Hallo, ich freue mich sehr!
Klischee des ostdeutschen Mannes
Fischer: Ja, ein Buch über Ostmänner, in dem Kraftfahrer, Bürgermeister, Musiker, Lehrer, Callcenter-Angestellte zu Wort kommen – sind die so stumm, verleugnen die sich so, dass sie Greta Taubert brauchen um zu sprechen?
Taubert: Das ist eigentlich ganz interessant, dass Sie sagen, heute kommen mal endlich ostdeutsche Männer zu Wort, und dann bin ich es doch nur wieder als Ostfrau, die ja viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und tatsächlich finde ich, dass es eine gewisse stumme Mehrheit unter ostdeutschen Männern gibt, die eben in der medial vermittelten Öffentlichkeit bisher nicht so aufgefallen sind. Man hat andere Bilder im Kopf als die Ossi-Boys, über die ich geschrieben habe.
Fischer: Was sind das für Bilder?
Taubert: Also, wenn man sich den ostdeutschen Mann vorstellt, ich habe das auch mal gegoogelt, das muss man vielleicht einfach mal eingeben, dann hat man immer so ein ganz gutes Spektrum, dann sieht man relativ schnell Harald Ewert aus Rostock-Lichtenhagen in vollgepinkelter Jogginghose den Hitlergruß zeigen.
Fischer: Das berühmte Schwarz-Weiß-Foto ...
Taubert: Das ganz berühmte... Das war so ein bisschen der Auftakt vom Klischee des ostdeutschen Mannes. Und die Folgebilder sind der Anglerhut, also der wild rüpelnde Dresdner, der noch mit seinem richtigen sächsischen Akzent sagt, Sie begehen eine Straftat. Das hört und sieht und guckt man sich irgendwie gerne im Rest der Öffentlichkeit an. Die Erfahrung aber, die ich mit Ostmännern gemacht habe, sind irgendwie ganz andere. Die haben keine Anglerhüte, soweit ich weiß, und sie sind vor allem das Gegenteil von solchen lautstarken Hassparolenschwingern.
Jenseits von Pegida
Fischer: Ist das auch so ein bisschen das Programm, eine andere Form von Mann da mal ins Rampenlicht zu rücken?
Taubert: Ja, genau das war eigentlich der Ansatz, dass wir die Spitzen der Wahrnehmung mal ein bisschen glätten. Jeder Dritte der mittelalten, ostdeutschen Männer hat bei der Bundestagswahl AfD gewählt, auf die hat man sich dann immer konzentriert, aber die anderen beiden Männer hat man irgendwie nie betrachtet. Und für mich war der Anlass, dass man seit etwa dem Aufkommen von Pegida nur noch ein klischeeverzerrtes Bild gezeichnet hat von ostdeutschen Männern, zu sagen, irgendwie würde ich das gerne komplettieren und ein weiteres Spektrum aufmachen der Biografien, der Erlebnisse, der Vielfältigkeiten, der Lernerfahrungen, die man eben auch als ostdeutscher Mann gemacht haben kann jenseits von Pegida, mal abzubilden.
Fischer: Der Titel hängt da die Latte ziemlich hoch. Das ist ein bisschen eine Anspielung auf dieses Buch "Guten Morgen, du Schöne" von Maxie Wander, 1977, ein Buch, das sehr, sehr wichtig war für die Frauenbewegung in Ost und West. Hängen Sie die Latte tatsächlich so hoch, dass Sie sagen, genau so ein Phänomen brauchen wir – und das ist das Buch dafür?
Taubert: Ja, ich war mir, glaube ich, auch nur halb bewusst, an was für einen wahnsinnigen Klassiker ich mich da heranwage. Es ist nicht direkt meine Generation, das ist sozusagen das Buch der Stunde gewesen für eher so die Generation meiner Mutter. Und auch in Westdeutschland wurde Maxie Wander ja breit gelesen von Feministinnen. Gesprächsprotokolle mit ostdeutschen Frauen, die in der offenen Art und Weise, wie sie erzählt haben, wie sie pragmatisch emanzipiert ihr Leben gestalten, arbeiten, Sex haben, souverän Entscheidungen treffen. Damit sind sie irgendwie in ein Diskursfeld in Westdeutschland gekommen Ende der '70er-Jahre, das ja erstaunt hat und auch begeistert hat. Nun ist mir dieses Buch wieder in die Hände gefallen vor ein paar Jahren, und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, wie die da erzählen. Das hat eine Ewigkeit, eine Ehrlichkeit, eine Offenheit gezeigt, wo ich dachte: Warum reden wir heute nicht mehr so miteinander, warum werden solche Fragen nicht gestellt, warum wird so ein Raum nicht gegeben – und zwar vor allem für Menschen, die von diesen Frauen geprägt wurden, nämlich die Söhne, die Söhne der Maxie-Wander-Generation. Also ist es, darum bitte ich, eher als Reminiszenz zu verstehen denn als Anmaßung.
Ein bisschen süß – meine Ossi-Boys
Fischer: Wie sind Sie denn konkret dann auf die zugegangen, wenn Sie die getroffen haben? Sie nennen die ja in mehreren Texten "meine süßen Ossi-Boys", Sie sagen mal, die sind "schnuffig". Haben Sie das denen auch so gesagt und wie haben die dann reagiert? Oder ist das eher etwas, was sich im Nachhinein ergeben hat?
Taubert: Das ist eine gute Frage und auch ein diskutierbarer Punkt, wie ich mir eigentlich so eine Sprechhaltung zulegen kann zu sagen, meine Ossi-Schnuffis. Tatsächlich habe ich auf der Reise ein bisschen danach gesucht, warum mich häufig mit Ostmännern so eine sofortige Vertrautheit umfängt. Das habe ich auch mit vielen anderen Frauen besprochen, dass ich gesagt habe, Leute, das ist 30 Jahre her jetzt der Mauerfall. Wir, dritte Generation Ostmenschen, wir haben doch da überhaupt gar nicht so eine starke Prägung mitbekommen. Warum ist das so, wenn wir uns irgendwo begegnen, dass wir sofort so einen Magnetismus schon fast haben? Und kaum jemand konnte es richtig begründen rational, da müssten wir tiefenpsychologisch vielleicht ran oder geschichtswissenschaftlich oder das noch mal anders erklären, aber das ist zumindest ein Fakt. Und wenn ich selber das umreißen müsste, dann würde ich sagen, dass es so eine freundliche, demütige, leise, na ja, zurückhaltend devote Art schon fast ist – plus auch ein bisschen süß –, die mich so fasziniert hat. Und darum nenne ich sie meine Ossi-Boys.
Fischer: Sie haben ja gerade schon diese dritte Generation der ostdeutschen Männer angesprochen. Was ist denn an denen so besonders – vielleicht auch im Vergleich zur ersten oder zweiten Generation? Das besprechen Sie ja auch ein bisschen in dem Buch, auch mit den Männern.
Taubert: Ja, die Mehrheit kommt tatsächlich aus dieser dritten Generation. Ich habe die zwischen '75 und '90 geboren gefasst. Das heißt, der Geburtsstempel in der in der Geburtsurkunde war für mich noch entscheidend. Und ich habe auch mal einen Vater mit dazu genommen oder ein, zwei andere Gestalten, die so ein bisschen aus einer anderen Generation kommen. Warum haben die mich am meisten interessiert? Erstens, weil es tatsächlich die Männer sind, die mich am meisten interessieren. Zweitens, weil sie eben jene Söhne der Maxie‑Wander‑Generation sind, die ich gerade erwähnt habe. Für mich hat sich die Frage gestellt, wenn man in einer Familie aufwächst, in der es sozialistische Notwendigkeit und Normalität war, dass Mama und Papa gleichmäßig zur Arbeit gehen, da gibt es auch das Lied "Wenn Mutti früh zur Arbeit geht", ja, wo alle eben zur arbeitenden sozialistischen Persönlichkeit auch erzogen werden und man Tag ein, Tag aus dieses Rollenmodell einer Frau vor Augen hat und sich vorstellt, dann hat das doch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man jetzt selbst eine Familie gründet oder eine Partnerschaft gestalten will oder überhaupt sich verabredet. Und tatsächlich kann ich sagen, dass sich das bestätigt hat in sehr, sehr vielen Gesprächen, unabhängig davon, ob das ein diskurs-akademisch gebildeter Mann ist, der seine toxische Männlichkeit hinterfragt, oder einfach jemand, der sagt, ja klar helfe ich zu 50 Prozent im Haushalt mit, wie soll es denn anders gehen?
Emotionale Härte im Elternhaus
Fischer: Und trotzdem sagt Tobias, 38, aus Erfurt, den möchte ich gerne zitieren, ein Puppenspieler, zwei Söhne: Weil unseren Eltern ein '68 gefehlt hat, holen wir Ostmänner das jetzt nach. Wo stehen diese Männer in ihrer Erfahrung, in einem Land aufgewachsen, so irgendwo zwischen Gleichberechtigung und dieser berühmten, rigiden, sehr disziplinbetonten Erziehung?
Taubert: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, auch diese rigide Erziehung noch mal anzusprechen. Es zieht sich durch die Protokolle ein Faden durch, der auch von einer gewissen emotionalen Härte im Elternhaus geprägt ist. Das heißt, diese liebende, schon fast hippieeske und '68er-aufklärerische Kultur, gewaltfreie Kommunikation und so, das entdecken die Männer gerade erst, da stehen wir noch total am Anfang. Und das kommt in diesen Ossi-Boys sozusagen gleichmäßig zusammen. Die haben einerseits die real erfahrene Emanzipation der Frau und kommen jetzt auch an die Punkte, an denen sie wirklich feministisch, theoretisch Modelle dazu bekommen, warum es vielleicht sogar wichtig ist. Das ist sehr, sehr interessant, weil da viel in Bewegung kommt. Und ich glaube, dass das sehr spannend ist, wenn sich mal West-Boys und Ossi-Boys in der Hinsicht begegnen.
Fischer: Wie haben denn diese Männer, die Sie interviewt haben im Osten, damals die Wende erlebt? Sie sprechen ja von einem Wort, das ich sehr lustig finde, von der kollektiven Enteierung. Was heißt das denn?
Taubert: Sie haben sich aber auch wirklich alle Knaller da rausgesucht! Die kollektive Enteierung ist aus der Erfahrung heraus, dass mit '89/'90 ja eine flächendeckende Abrasierung sozusagen von Eliten stattgefunden hat. Da wurde also von NVA, also der Armeepolizei, Politik, Bildung, das musste ja irgendwie transformiert werden in ein anderes System. Da hat man also einen unfassbaren Bedeutungsverlust als Mann auch erfahren, der vielleicht so eine gewisse Deutungshoheit über die Welt schon erlangt hatte. Der Trabi war ein Witzobjekt, der Stil galt als krampfig, die Musik war irgendwie gestrig, also alles, was irgendwie diese Männergeneration, die Vätergeneration mal zum Macker gemacht haben könnte, wurde plötzlich irgendwie ausgelacht, ist irgendwie so verschwunden, hat sich vielleicht noch für ein paar Ossi-Witze geeignet. Und das mussten die auch erst mal verkraften. Natürlich hat man sich danach gesehnt, endlich den coolen Rock'n'Roll zu hören und etwas Anderes zu machen, aber für die Väter hat das ganz häufig bedeutet, dass sie ihren Söhnen nicht besonders viel mitgeben konnten auf den Weg und diese patriarchale Position eigentlich weiter durchziehen konnten. Der Effekt war, dass die Leute, die 1989 in so einer Jugendphase waren, den Anarchismus der Jugend auch im Anarchismus einer Zeit gefunden haben und einfach sagen konnten, das, was ich mitgenommen habe, und das, was da neu kommt, das packe ich jetzt in eine ganz neue Form von Emanzipation rein.
Wiederentdeckung des Ostdeutschen
Fischer: Wie haben denn die Männer, mit denen Sie gesprochen haben, die Zeit nach der Wende unmittelbar und dann ein bisschen länger danach erlebt?
Taubert: Die Erfahrungen sind natürlich divers, aber ich habe gemerkt, dass es für viele zuerst so eine Art von Scharade gab. Man wollte nicht so gerne als ostdeutscher Mensch, als ostdeutscher Mann erkannt werden und hat versucht, händeringend nach den Codes, nach den kulturellen Codes in Westdeutschland zu suchen und sie sich ganz schnell anzueignen, den Dialekt abzutrainieren und teilweise sozusagen auch noch der bessere Wessi zu sein, diese Statussymbole und so, das alles irgendwie sich anzueignen. Und mit der Zeit kam dann eine Wiederentdeckung des Ostdeutschen, man hat es teilweise vielleicht auch glorifiziert, man hat irgendwie wieder so ein identitäres – identitäres sage ich jetzt auch schon – hat ein Identitätsgefühl entwickelt. Und jetzt, würde ich behaupten, gibt es von dieser dritten Generation Ost ein weniger emotionales Bild auf den Osten, sondern man schaut sich wirklich an, was ist denn vor 30 Jahren passiert, wer sind wir heute – ohne zu sagen, Mensch, früher war ja alles toll oder jetzt ist ja alles toll. Das Verstecken ist vorbei, die Nostalgie ist vorbei, und jetzt können wir uns wirklich mal angucken, was ist denn übriggeblieben, biografisch übertragen worden und taugt dazu, zu den Problemen, die unsere Welt ja jetzt auch hat und vor denen wir stehen, das da auch noch mit einzubringen.
Fischer: Aber ich möchte noch mal nachfragen: Es heißt im Buch auch von einem, der befragt wird: Wir hatten kein Erbe, wir hatten keine Netzwerke, keine Immobilien gab es da, das ist doch unglaublich drastisch, kann man das irgendwie wettmachen – auch in Jahrzehnten?
Taubert: Ja, für Sie ist das drastisch, aber für uns ist das tatsächlich eine ganz normale Erfahrung. Wenn ich in meinem Freundeskreis rumfrage, sagt mal, was werdet ihr denn mal erben, dann lachen wir alle über den guten Witz, weil das ist halt einfach nicht da. Wir müssen jeden Tag erfahren, dass ein Haus ringsum von vermutlich einem Westdeutschen aufgekauft wird. Hier in Berlin ist es ja auch ganz krass, wo du dann weißt, mit den Leuten, mit denen du zusammen studiert hast, wir waren alle irgendwie arme Studierende, aber der Unterschied ist halt immer noch, dass der westdeutsche Freund auch wahrscheinlich sein Erbe vorher ausgezahlt bekommt und sich die Wohnung kauft – und ich nicht. Und ich werde das auch nicht können, und das wird sich auch nicht ändern, das wird auch so bleiben. Also, wenn jetzt immer Leute sagen … Ich sitze ganz oft jetzt an solchen Tafeln, dann sagen die immer alle irgendwann, legen mir so den Arm um die Schulter und sagen, du Greta, also ganz ehrlich, es gibt doch eigentlich keine wirklichen Unterschiede mehr oder? Das meinst du doch gar nicht so. Und, äh, it is the economy, stupid! Also, daran werden wir das auch noch in einigen Jahrzehnten immer wieder entlang erzählen können.
"Wir wissen, wie es ist, dass wir uns entscheiden können"
Fischer: Wo stehen denn diese Männer heute, die Sie gesprochen haben? Haben die sich dann berappelt oder sind diese Gräben dann im Grunde immer noch da, und spüren die immer noch so ein bisschen Ost-Identität in sich?
Taubert: Ja, diese Gräben sind immer noch da. Wenn man sich mal Quoten angucken möchte oder wie sind Vorstände besetzt, wo sind eigentlich die ostdeutschen Chefredakteure, die ostdeutschen Politiker, die ostdeutschen Entscheidungsträger, die ostdeutschen Wirtschaftsbosse, die ostdeutschen Dax‑Konzerne, da schneiden tatsächlich die ostdeutschen Frauen wesentlich besser ab als die ostdeutschen Männer. Warum ist das so, bringen die das nicht oder was ist los? Vielleicht wollen sie es auch gar nicht, das möchte ich gerne als Diskursfrage in den Raum stellen. Ich habe mit einigen darüber gesprochen, und die haben mir ganz häufig gesagt, ist ja gut und schön, Karriere machen, großes Auto kaufen und so weiter, aber weißt du was, wir haben einmal von der Freiheit gekostet. Wir wissen, wie es ist, dass wir uns entscheiden können, ob wir zu 50 Prozent auch Familienvater sein wollen, ich meine, ich habe ein Kind in die Welt gesetzt, ich möchte es doch auch großziehen. Vielleicht möchte ich ja lieber das machen, vielleicht möchte ich ja tatsächlich frei sein und nicht nur einer alten Ordnung hinterherrennen, die sowieso noch nie meine war. Vielleicht gehört das ja auch ein bisschen dazu.
Fischer: Das klingt jetzt trotzdem so ein bisschen so, als gäbe es da Menschen, die haben bestimmte Erfahrungen gemacht. Aber würden diese Männer auch heute noch sagen, wir sind Ostmänner, wir sind einfach anders, wir haben eine andere Biografie und wir würden uns von der Identität her eher als Ossis denn als Deutsche sehen.
Taubert: Unterschiedlich. Selbst der Ostbeauftragte der Bundesregierung sagt, er möchte sich nicht als Ostdeutscher identifizieren, sondern eher als Europäer oder als Deutscher oder als Cola-Trinker oder keine Ahnung was, aber das Ostdeutsche um Gottes willen nicht, was ich echt interessant finde für einen Ostbeauftragten. Meistens sagen erst mal alle, nee, nee, nee, ostdeutsch, das ist eigentlich nicht wirklich eine Kategorie. Und dann stelle ich immer eine Frage, die lautet so: Was assoziierst du denn heute eigentlich noch so mit dem Fall der Mauer, gibt es da irgendwelche Bilder, die dir in den Kopf kommen, oder was du da gefühlt hast, die Emotionen? Und selbst die, die nur ein paar Jahre alt waren, haben eine Geschichte dazu. Sie kriegen Gänsehaut, wenn sie irgendwie Bilder sehen, sie haben unfassbar viele Geschichten dazu. Dann merkst du, aha, da ist also noch was. Wenn du einen Westdeutschen fragst, sag mal, was hast du denn damals eigentlich '89/'90 gefühlt, was ist dir da passiert, welche Veränderungen sind eingetreten und wie verhältst du dich emotional dazu, dann guckt der mich an, zuckt mit den Schultern, weiß ich nicht, häh?
"Der Ost-West-Bruch wird wahrscheinlich langsam verblassen."
Fischer: Da saß er vor dem Fernseher, hat was gesehen.
Taubert: Ja, irgendwie haben die Eltern da mal was erzählt, dass da jetzt was war, aber … Das hat sozusagen den ganzen Kausalzusammenhang des Lebens überhaupt nicht gestört, und in den ostdeutschen Biografien aber schon.
Fischer: Wir haben über die dritte Generation Ost gesprochen. Gibt es eigentlich schon so etwas wie eine vierte Generation Ost, die sich andeutet oder vielleicht auch nicht? Im Buch ist an einigen Stellen zu lesen, ja, da befürchtet ein Bürgermeister, da sind so Jugendliche, die sagen, ich hätte am Liebsten ein Abo auf Hartz IV und das war es. Das wäre ja ein sehr tristes Bild.
Taubert: Ja, das wäre ein tristes Bild. Natürlich wird es eine vierte Generation geben, die jetzt nach der Wende geboren sind, die sind ja jetzt mittlerweile auch schon erwachsen. Und auch da gibt es kein einheitliches Bild, sondern wir müssen es wahrscheinlich genauso diversifizieren. Ich glaube, dass die Bruchlinien zwischen Stadt und Land stärker werden in den nächsten Jahren oder für diese Generation, zwischen Globalitären und Normalitären, wie man auch so sagt, Leute, die sich dem Globalen zuwenden können, die sich in dem zu bewegen wissen, und jenen, die ihre Identität, ihre Herkunft, ihr kleines, überschaubares Leben lieber meistern wollen, zwischen Sicherheits- und Freiheitsmenschen. Das sind, glaube ich, die Konfliktlinien, die da eher auftreten. Und die sind, denke ich, auch in Westdeutschland und überall auf der Welt zu finden. Der Ost-West-Bruch wird jenseits dieser Erbenfrage wahrscheinlich langsam verblassen.
Fischer: Würden Sie eigentlich auch gerne ein Buch über Ostfrauen schreiben, so als Maxie Wander reloaded als Versionsozusagen, oder würden Sie sagen, da ist alles gesagt, die sind nicht so spezifisch oder womöglich auch nicht so ein Problemfall wie diese Ostmänner?
Taubert: Ich selber würde jetzt kein Buch über sozusagen mich oder meine Kolleginnen schreiben, also Sie können ja eins über uns schreiben und mal staunen. Aber ich fühle mich nicht als eine marginalisierte Gruppe. Die ostdeutsche Frau wurde in den letzten Jahren schon sehr gut ausgeleuchtet, oder man hat versucht, diese Powerfrau auf die Spur zu kommen. Was ist mit denen eigentlich los? Das fände ich nicht so interessant. Ja, wenn man es weiterspinnen müsste, wären vielleicht westdeutsche alleinerziehende Mütter interessanter, eine Gruppe, wo man denkt, warum gibt es davon so viele, und man hört von denen nichts, die ja eigentlich so trotzdem tragende Pfeiler der Gesellschaft sind. Oder zweite Generation Migranten zum Beispiel, von denen hört man auch irgendwie nie was – oder schon, aber was ist mit den bosnischen Geflüchteten, die jetzt in der zweiten Generation hier sind? Das war eine riesig große Gruppe, aber man hört von denen einfach nichts. Das finde ich interessanter, gar nicht mit einer These, sondern einfach nur zu sagen, wie habt ihr euer Leben in dieser Bundesrepublik eigentlich gestaltet, weil der Einheitsprozess, in dem wir ja jetzt drin sind, 30 Jahre danach, immer noch, eben nicht mehr nur West- und Ostdeutschland meint, sondern eine ständige Fragmentierung von Gesellschaft, und wir immer mehr in die Lage kommen müssen, diese Unterschiedlichkeiten zu ergründen und nicht groß zu machen, sondern zu schaffen, zu integrieren. Also, da gibt es noch jede Menge Stoff.
"Die Bruch-Erfahrung ist etwas, das uns helfen kann"
Fischer: Können wir denn von diesen Ostmännern, die Sie porträtiert haben, etwas lernen? Beim Thema Gleichberechtigung zum Beispiel hat man ja das Gefühl, die machen eigentlich schon das, was im Westen immer gefordert wird, Abschaffung der 50er-Jahre-Ehe, gleichberechtigte Partnerschaft, man hört aber kaum etwas von denen?
Taubert: Ja, unbedingt, ich möchte dafür werben, dass, wenn Sie mal so einen zu fassen kriegen, einen ostdeutschen Mann der dritten Generation, gerne den einfach mal in den Diskurs mit einzubeziehen. Denn diese gelebte, pragmatische Emanzipation, zu 50/50 sich den Haushalt aufzuteilen, sich wirklich die Care-Arbeit für die Kinder aufzuteilen, auch die Krankenpflege, das ist alles statistisch schon ausgewertet, dass sich da Ostmänner wesentlich stärker engagieren als Westmänner und zeitgleich dabei aber nicht erst in so einen ganzen Männlichkeits- und Genderdiskurs eintreten müssten, sondern sie dürfen weiter Männer sein mit all dem, was da sonst noch dazugehört, und aber einfach sich zu beteiligen ohne Gesichtsverlust und ohne, dass man deswegen denkt, oh, ich muss mich ja jetzt so doll zurücknehmen. Ich darf ja gar kein Mann sein. Doch, be a man, help your woman! Da hat man also etwas, was die Soziologie und die Genderstudies lange akademisch diskutieren am realen Modell sozusagen. Und das möchte ich ganz gerne anraten, ja.
Fischer: Etwas Anderes, was man lernen könnte, und da muss ich jetzt so ein bisschen weiter ausholen, könnte vielleicht so eine gewisse Zukunftsfähigkeit sein des Ostmanns, vielleicht aber auch des Ossis allgemein. Sie haben ja ein Buch darüber geschrieben, wie man sich auf die Apokalypse vorbereitet, auch geboren daraus, dass Ihre Urgroßeltern, Großeltern, Eltern immer einen, ja, Bruch erlebt haben biografisch, gesellschaftlich. Ist diese Wende-Erfahrung der Ostdeutschen einfach auch ein unglaublicher Schatz, um so etwas vielleicht zu überstehen, was in den folgenden Jahren kommt – Klimakatastrophe, Zusammenbruch der Wirtschaft, man weiß ja nicht, was uns droht.
Taubert: Ja, das wäre ja mal schön, wenn ich besser vorbereitet bin. Nee, tatsächlich ist, glaube ich, die Bruch-Erfahrung etwas, das uns mittlerweile helfen kann in Zeiten, in denen die Angst davor, dass diese apokalyptischen Szenarien, die vor uns stehen, groß Überhand nehmen. Und wenn man sich dann mal überlegt, würde ich mich eigentlich selbst ernähren können? Wie wäre es, wenn nun alles Geld auf dem Konto weg ist, wenn die Kreditsysteme nicht mehr halten, was ist eigentlich, wenn ich nur noch Tausch- und Teilwirtschaft machen kann? Dann kann der Ossi immer sagen: Haben wir alles schon durch!
Wertfrei den Menschen gegenübertreten
Fischer: Ist der Ostmann jetzt eigentlich so ein Sujet, das sich eher ergeben hat aus dem Jubiläum – 30 Jahre Wiedervereinigung – oder würden Sie sagen, das ist einfach immer noch so ein präsenter Typus? Denn wenn wir uns fragen, wo stehen wir 30 Jahre nach der Einheit, ist das immer noch ein sehr präsenter Typus oder würden Sie sagen, nein, es gibt auch noch ganz andere viele demographische Gruppen, die genauso in den Fokus gerückt werden sollten, wir sind ein diverses Land, lasst uns mal auf alle schauen?
Taubert: Ja, unbedingt. Also, der Ostmann ist jetzt ein Typus, den ich mir rausgenommen habe, weil ich eine gewisse biografische Nähe dazu besitze, da mal reinzustechen und nicht nur jubiläumsgetrieben mal darüber zu berichten, sondern aus der jetzt seit fünf Jahren, seit dem Aufkommen von Pegida, Verschiebung eines Diskurses, sodass wir halt bei einer Demo mit ein paar Menschen irgendwie auf der Reichstagstreppe nicht sofort immer wieder in Empörung und Hilfeschreie und Klischeeisierung verfallen, sondern dass wir eigentlich uns stärker darauf einlassen können, was sind denn die tatsächlichen Realitäten von Menschen? Und den Abstand davon gewinnen, immer zu sagen, es gibt immer nur solche Gruppen und die Gruppen, sondern irgendwie zu einem menschlichen Blick zu finden, das ist der eigentliche Ansatz hinter diesem Buch. Wertfrei Menschen gegenüberzutreten, selbst wenn sie ein Stigma auf der Stirn direkt haben, nicht zu sagen, mit dir kann ich deswegen aber nicht reden, weil du hast mal das Unsagbare gesagt. Nein, gerade dann in den Dialog zu treten, weil wie wollen wir sonst jemals diese Grenzen abbauen, die uns ja irgendwann mal getrennt haben. Dieser Prozess geht halt immer noch vorwärts, und die Mauerbauer sind doch immer noch dabei, ich meine, das passiert doch die ganze Zeit wieder. Und das ist meine revolutionäre Tat dann jetzt, weiterhin zu sagen, hey, ich möchte dich kennenlernen, erzähl doch mal! Und diese einfache Frage, zu Menschen zu gehen, die sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine interessante Geschichte zu erzählen, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, warum du da bist, ich bin ein ganz normaler Mensch. Das ist doch stark, das ist doch toll, einfach einen ganz normalen Menschen dazu zu bewegen, sich einzubringen, beizutragen. Und bei allen ist danach etwas passiert, bei allen, die einmal die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Geschichte wertvoll ist, haben sich bestimmte Dinge danach im Leben verändert. Und da kann man ja weitermachen.
"Wir müssen das auszuhalten, dass wir alle komplett anders sind"
Fischer: Also schauen wir ein bisschen mehr auf alle Gruppen. Wenn wir jetzt darauf schauen, wie Deutschland zusammengewachsen ist, und uns nicht einfach nur beschränken auf Ost und West, was würden Sie denn sagen, was macht unser Land aus? Kann man das noch irgendwie sagen, was ist Deutsch?
Taubert: Ich habe diese Frage letztens auch in Social Media gepostet, gibt es eigentlich noch irgendwas, worauf wir uns einigen können. Es ist auch gerade eine sehr groß angelegte Bertelsmann-Studie dazu rausgekommen. Die haben, glaube ich, ein Jahr lang mit unterschiedlichen Gruppen in Deutschland darüber gesprochen, was denn das ist. Und dabei ist etwas ganz Eindeutiges rausgekommen – nämlich nichts. Es gibt eigentlich nicht mehr wirklich etwas, worauf wir uns noch einigen können in diesem Land. Jeder lebt in seiner eigenen Blase, in seiner eigenen Kammer, in seiner Wirklichkeit, die vielleicht durch das Internet verstärkt werden oder durch die eigenen Resonanzräume, in denen wir uns befinden. Dieser Drops ist gelutscht, das kriegen wir kaum mehr eingefangen. Entweder wir haben eine Diktatur und die vereinheitlicht wieder alles, wovor sich alle Gruppen eigentlich total fürchten, oder die Gesellschaft zersplittert in unglaublich viele Einzelteile, und man kann nur immer ein paar Ecken gerade so erkennen und mal zu einem Mosaik zusammenfügen, aber ein richtiges Bild wird es nicht. Wir müssen also für die Zukunft die Fähigkeit erlangen, das auszuhalten, dass wir alle komplett anders sind. Und das einzige Gebilde, das so zusammengesetzt ist, ist eine riesige Discokugel. Also das ist doch zumindest ein schönes Licht, in dem sich das alles dreht und spiegelt. Und das muss uns dann jetzt reichen.
Fischer: Klingt aber auch irgendwie, als wäre so eine Deutsche Einheit so ein bisschen eine kleine Blaupause gewesen für eine einigende Kraft aller unterschiedlicher Gruppen?
Taubert: Ja, natürlich, deswegen ist Einheit eigentlich immer das schönere Wort als Wende, weil natürlich hat sich viel gedreht und geflippt, aber da ist dann erst mal etwas passiert, dass man sich auch einander erst mal angeguckt hat und ohne sozusagen die pädagogischen und ideologischen Grenzen mal aufeinander gucken durfte. Das ist auf jeden Fall eine Vorerfahrung, die man gemacht hat. Aber ob diese konkrete Qualifikation dazu taugt, auch in Zukunft die Zersplitterung aufzuhalten, das weiß ich nicht genau. Aber wir können es ja versuchen, weil Deutschland ist vielleicht das einzige Land, das so eine Einheit mal so friedlich und so progressiv und so toll hinbekommen hat. Könnte ja sein, dass uns das noch mal gelingt.
Fischer: Also seien wir stolz darauf, Deutschland ist eine Discokugel. Greta Taubert, vielen Dank für das Gespräch.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.