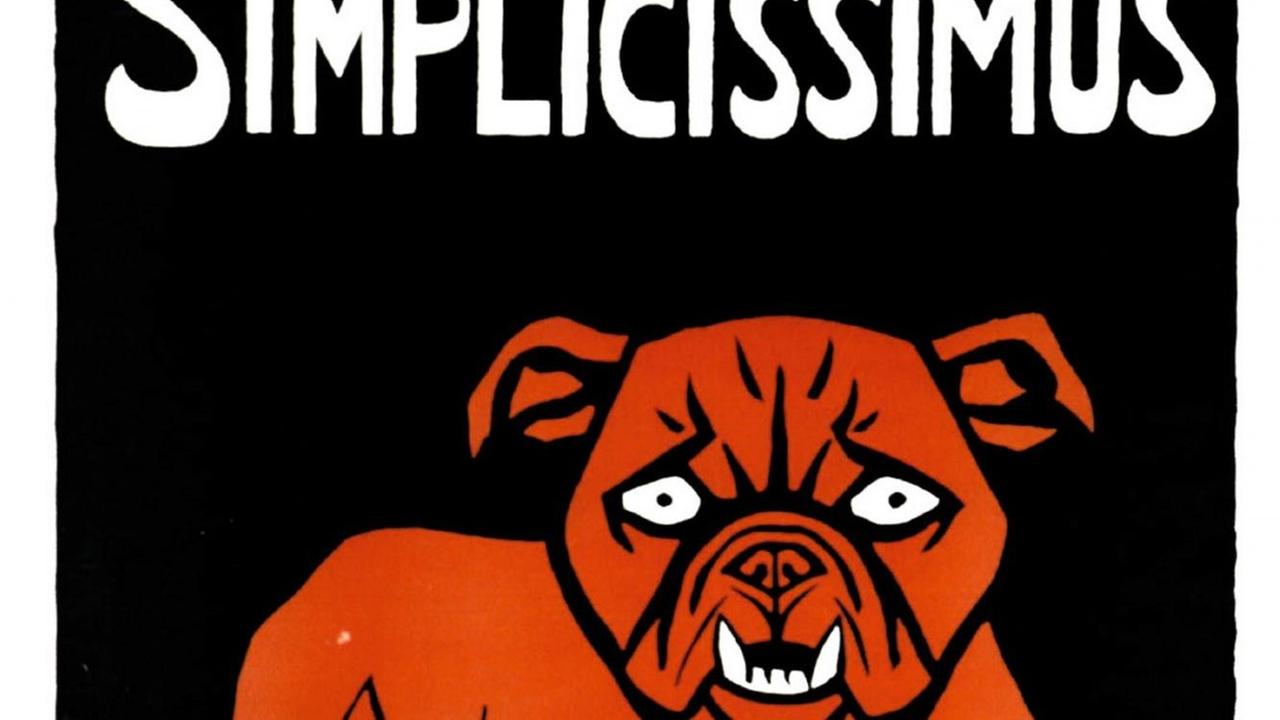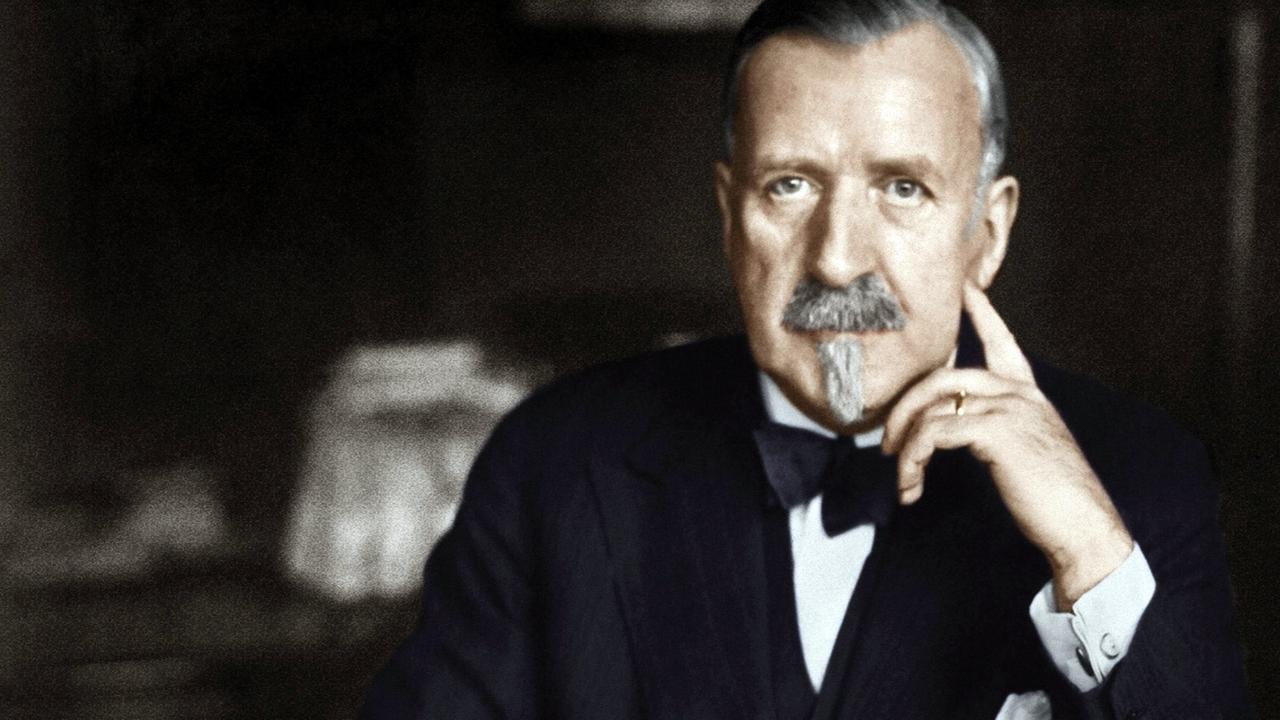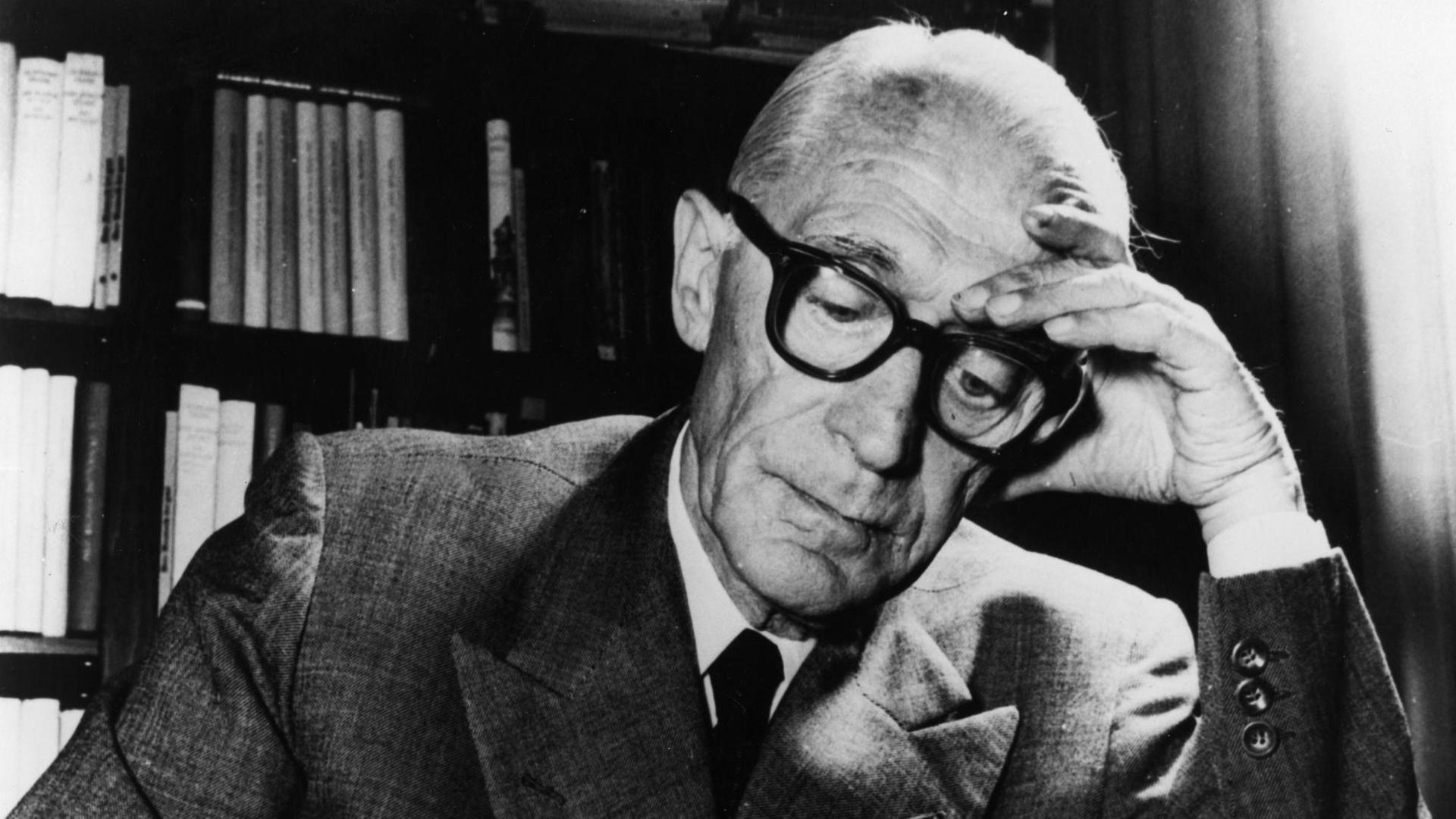
Leonhard Frank war ein äußerst heimatverbundener Franke, und er ist nach seiner Flucht vor den Nationalsozialisten auch dorthin zurückgekehrt. Es ist dennoch bezeichnend, dass seine Gesammelten Werke zu Lebzeiten nur in der DDR erschienen. In der Bundesrepublik war er dagegen umstritten. Noch 1965, vier Jahre nach seinem Tod, gab es im Stadtrat von Würzburg erregte Debatten darüber, eine Straße nach ihm zu benennen. Der Grund lag darin, dass Frank sich immer als "rebellischen Gefühlssozialisten" sah, und sein autobiografischer Roman aus dem Jahr 1952 hatte einen für die frühe Bundesrepublik äußerst provokativen Titel: "Links wo das Herz ist". Seinen auf direkte Effekte zielenden Schreibstil hat er selbst so charakterisiert:
"Viele Schriftsteller haben den Satz geschrieben ‚Der Himmel war blau‘. Es ist große Kunst, wenn sich da vor dem Lesenden plötzlich das blaue Himmelszelt auftut. Das kann sich ereignen, wenn der einfache Satz ‚Der Himmel war blau‘ an der einzig richtigen Stelle der Landschaftsschilderung steht. Eine halbe Zeile zu früh oder zu spät sind es vier nichtssagende Wörter."
Inmitten der Münchner Bohème
Leonhard Frank wird 1882 als viertes Kind eines Schreinergesellen in Würzburg geboren und wächst in äußerster Armut auf. Und in seinen Werken kommt immer wieder auch sein sadistischer Lehrer an der städtischen Elementarschule vor. Nach einer Schlosserlehre bricht Frank mittellos aus seiner Heimatstadt auf, um Kunstmaler zu werden und gerät in die Münchner Bohème um das Schwabinger "Café Stefanie". 1910 fasst er dann den Entschluss, nach Berlin zu gehen und sich als Schriftsteller zu versuchen. Vier Jahre später gelingt ihm tatsächlich mit dem Roman "Die Räuberbande" ein unerwarteter Bestseller. Ein Auszug:
"Plötzlich rollten die Fuhrwerke unhörbar auf dem holprigen Pflaster, die Bürger gestikulierten, ihre Lippen bewegten sich – man hörte keinen Laut, Luft und Häuser zitterten, denn die dreißig Kirchturmglocken von Würzburg läuteten dröhnend zusammen zum Samstagabendgottesdienst."
Zugespitzte, pazifistische Novellen
"Die Räuberbande" ist durchaus geprägt vom expressionistischen Zeitgeist, besticht aber in erster Linie durch erzählerischen Schwung. Eine Gruppe von Halbwüchsigen entwirft hier mit Indianerspielen eine Gegenwelt zur autoritären Repression. Leonhard Frank ist einer der wenigen, die den Beginn des Ersten Weltkriegs als eine Katastrophe empfinden. Er emigriert in die Schweiz und verfasst dort melodramatisch zugespitzte, pazifistische Novellen. Sie erscheinen 1917 unter dem Titel "Der Mensch ist gut", werden illegal nach Deutschland eingeführt und entfalten in ihrer Ablehnung des Kriegs eine enorme Wirkung:
"Eine Handgranate hat das heiligste Gut der Kriegswitwe zerrissen. Diese fluchwürdigen Phrasen, die Millionen das Leben kosten! Sie müssten endlich entlarvt werden."
Ein zweiter Gang ins Exil
In Berlin liest die Schauspielerin Tilla Durieux öffentlich aus diesem Buch und peitscht damit Hunderte von Zuhörern auf. Leonhard Frank ist während der Weimarer Republik einer der führenden Dichterköpfe Berlins, trifft mit seinen expressiv-pathetischen Stoffen, die gelegentlich auch haarscharf an der Kolportage vorbeischrammen, einen Nerv und schreibt antimilitaristische Film-Drehbücher. 1933 emigriert er sofort. In seinem autobiografischen Rückblick "Links wo das Herz ist" beschreibt Frank die dramatischen Umstände seiner Flucht aus einem Internierungslager in der Bretagne quer durch das von den Deutschen besetzte Frankreich, bis er in Lissabon ein US-Visum erhält. In Hollywood teilt er Büro an Büro das Schicksal Heinrich Manns, der als Drehbuchautor ähnlich erfolglos bleibt, kehrt 1950 nach Deutschland zurück und lebt bis zu seinem Tod am 18. August 1961 in München.
Leonhard Frank hat über sich selbst das beste Urteil gesprochen: "Ein großer Schriftsteller, einer der Großen, bin ich nicht geworden. Dazu hat es nicht gereicht. Aber ich tat, was ich konnte, und ein klein bisschen mehr." - So wenig ist das nicht. Sein Werk ist weitaus redlicher und lesbarer als die meisten seiner religiös-innerlichen Generationskollegen, die in den fünfziger Jahren in der Bundesrepublik gefeiert wurden.