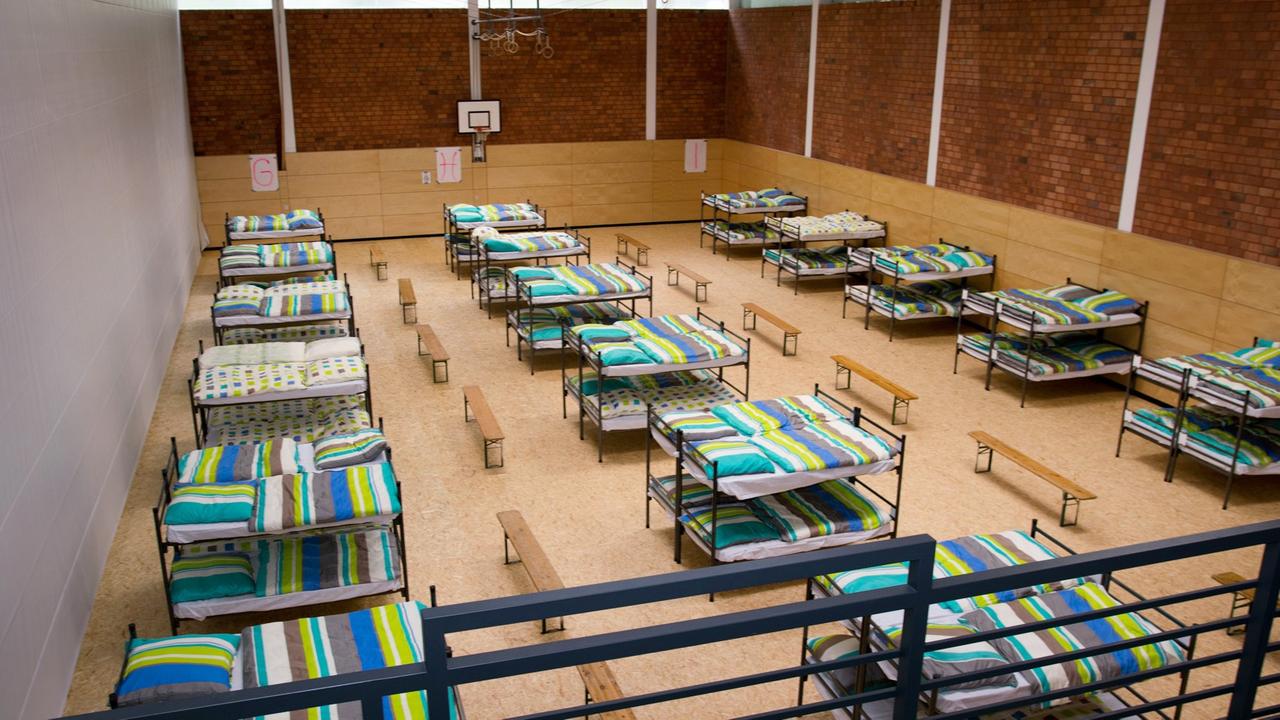Fernsehbilder, die "mit dem Kindchen-Schema arbeiten", seien von zentraler Bedeutung. Denn dadurch werde der Blick auf bestimmte Menschen gerichtet, die unser Mitgefühl hervorriefen, sagte Ute Frevert, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin, im Deutschlandfunk. "Und wenn das Kinder sind, dann gehen alle Herzen auf." Das sei "ein bewährtes Schema".
Sie denke, dass die vielen freiwilligen Helfer und die Menschen, die an die Bahnhöfe strömten und die Flüchtlinge willkommen hießen, diese Bilder nicht mehr brauchten. Sie hätten "genug Bilder jeden Tag vor Augen". Der Rest der Bevölkerung, der eher vorsichtig sei, brauche aber solche Bilder von Flüchtlingen. Die Wurzeln der Gastlichkeit reichten sehr weit zurück, betonte Frevert. Alle großen Religionen hätten das Prinzip der Barmherzigkeit und des Mitgefühls als "feste Anker" integriert. In den westlichen Gesellschaften habe die alte Ethik vor etwa 200 Jahren eine starke Modernisierung und damit auch eine neue Mobilisierung erfahren.
"Die Frage ist, wie lange unser Mitgefühl reicht"
Die Deutschen dürften stolz darauf sein, dass angesichts der vielen Flüchtlinge derzeit so viel tatkräftiges Mitgefühl gezeigt werde. Doch auch in vielen anderen europäischen Ländern sei ein "sehr starker Handlungsdruck von unten" zu beobachten, betonte Frevert.
Weil für die Flüchtlinge aus Syrien derzeit eine Rückkehr-Perspektive fehle, hätten sich viele nun aus den Nachbarländern ihrer Heimat nach Europa aufgemacht. Wir müssten uns darauf einrichten, dass diese Menschen bleiben wollten. Deshalb sei die Frage, wie weit unser Mitgefühl auf Dauer reiche, wenn es um die langfristige Integration der Menschen gehe. "Ob das unsere Gesellschaft aushält, ob hier die Willkommenskultur trägt, wird die Probe aufs Exempel sein." Klar sei aber auch, dass man auf Dauer nicht nur auf der Gefühls-Schiene weitermachen könne.
Das vollständige Interview können Sie sechs Monate in unserem Audio-Player nachhören.