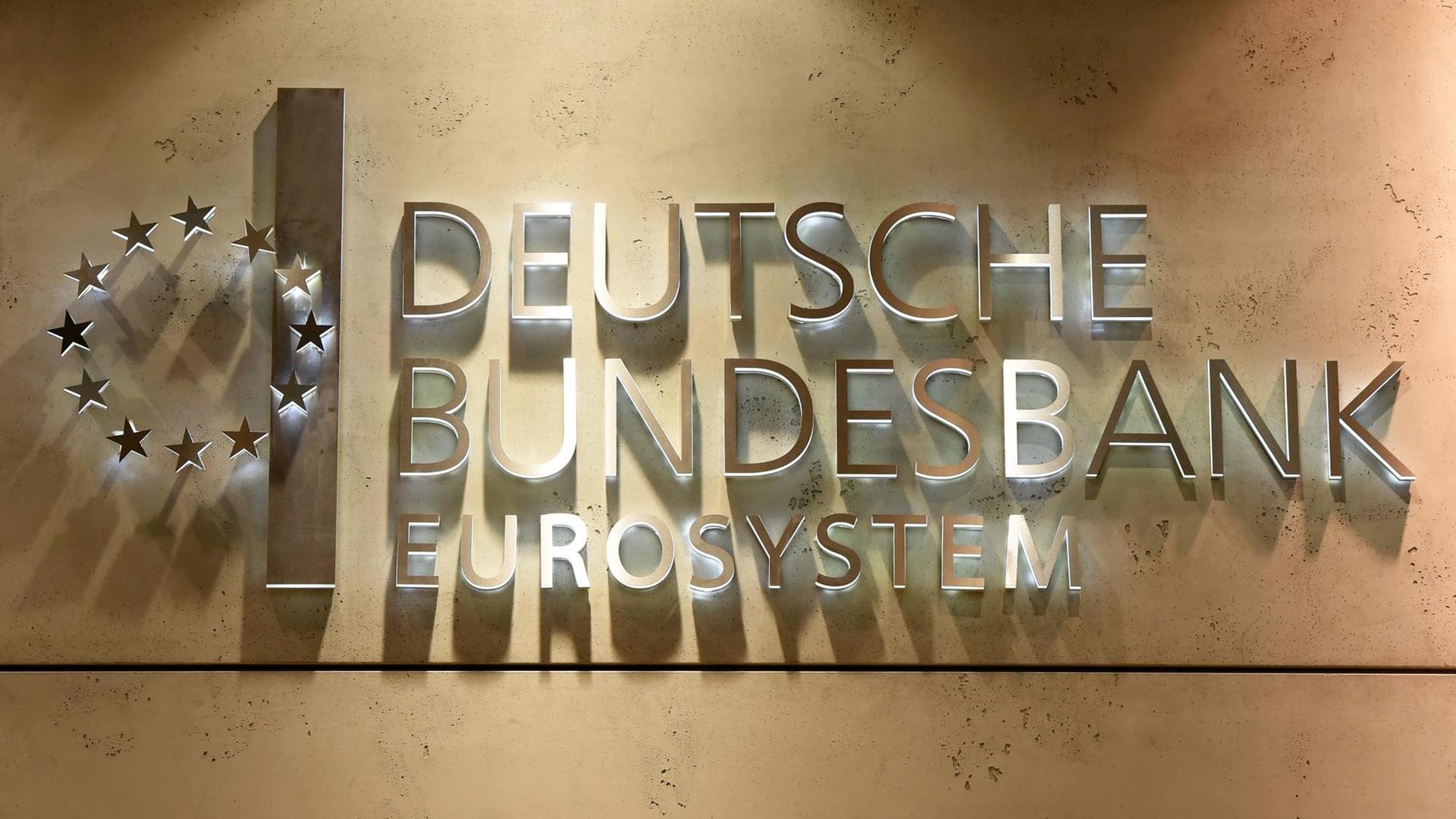Rund zwei Dutzend Stufen trennen einen warmen Frühlingstag vom Kalten Krieg. Gästeführer Peter Peiffer führt mich in einen Betonkeller, wenige Meter unter einem Hang, von dem aus man über die Mosel bis zur mittelalterlichen Reichsburg Cochem blicken kann.
"So, jetzt haben wir mal den Eingang freigelegt, dann gehen wir mal in die Anlage rein."
Die offene Tür gibt den Weg in einen langen betongrauen Gang frei. Am Ende unseres Wegs werden wir im Herzen der Anlage stehen - 134 Meter vom Eingang entfernt, 20 Meter unter der Spitze des Hügels, umgeben von tausenden Tonnen Beton. Was hier bis 1988 gelagert wurde, war ein Paradox: 15 Milliarden D-Mark, die wertvoll und wertlos zugleich waren.
Peter Peiffer öffnet eine weitere Tür in dem Bunker, den einst die Bundesbank hatte bauen lassen. Er kennt die Anlage seit 1989, als ihn die Bank als Hausmeister anstellte. Da hatte der Bunker seinen eigentlichen Zweck schon verloren.
Rechts geht eine Tür ab in einen Raum mit Duschtasse - und sonst nichts. Man hat damals mit dem Schlimmsten gerechnet. Falls jemand atomverseucht den Bunker betreten hätte, hätte er hier seine Kleidung entsorgen und sich duschen können. Sollte jemand dann die Anlage wieder verlassen wollen, hingen Strahlenschutzanzüge bereit. Cochem galt Anfang der 60er Jahre als besonders geeignet für einen Bunker, sollte es einen Atomschlag geben, sagt Peiffer.

"Wir haben ein enges Tal. Sieht man ja, wenn man so die Mosel betrachtet. Auf der anderen Seite: Es gibt viele militärische Einrichtungen in der Nähe. Das heißt, man hatte für die Anlage auch so 'nen gewissen Schutz nach außen. Aber auf der anderen Seite: Wenn es zum Eklat gekommen wäre, hätte man wahrscheinlich auch atomare Waffen eingesetzt, und da ist man davon ausgegangen, dass die Druckwelle praktisch über dieses enge Tal hinweggehen könnte."
Der Bau eines Bunkers ist nicht ungewöhnlich
Als die Firma Hochtief am 14. Mai 1962 mit den Bauarbeiten beginnt, sorgt das erst mal nicht für besonders große Aufmerksamkeit. Ein Dreivierteljahr vorher hatte die DDR begonnen, die Mauer zu bauen, und damit den Ost-West-Konflikt verschärft. Im Laufe der Bauarbeiten wird die Kuba-Krise die Welt in Atem halten. Der Bau eines Bunkers ist daher nicht ungewöhnlich. Zumal er nur ein Teil der Bauarbeiten umfasst.
Vor ihm liegen zwei Wohnhäuser, die zum schließlich 9.000 Quadratmeter großen Grundstück gehörten. Sie werden zu einem Schul- und Erholungszentrum der Bundesbank umgebaut. Zwei Jahre lang, oft den ganzen Tag zwischen 6 und 22 Uhr, setzt Hochtief große Geräte ein, um den Stollen in den Hang zu treiben. Tunnelbaumaschinen gibt es nicht, die Arbeiten dauern lange. Das sorgt für Ärger.
Nachdem sich Anwohner mehrmals bei der Polizei über Ruhebelästigung beschweren, teilt die Tageszeitung vor Ort im August 1962 mit:
"Dieser Bunker ist einmal für die Lehrgangsteilnehmer und die Teilnehmer an den Erholungskuren gedacht, aber 30 bis 50 Anwohner der Matthias-Härig-Straße und der Brauseleystraße können im Ernstfall ebenfalls dort Zuflucht finden."
Zweck des Bunkers ursprünglich geheim
"Und dann war ne Ruhe eingetreten. Man kann die Zeit mit heute nicht vergleichen. Das Obrigkeitsdenken, was man damals hatte, das war anders ausgelegt als heute, also man war darauf angewiesen, dass was von Seiten der Behörden mitgeteilt wurde, das hat man als gegeben hingenommen. Die Bauphase - zwo Jahre - und danach war das im Prinzip von dem, was man an Lärm sagen kann, auch ausgestanden."
Vom eigentlichen Zweck des Bunkers erfuhren die Menschen in Cochem lange nichts: "Ursprünglich war das sehr geheim."
Wolfgang Lambertz lebt seit 1974 in Cochem. Schon als Kind hörte er von dem Bunker.
"Bei dem Bau hat man sich über den Aufwand gewundert. Da hat man das kaschiert und hat gesagt: Ja, wir machen da etwas mehr, aber hat eben nicht gesagt den besonderen Zweck eines Bunkers. Das war ja im Prinzip ein Tarnbau, der da hergestellt worden ist mit diesem Schulungsheim, der Umnutzung des vorhandenen Gebäudes und dann Einbau eines Bunkers."
Heute ist Lambertz Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem.
"Am Anfang wusste man wenig. Man wusste, es ist ein Schulungsheim der Bundesbank, wo immer wieder viele fremde Menschen waren, die da irgendwas gemacht haben, aber die Gerüchte gingen immer schon durch die Stadt, dass da mehr ist. Und da ich auch befreundet war mit dem Sohn des damaligen Hausmeisters, wusste ich auch schon mehr, wusste ich auch schon, dass da ne Bunkeranlage ist."
Angst vor Falschgeld
Was Lambertz nicht wusste: dass dort tonnenweise bedrucktes Papier gelagert wurde, das aussah wie Spielgeld. Die aufgedruckten D-Mark-Werte ergaben zusammengerechnet rund 15 Milliarden. Sie hätten ganz schnell zur echten Währung in der damaligen Bundesrepublik werden können, erklärt der ehemalige Hausmeister des Bundesbankbunkers, Peter Peiffer.

"Damals hat man ja die Befürchtung, dass man versuchen könnte, die Bundesrepublik wirtschaftlich zu destabilisieren. Das hat man machen können zum Beispiel, indem man Falschgeld einschleust, das also so perfekt ist, dass man das kaum vom echten hätte unterscheiden können. Das hätte dann irgendwann zu 'ner sogenannten Hyperinflation geführt, das gesamte Wirtschaftssystem wäre zusammengebrochen."
Wenn kein Bürger mehr darauf vertraut, dass er noch echtes Geld in Händen hat, wenn er für die Scheine irgendwann nichts mehr bekommen könnte, dann verliert es sehr schnell an Wert. Bundesregierung und Bundesbank wollten verhindern, dass es soweit kommt. Sollte die Bundesrepublik mit Falschgeld geflutet werden, sollten alle Banknoten binnen kürzester Zeit ausgetauscht werden.
Die Deutschen wussten, wovor sie Angst hatten. Sie hatten es selbst versucht. Im Konzentrationslager Sachsenhausen ließen die Nazis Geld fälschen, vor allem britische Pfundnoten. 144 jüdische Häftlinge druckten 132 Millionen Pfund Sterling, die nahezu perfekt aussahen.
Die Bundesbank ließ Anfang der 60er Jahre also neue Banknoten drucken. Der aufgedruckte Wert: 26 Milliarden D-Mark. Sie entsprachen einem Großteil der Summe, die in den 60er Jahren in der Bundesrepublik als Bargeld im Umlauf war.
Das Geld sollte aber nicht komplett in den Tresoren der Bank in Frankfurt am Main gelagert werden. Die Stadt lag zu nahe am sogenannten Fulda Gap - so nannte die US-Armee die Stelle an der deutsch-deutschen Grenze, an der sie am ehesten einen Angriff aus dem Ostblock erwartete. Also brachte man den größeren Teil nach Cochem: 15 Milliarden D-Mark. Weiter weg vom Fulda Gap, aber von Frankfurt und der damaligen Bundeshauptstadt Bonn noch relativ leicht zu erreichen.
Über 100 Tonnen Papier
Eine weitere gepanzerte Tür führt in den Kern der Anlage: den Tresorraum. Der Schlüssel für die acht Tonnen schwere und mit Bolzen gesicherte Tür wurde ausschließlich bei der Bundesbank in Frankfurt gelagert. Alle paar Monate kamen Mitarbeiter vorbei und inspizierten das Geld.
Lautlos schwingt die Tür auf und gibt den Blick frei auf einen großen Raum, der durch Gitter in sechs mal drei Meter große Rechtecke unterteilt ist - wie in einem Gemeinschaftskeller, in dem jede Wohnung eine Parzelle hat.
"Gut, dann gehen wir mal in die Anlage rein. Hier hat man praktisch Geld reingebracht, um ne komplette Volkswirtschaft auszustatten. Wenn man das so sieht, wenn man durch den Gang geht, man hat hier praktisch tausende von Säcke und Kartons reingepackt, bis unter die Decke gestapelt, nur für den einen Zweck, wenn praktisch dieser Tag X gekommen wäre, man hätte das Geld austauschen müssen, da war man praktisch auf der sicheren Seite."

Über 100 Tonnen an Papier lagerten ursprünglich hier. Die Originale wurden später vernichtet. Im Bundesbankbunker lagern heute noch Muster. Die Scheine, die Peter Peiffer mir jetzt zeigt, sehen den Originalen auf den ersten Blick ähnlich, auf den zweiten Blick sieht man die Unterschiede.
"Man kann das an der Vorderseite mal so n bisschen verdeutlichen, da sieht man schon: Es ist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Originalschein vorhanden, die Rückseite natürlich komplett anders aufgebaut. Von der Vorderseite hat man sich erhofft, dass man den sogenannten Wiedererkennungswert berücksichtigen kann. Das heißt, wenn man das von Seiten der Bevölkerung angenommen hätte, dann wäre das einfacher gewesen, als wenn man ein komplett anderes Design genommen hätte."
Lautlos schwingt die tonnenschwere Tresortür wieder zu, beim Aufprall stoßen die acht Tonnen Stahl auf Beton.
Fernschreibsystem für die Kommunikation im Ernstfall
"So, die Treppe führt in den 2. Stock dieser Anlage. 2. Stock heißt, wir haben praktisch hier eine Art Wohnbereich vor uns. Hier haben wir praktisch mal Toilette, Waschräume."
Ein kleiner Aufenthaltsraum für vielleicht 20 Menschen, seitlich eine Kantinenküche, die nie benutzt wurde, daneben Schlafräume mit zweistöckigen Metallbetten wie in einer Kaserne und ein Sanitätsraum für Erste Hilfe. Im Raum dahinter ein paar einfache Holztische für Verwaltungsarbeiten - heute nachträglich so eingerichtet, wie es damals wohl mal aussah. Dazu Schreibmaschinen und Telefonapparate mit Kurbel statt Wählscheibe.
Zwei Räume weiter die Kommunikationszentrale, von der aus im Ernstfall der Kontakt zum Befehlsstand des Bundesinnenministerium gehalten werden sollte, der dann wohl im Regierungsbunker im Ahrtal in der Nähe von Bonn gewesen wäre.

"Was jetzt ganz wichtig war, das war das sogenannte Fernschreibsystem. Das heißt, man konnte dann praktisch erst mal wie beim Telefonieren auch eine entsprechende Nummer anwählen. Das heißt, jeder Teilnehmer hatte seine eigene Nummer wie beim Telefonnetz auch. Und dann, wenn die Verbindung hergestellt war, dann konnte man praktisch seinen Text durchgeben. Das war die einfache Art, die direkte Verbindung. Man hat das natürlich einfacher gemacht, man hat es auf sogenannte Lochstreifen gepackt, das heißt, wenn der Lochstreifen fehlerfrei beschriftet war, dann konnte man ihn in ein Lesegerät einlegen, dann auch wieder die Nummer anwählen, wo das Ganze hingeleitet werden sollte, und danach konnte man einen Knopf betätigen und dann zog der praktisch seinen Streifen durch, und der komplette Text wurde übertragen. Simples Prinzip."
Ende der Ersatzwährung 1988
Wir sind jetzt so weit weg vom Haupteingang wie es nur geht - 134 Meter im Berg. Am Ende des Gangsystems stehen wir in einem hohen Treppenhaus von viereinhalb Metern Durchmesser. An der Wand drehen sich 111 Stufen wie in einer Wendeltreppe nach oben - auf die Spitze des Hügels zu einem Ausgang im Wald.
"Das hätte man auch benutzt nur einmal, um die Anlage zu verlassen, im Falle, wenn der vordere Bereich jetzt nicht mehr zugänglich gewesen wäre, hätte man das als Notausstieg nutzen können."
Gebraucht hat man ihn nie. Genauso wenig wie die Ersatzwährung selbst. Ende der 80er Jahre sind die Scheine nicht mehr fälschungssicher. Der Zahlungsverkehr wird zunehmend bargeldlos abgewickelt. Ende 1988 zieht die Bundesbank die Ersatzwährung ab, erzählt der heutige Bürgermeister Wolfgang Lambertz.
"Mit dem Abtransport war das allgemein öffentlich. Das war ein sehr großer Aufwand, das wurde in Cochem auch noch sehr genau gezählt, das haben wir auch mitbekommen. Also es wurde nicht einfach palettenweise die Währung abgezogen, sondern hier in Cochem wurde noch genau Buch geführt, ob noch alles da ist. Aber dann war eigentlich klar, was das war."
Die Bank schreddert das Geld, auch wenn nicht ganz klar ist, ob einzelne Scheine der Aktion entgangen sind. Lange liegt die Anlage brach. 1994 kauft die Volksbank den Bundesbankbunker und richtet einen Kundentresor ein, den sie aber nur wenige Jahre nutzt. Erst 2014 kauft ein Unternehmerpaar aus der Region den Bundesbankbunker und sorgt seitdem für Unterhalt und Betrieb. Mehrere zehntausend Menschen haben sich die Anlage inzwischen angesehen. Es ist eine Reise in die Zeit des Kalten Krieges, der jahrzehntelang unbemerkt auch in Cochem an der Mosel in der Luft lag.