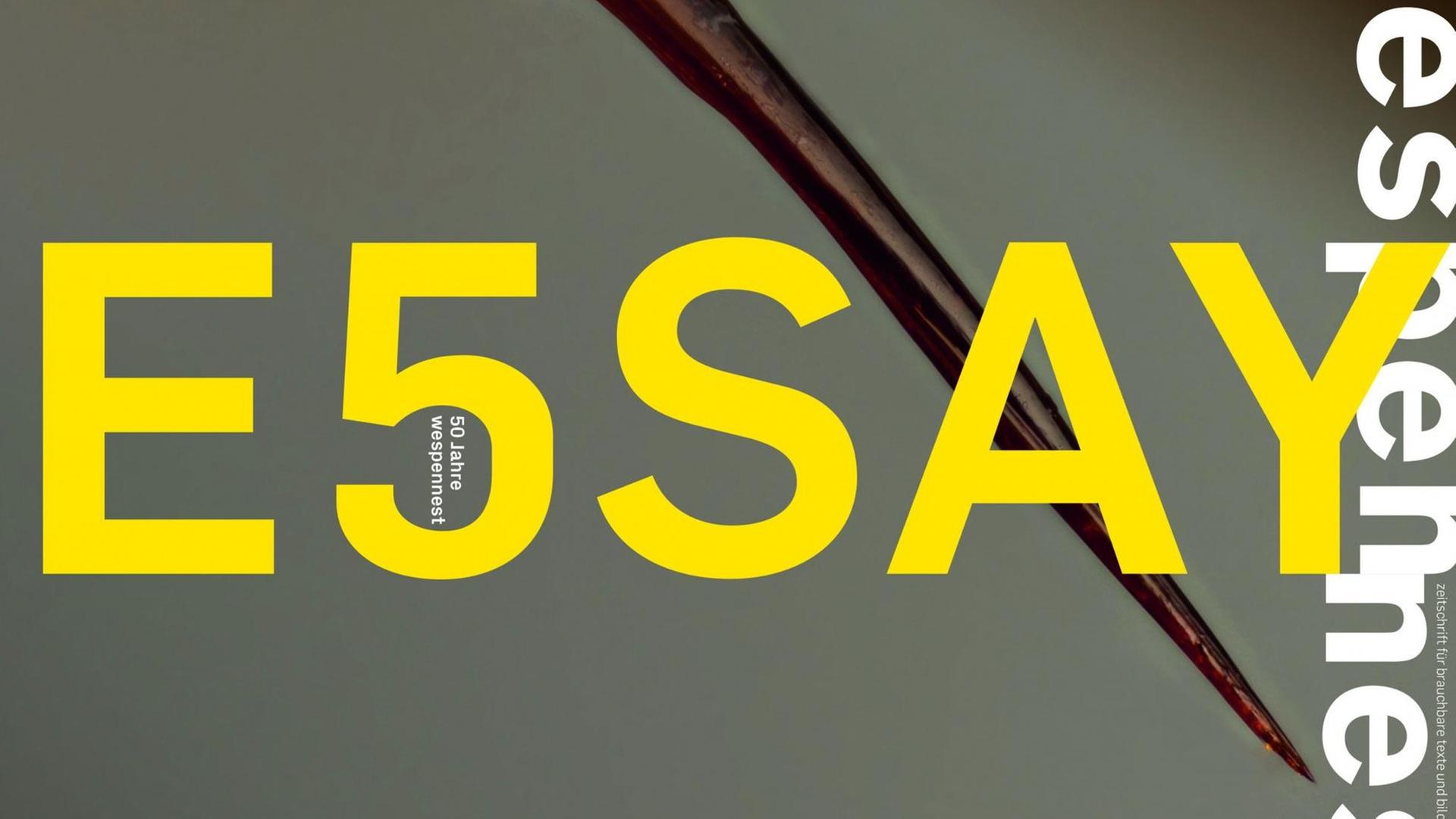
Eigentlich war es ein kleines Jubiläum, das unsere Sendereihe zum Anlass für das Gespräch nehmen wollte: Die Zeitschrift "wespennest" feiert vor einiger Zeit ihr 50-jähriges Bestehen. Mehrere Jahrzehnte, die im Dienste des Essays standen! "Der Essay ist ein Krisenphänomen" heißt es in der Jubiläumsausgabe, die noch davon ausgeht, dass in Ermangelung einer Umbruchssituation das Suchende, Abwägende des Essays in allzu sicheren Zeiten keine Zukunft mehr hat.
Es kam bekanntlich anders. Kann der Essay zur neuen Blüte gelangen, indem er neue Technologien des Selbst reflektiert? Wird er für Kontingenzbewältigung sorgen in einer Zeit, in der die Religionen längst an Verbindlichkeit verloren haben? Und wo steht der Essay insgesamt, in Zeitschriften ebenso wie im Hörfunk? Ist er immer noch eine Textgattung, die männliche Autoren bevorzugen, selbst heute?
Pascal Fischer: Mit Pascal Fischer am Mikrofon und einem Thema, dessen Dringlichkeit in den vergangenen Wochen stets gewachsen ist. "Essayistik in der Krise" haben wir die Sendung genannt. Denn wie hieß es so schön in der Jubiläumsausgabe zu 50 Jahren der Zeitschrift "wespennest" aus Wien? "Der Essay ist ein Krisenphänomen", das schrieb dort der Literaturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk und meinte damit: In Zeiten des Umbruchs, ja, da liegt das einfach in der Luft. Der suchende, tastende, abwägende Essay, der erkundet gerne unsicheres und neues Terrain mit viel Subjektivität, die vielleicht doch zu allgemeineren Erkenntnissen vordringt. So will es diese Form.
Vor ein paar Monaten schien die Welt ein wenig sicherer, fast als nehme die Historie dem Essay den Antrieb. Diese Einschätzung wird jetzt natürlich fragwürdig, gerade jetzt in der Pandemie. Corona-Tagebücher von Autorinnen und Autoren fluten die Medien. Es mangelt nicht an Befindlichkeiten und Bevormundungen, wie man zu fühlen und wie man die Krise durchzustehen habe. Ist der Essay die Textform der Stunde oder eher des nächsten Tages? "Eine Textgattung als Sanitäter", so heißt unsere Sendung deshalb im Untertitel. Und diskutieren möchte ich das mit zwei Spezialistinnen für den Essay, nämlich mit den beiden Herausgeberinnen der traditionsreichen Zeitschrift "wespennest" aus Wien. Das sind Andrea Zederbauer, sie ist nebenbei auch noch Übersetzerin aus dem Schwedischen. Aus Wien ist sie mir nun zugeschaltet. Willkommen, Frau Zederbauer!
Vor ein paar Monaten schien die Welt ein wenig sicherer, fast als nehme die Historie dem Essay den Antrieb. Diese Einschätzung wird jetzt natürlich fragwürdig, gerade jetzt in der Pandemie. Corona-Tagebücher von Autorinnen und Autoren fluten die Medien. Es mangelt nicht an Befindlichkeiten und Bevormundungen, wie man zu fühlen und wie man die Krise durchzustehen habe. Ist der Essay die Textform der Stunde oder eher des nächsten Tages? "Eine Textgattung als Sanitäter", so heißt unsere Sendung deshalb im Untertitel. Und diskutieren möchte ich das mit zwei Spezialistinnen für den Essay, nämlich mit den beiden Herausgeberinnen der traditionsreichen Zeitschrift "wespennest" aus Wien. Das sind Andrea Zederbauer, sie ist nebenbei auch noch Übersetzerin aus dem Schwedischen. Aus Wien ist sie mir nun zugeschaltet. Willkommen, Frau Zederbauer!
Andrea Zederbauer: Schönen guten Tag.
Pascal Fischer: Und im selben Studio in Wien, aber in einer anderen Schallkabine sitzt - natürlich wegen der Sicherheitsvorkehrungen in Coronazeiten - Andrea Roedig, die auch als freie Publizistin arbeitet. Willkommen Frau Roedig!
Andrea Roedig:: Hallo Herr Fischer!
"Essay kann nicht zum Sanitätsdienst eingeteilt werden"
Pascal Fischer: Ja, Frau Zederbauer, ich möchte mal mit Ihnen beginnen. Wie schlägt sich denn der Essay bislang in der Corona-Zeit? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Andrea Zederbauer: Also ich bin skeptisch, was die Indienstnahme des Genres betrifft. Ich denke, dass der Essay an sich nicht sich zur Krisenbewältigung verordnen lassen muss und auch nicht zum Sanitätsdienst eingeteilt werden kann. Er kann natürlich Orientierung geben. Beispiele aktueller Essayistik... Ich wäre noch vorsichtig, um kein deutschsprachiges Beispiel zu nennen, sondern ein angloamerikanisches. Die in Chicago angesiedelte Zeitschrift "The Point Magazine" hat relativ früh etwas eingerichtet: Das nennen sie "A quarantine journal" mit dem Untertitel "Dispatches on the corona virus crisis from writers around the world". Das ist tatsächlich ein interessanter Versuch, schnell auf die Krise zu reagieren. Hier werden eben Dispatches gesammelt, also Depeschen, Meldungen, Berichte. Das sind essayistische Fragmente. Dazu zählen wahrscheinlich auch die Corona-Tagebücher. Wenn man den Essay als etwas versteht, was gewissermaßen einen Gedanken entwickelt, so dass sozusagen die anderen Gedanken, an die er geknüpft ist, tatsächlich Erschütterung erfahren, dann ist es wahrscheinlich noch zu früh. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon abschließend sagen können, was die Konsequenz aus dem ist.
"Coronakrise als Anlass, um länger schlummernde Gedanken hervorzuholen"
Pascal Fischer: Frau Roedig, würden Sie da zustimmen? Braucht der Essay als langsamere, ruhigere Form vielleicht einfach auch mehr Zeit und ist eben kein tägliches Feuilleton, kein Leitartikel, kein Artikel, den man so raushaut in dieser Zeit?
Andrea Roedig: Ja, also ich stimme auf jeden Fall zu. Ich meine auch, es ist eine Form, die länger Zeit braucht. Ich hätte allerdings schon noch ein deutsches Beispiel: Zum Beispiel Thea Dorn in der "Zeit" hatte diesen Text geschrieben: "Schlimmer als der Tod ist der erbärmliche Tod" - eben die Reflexion darüber, warum wir jetzt in der Krise das Leben als dasjenige, das Leben zu erhalten, als das höchste Gut sehen und nicht vielleicht dann doch den guten Tod. Man merkt dem Essay allerdings an - also Thea Dorn kommt aus der Philosophie -, und man merkt dem Essay halt an, dass da Gedanken drin sind, die schon sehr lange ruhen. Und auch fürs eigene Arbeiten muss ich immer sagen, habe ich so ein Hase-und-Igel-Prinzip, dass ich denke: Lass mal die anderen Hasen laufen. Wir Igel sitzen da, und irgendwann kommt schon eine Situation, die auch auf die Gedanken passt, die wir schon lange haben, weil Geschichte vielleicht auch gar nicht so aktuell ist. Es wiederholt sich vieles. Oder die Anlässe, um Themen aufzugreifen, wiederholen sich halt auch. Das heißt, wenn man lange über etwas nachdenkt, gibt es dann sicherlich immer Anlässe wie jetzt zum Beispiel die Corona-Krise, um dann Gedanken, die schon länger schlummern, noch einmal hervorzuholen.
"Essay hat eine Haltung, aber keine Meinung"
Pascal Fischer: Wie sehen Sie das denn: Viele Leitartikel, die folgen der Devise: "Was jetzt zu tun ist!" - wenn sie nicht sogar genau so heißen. Aber soll denn ein Essay klar Position beziehen und etwas wollen? In dem Jubiläumsheft des "wespennest" schreibt zum Beispiel Wolfgang Müller-Funk: "Der Essay möchte gerade dieses unerbittliche Entweder-Oder ja abschütteln. Es ist ja eben im wörtlichen Sinne ein versuchendes, ein tastendes Denken."
Andrea Roedig: Genau. Es ist eine Form des Nachdenkens. Und ich würde sagen, der Essay hat eine Haltung, aber keine Meinung. Also Meinung ist ja meistens etwas sehr Zugespitztes, und ich sage euch jetzt, wie es ist... Und er hat auch, denke ich mir, ein Thema und einen Gegenstand, aber keine direkte These. Also. wenn, hat er Thesen. Das Wichtige am Essay ist – denke ich schon- das Offenhalten der Lösung, die dann irgendwann herauskommen wird, also ganz wichtig. Und natürlich gibt es Leitartikel, die eine Essay-Form haben. Aber das Schöne am Essay ist halt, dass er im Endeffekt nicht straight on auf ein Ziel hinzuläuft und sagt: "So, und das wollte ich euch jetzt sagen!". Sondern eher eine nachdenkliche Form ist, die Ausgänge verschiedener Arten auch nochmal ermöglicht.
Pascal Fischer: Nun kommt ja – Frau Roedig- im Jubiläumsheft des "wespennest" es auch eine Position vor von Zadie Smith, die wird erwähnt, die angesichts der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten schrieb, nun sei doch so ein ambivalenter Blick des Essays auf die Welt eigentlich unmöglich. Gibt es da nicht vielleicht doch irgendwo einen Kipp-Punkt, an dem man dann doch Position beziehen muss, an dem es Pflicht ist, Haltung zu zeigen?
Andrea Roedig: Ganz sicher. Also Haltung, würde ich sagen, hat der Essay immer. Aber er hat keine in dem Sinne politische... Also das Politische ist halt immer ein Denken, was sehr stark in Freund und Feind und in Lager sich aufspaltet. Das sehen Sie auch an diesen Diskussionen, um die angeblich- ich mache jetzt mal so Anführungszeichen- "politisch korrekte Sprache". Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die können in einer bestimmten politischen Situation so nicht gesagt werden. Und der Essay traut sich, Dinge anzusprechen, die vielleicht in dem politischen Raum so nicht gesagt werden können. Aber er ist reflektierend. Er versucht gar nicht erst, in politische Lager hinein zu gehen, das heißt, für meine Begriffe, es gibt auch politische Essays natürlich oder politische Essayistik. Aber, ein kluger Essay ist eigentlich einer, der den Lesern und Leserinnen die Freiheit lässt, selber zu entscheiden. Und natürlich: Haltung heißt immer: Die Perspektive, aus der ich etwas berichte, zeigt natürlich sehr klar, woher ich komme. Nur ich sage es nicht. Ich sage jetzt nicht so, Trump ist böse. Sondern ich beschreibe vielleicht, was er tut. Und das, glaube ich, ist dem Essay die angemessenere Form. Er ist kein direkt politischer Kommentar. Kann er sein. Also es ist ja eine wahnsinnig weite Form, er kann auch in Form eines politischen Kommentars daherkommen. Aber wenn, würde ich sagen, er hat auf jeden Fall die Aufgabe, eine Haltung zu haben, sonst würde er auseinanderfallen. Man merkt, wer der Autor oder die Autorin ist, aber er spitzt halt nicht auf ein Entweder-Oder zu und sagt: So, und jetzt nur das Eine oder das Andere.
"Essayistik ist die Reflexions-Gattung, die literarisches Selbstverständnis bietet"
Pascal Fischer: Frau Zederbauer, blicken wir doch da mal - Stichwort, woher jemand kommt - in die Geschichte der Zeitschrift "wespennest". Im Heft ist zu lesen das "wespennest" hat sich an einem bestimmten Punkt aus der Not heraus dem Essay geöffnet. Das klingt ja fast, als sei der Essay so eine Art unbeliebte Form. Wie ist es denn damals zu dieser Öffnung gekommen? Und welche Haltungen oder Enthaltungen spielten eine Rolle?
Andrea Zederbauer: Nun, die Öffnung ist vermutlich die Konsequenz einer ausdünnenden literarischen Tradition. Die Gründungsgenerationen des "wespennest" hatten sich der fortschrittlichen Literatur verschrieben, also einem Literaturbegriff, der Gesellschaftskritik weiter verstanden hat als Sprachkritik, also die herrschenden Verhältnisse, denen wollte man zu Leibe rücken mit dem Begriff der Brauchbarkeit. Die Literatur sollte brauchbar sein. Es war die Zeit der Siebziger, Werkkreise, Lehrlingstheater, Arbeiterschriftsteller... Diese Traditionen, die sich in Österreich an Namen wie Gernot Wolfgruber beispielsweise, Franz Innerhofer knüpfen, die ist einfach ausgedünnt. Und die damaligen Redakteure hatten zum Glück die Essayistik auch als ihre Passion. Man hätte schlicht auch die Zeitschrift nicht mehr viermal pro Jahr erscheinen lassen können mit Texten von Arbeiterschriftstellern. Die 80er waren mittlerweile ins Land gezogen, und es war nicht in dem Sinn erfolgreich, gegen die entfremdeten Verhältnisse am Fabrikstor anzukämpfen. Die Redaktionsmitglieder waren alle selbst Autoren, sind sozusagen mit ihrem eigenen Schreiben da ein Stück weit auch an Grenzen gestoßen. Und die Essayistik ist an sich die Reflexions-Gattung, die literarisches Selbstverständnis bietet. Das wurde dann glaube ich, einfach in die Zeitschrift getragen und forciert.
Pascal Fischer: Hat sich denn der Essay im "wespennest" spürbar gewandelt?
Andrea Zederbauer: Nun, die Tradition der Siebziger hat natürlich zur Folge gehabt, dass es sich auf der Linie narrative versus diskursive Elemente, politischer Kommentar versus sozusagen freies Denken vermutlich auch gewandelt hat von stärker politischen Interventionen, Stellungnahmen, Analysen... Man hat das auch nicht Essay genannt. Es waren Abhandlungen, Aufsätze, Positionsbestimmungen. Die Reflexion der Essayistik als Genre in der Zeitschrift ist ja in dem Sinne nicht passiert. Wir wollten das Jubiläum zum Anlass nehmen, um darüber nachzudenken.
"Es gibt natürlich auch diese Form des akademischen Proletariats"
Pascal Fischer: Wer schreibt da eigentlich? Im Heft sagt Franz Schuh, etwas, ja, man könnte sagen, sarkastisch, es sei die Äußerungsform des akademischen Proletariats. Und Michael Rutschky wird zitiert mit den Worten: "Akademische Intellektuelle mit unklarem Status, die sich aufgrund dieser Unklarheit plötzlich wieder als Schriftsteller präsentieren möchten, obwohl die Künstlerträume eigentlich längst hinter ihnen liegen sollten". Empfinden Sie das auch als Sarkasmus? Ist das eine realistische Beschreibung?
Andrea Zederbauer: Nun, wenn man den Essay ansiedelt zwischen der Wissenschaft und der Kunst, dann gibt es natürlich auch diese Form des akademischen Proletariats, nennt Schuh das an anderer Stelle. Er betont ja, und das ist natürlich ein Spiel, das Heruntergekommene an dieser Gattung, rettet es aber, möchte es retten im Sinne von Ernst Jandls Dichtung beispielsweise, das Projekt einer heruntergekommenen Sprache, die eben nicht obenauf schwimmt, die sozusagen nicht in die Weihen akademischer Professuren aufgenommen wurde und eine Position des Außenseiters bezieht, die Essayistik als solche, und sich eben dann auch nicht in Dienst nehmen lässt vom politischen Kommentar.
"In jedem guten Essay steckt immer Reflexion über den Tod mit drin"
Pascal Fischer: Es gibt in dem Heft, Frau Roedig, einen Text, ja, bei dem weiß ich gar nicht, ob der sich von irgendetwas in den Dienst nehmen lassen wollen würde. Das ist der Text von William T. Vollmann. Das ist schon ein etwas älterer Text, aber eben wie so ein guter Essay nun mal ist, spielt das eigentlich keine Rolle, wenn man den liest. Er stellt keinerlei Forderungen im Sinne von "Was jetzt zu tun sei" oder so auf. Sondern der Text umkreist dieses Thema Tod, dieses sehr zentrale Thema Tod. William T. Vollmann beschreibt darin seinen Besuch in den Katakomben von Paris. Das sind diese riesigen unterirdischen Gebeinehöhlen. Er beschreibt Mordermittlungen und Leichensektionen in Los Angeles, sehr drastisch, auch sehr unter die Haut gehend, sehr nachdenklich... Warum haben Sie diesen Text gedruckt, gerade jetzt, in dieser Jubiläumsausgabe zum Thema Essay?
Andrea Roedig: Na ja, wir hatten ja diesen Schwerpunkt, der sich theoretisch mit dem Essay beschäftigt. Also die Frage eben stellt: Was ist ein Essay überhaupt? Wie sieht ein Essay aus? Wie könnten wir einen guten Essay bestimmen? Gibt es eine Zukunft für die Gattung Essay? Auch das haben wir uns als Frage gestellt, und dann wollten wir halt demgegenüber einfach ein Beispiel nehmen: Was ist für uns ein richtig guter Essay? Und da haben wir das große Glück gehabt, diesen Text von Vollmann zu bekommen, der noch nicht übersetzt war. Auch das tut das "wespennest" halt: Wir übersetzen aus anderen Sprachen Essays, gute Essays, die es ja nicht so superhäufig gibt, auch ins Deutsche und publizieren sie. Und Vollmann kommt aus der Kriegsreportage und es gibt ja auch so einen Reportageessayismus, und wir fanden das also eine sehr gute Möglichkeit, vorzuführen, wie unserer Meinung nach ein toller Essay aussieht, der gut altern kann. Sie können natürlich den Bogen schließen zu Montaigne und zu Reflexionen über den Tod. Und vielleicht kann man sagen: In jedem guten Essay steckt immer ein Stück weit Reflexion über den Tod mit drin. Also das ist jetzt gerade so ein Bonmot, was mir gerade einfällt. Aber ansonsten war es tatsächlich einfach so: Wir bekamen die Möglichkeit, dass Robin Detje uns diesen Text übersetzen konnte, und hatten halt die Möglichkeit, ihn zu bringen, und fanden das als Beispiel ganz besonders gut. Also Tod war jetzt nicht unbedingt das Thema. Wir hätten auch einen anderen vermutlich genommen.
Essay als Krisenphänomen
Pascal Fischer: Frau Zederbauer, das ist ja trotzdem ein Stichwort: Tod. Wenn wir jetzt wieder auf die Corona- Pandemie zurückkommen: Bricht da eine große Zeit für den Essay an. Denn die Pandemie wird uns ja genau das bescheren: ein Nachdenken über den Tod, über Sterblichkeit - leider. Im Heft schreibt Wolfgang Müller-Funk, der Essay sei ein Phänomen, eine Form, die in Krisenzeiten aufkommt. Ist die Pandemie jetzt tatsächlich schon so ein, ja, Epochenbruch wie die Spätantike, die frühe Neuzeit, Modernismus oder auch die Posthistoire, die ja Wolfgang Müller-Funk so ein bisschen als Zeiten ansieht, in denen dann der Essay blüht?
Andrea Zederbauer: Also Wolfgang Müller- Funk beginnt seinen Text über den Essay als Krisenphänomen bei Montaigne und erwähnt eben, dass in der Zeit Montaignes das Monopol von katholischer Welterklärung zu Ende geht. Die Zeit der Reformation bricht an. Und er arbeitet sich dann in dem Text sozusagen die Geschichte hinauf. Ob man jetzt die derzeitige Pandemie als einen solchen Epochen-Bruch in die Geschichtsbücher schreiben wird, das können wir derzeit auf jeden Fall noch gar nicht wissen. Er hat es tatsächlich ein wenig in Bezug auf seine Formate, also die Medienformate derzeit bezogen. Dass der Essay ein Krisenphänomen ist. Und da hat die Pandemie ganz sicher eine Auswirkung. Der Essay braucht Orte, er braucht eine materielle Basis, und ohne diese Orte kann er nicht erscheinen. Und diese Formate sind natürlich in den letzten Jahrzehnten einfach ins Hintertreffen geraten.
"Essay ist die Entfaltung eines Gedankens auf eine stilistisch elegante Weise"
Pascal Fischer: Das ist ein bisschen die Ansicht, dem Essay gehen die Nischen aus. Wolfgang Müller- Funk beklagt ja auch in seinem Text: Die Feuilletons bringen Heiter-Besinnliches, an der Uni soll natürlich wiederum streng wissenschaftlich argumentiert werden, in den Schulen, da ist nicht mehr viel von Essayistik und Literatur zu finden. Das kann man natürlich so sehen. Aber Sie zeigen ja, Andrea Roedig, wenn ich Sie ansprechen darf, in Ihrem Heft, dass der Essay nicht nur in Texten bestehen muss. Es gibt einen Foto-Essay, es gibt eine Skizze zu einem Essay-Film, es gibt einen Essay über Radio-Essayistik. Wie viel oder wie wenig Text braucht denn ein Essay?
Andrea Roedig: Tja, das ist die Frage. Ich würde noch einmal eine kleine Definition anfügen. Ich würde sagen: Essay ist die Entfaltung eines Gedankens auf eine stilistisch elegante Weise. Also um auch da noch einmal Virginia Woolf zu zitieren: Wichtig für den Essayisten oder die Essayistin ist, "to know how to write". Und da ist natürlich der Text wesentlich. Allerdings glaube ich auch, dass die Entfaltung eines Gedankens auf eine stilistisch elegante Weise genauso in Bildstrecken geschehen kann, in Tönen natürlich geschehen kann, im Film geschehen kann - und natürlich im Text, das sowieso. Wichtig ist allerdings, glaube ich, dass er eine bestimmte Länge braucht. Er braucht eine mittlere Länge, und das ist, glaube ich, im Moment auch genau das Problem: Er ist, ähnlich wie die Kurzgeschichte, eigentlich zu kurz, um ein Sachbuch zu werden oder ein Roman zu werden, zu lang aber, um jetzt in eine Zeitung zu passen. Und dennoch glaube ich, dass also eben kurze Stücke wie kleine Facebook-Eintragungen oder kurze Kommentare, zu wenig Atem haben, um tatsächlich die Essay-Form zu füllen. Also, um es wieder zu sagen: Der Essay ist natürlich eine sehr offene Form. Man kann auch kleine Stücke als Essay bezeichnen und manchmal auch vielleicht mit ganz gutem Grund. Aber eigentlich braucht er tatsächlich eine argumentative Reihe. Er braucht zumindestens ein Stück Atem und einen bestimmten Platz, um sich ausbreiten zu können. Und das sind bei uns zum Beispiel immer zwischen 10 und 30 000 Zeichen. Also als Zeitungsseiten gesehen wären das dann zwei Seiten im Heft bis zu sechs Seiten. Das ist ungefähr das, was eine gute Essaylänge für meine Begriffe ausmacht und was es braucht, um mehr zu sagen, als nur kurz etwas anzureißen, aber auch in einer gewissen Weise konzise genug zu sein, um jemanden dabei zu halten. Es gibt auch eine sehr schöne Definition von Phillip Lopate, der Autor, die Autorin solle- müsse- merken, wann jemand beginnt, sich zu langweilen. Ich glaube, gute Essayisten wissen ganz genau, wann sie Schluss machen müssen, wann es anfängt, langweilig zu werden. Es ist also eine stilistisch sehr elaborierte und glänzende Form in dem Sinne, wenn man‘s wirklich beherrscht. Und egal, ob das jetzt als Bild, als Ton, als Film oder als Text funktioniert. Aber es ist die mittlere Strecke, die guten Mittelstreckenläufer*innen sind Essayistinnen und Essayisten.
"Die Lese-Geduld im Netz ist doch relativ begrenzt"
Pascal Fischer: Aber würden Sie sagen, so etwas findet sich im Netz? Im Heft beklagt John Palatella, es gebe einen Druck hin zu Wahrnehmbarkeit und Geschrei, zu Clickbaiting, also zu sehr zur Schau gestellter Subjektivität, zum sehr zur Schau gestellten Ich-Sagen. Das will Klicks generieren, mehr aber auch nicht. Oder fallen Ihnen Bloggerinnen und Blogger ein, bei denen sie sagen würden: Ja, das geht in Richtung Essay. Oder ist dieses neue Medium kein Medium für den Essay?
Andrea Roedig: Naja, wir hatten als Beispiel ja zum Beispiel Enis Maci mit "Eiscafé Europa", das ist bei Suhrkamp herausgekommen, was als Essayistik bezeichnet wird. Und das sind - wenn ich das recht sehe - zum großen Teil Blogs gewesen. Da würde ich sagen: Ja, das funktioniert - für mich! Kann auch sein, dass es eine Generationfrage ist. Für mich funktioniert es eher gedruckt und in Buchform. Und vielleicht könnte man auch sagen: In dem Moment, wo diese Blogs in einem Buch gesammelt sind, und das passierte im Moment relativ häufig, dass es dann wiederum Printprodukte gibt, da funktioniert es fast besser als Essay denn im Netz selber, weil - zumindest, was ich beobachte oder wir beobachten - , ist die Lese-Geduld im Netz doch relativ begrenzt. Und man braucht auch für den Essay eine bestimmte Art von langem Atem auch beim Lesen, so einen mittleren Atem.
Verschiedene Bewegungen an verschiedenen Orten
Pascal Fischer: Frau Zederbauer, das "wespennest" ist ja nun eine Zeitschrift, die in Wien angesiedelt ist. Da möchte ich Sie gern fragen: Blicken Sie eigentlich irgendwie anders auf den Essayismus als die Kollegen in Deutschland? Oder sind die Szene-Hotspots Wien und Berlin einfach nur Metropolen des deutschsprachigen Essayismus? Und da kann man gar keinen Unterschied mehr machen, weil Autorinnen und Autoren ihren Essay veröffentlichen, wo sie möchten oder können.
Andrea Zederbauer: Grundsätzlich, glaube ich, muss man für Zweiteres argumentieren. Es gab kürzlich einen Essay-Preis, der wurde ausgerufen, gemeinsam mit der Zeitschrift "Edit", wo der Preisträger dann einen langen Essay über den Essay verfasst hat: Steffen Popp, der wurde auch publiziert, und man kann vielleicht absehen, dass derzeit - aber es ist eine Momentaufnahme - in Berlin eine Generation Essay schreibender Autoren sich formiert, die wieder mehr an der Sprache als Material Interesse haben, die die Werkzeuge der Essayistik sehr ernst nehmen, die versuchen, das Ich vielleicht ein Stück wieder zurückzudrängen zugunsten einer Perspektivierung. Da kommen dann fast Figuren, Figuren tauchen auf. Man versucht, den Essay zu befreien aus Versuchen diskursiver Einhegung. Man möchte mit der Form spielerischer umgehen, man bezieht Anregungen aus der Popliteratur, versucht sozusagen Witz und auch dem Genre eine gewisse Chuzpe abzugewinnen. Das beobachte ich in Berlin momentan stärker als in Wien. Es kann aber auch ein Gruppenphänomen sein, das darf man nicht vergessen. Solche Strömungen binden sich häufig auch an Gruppierungen, die wiederum an Zeitschriften gebunden sind oder an Verlage gebunden sind. Und auch wenn das heute nicht mehr so stark ist wie in den 70er-Jahren, wie beispielsweise Ulrich Raulff das in seinem Buch "Wiedersehen mit den 70ern" beschrieben hat: Diese Distanzgesten, die Feindschaften, die auch gepflegt wurden zwischen den Gruppierungen. So ist das heute nicht mehr. Das, glaube ich, ist alles sehr viel konsensualer. Aber ich glaube, es gibt so zeitversetzte verschiedene Bewegungen des läuft parallel, aber vielleicht nicht immer zur selben Zeit am selben Ort.
"Wahnsinnig viele Frauen haben Essays geschrieben"
Pascal Fischer: Andrea Roedig, lassen Sie uns noch auf eine andere Kategorie schauen. Die Kategorie Geschlecht meine ich. Man könnte ja erst mal meinen: Na klar, ein Mann hat begonnen, Michel de Montaigne. Schreiben war lange Zeit ein männliches Privileg. Auf der anderen Seite ließe sich natürlich auch sagen: Gerade das Vorsichtige des Essays ist eher nicht dem Klischee von Männlichkeit zuzuordnen. Der Essay deklamiert nicht. Er macht kein Mansplaining, wie es neudeutsch heißt, sondern er legt sich eben erst einmal nicht fest. Er ist vorsichtig. Was beobachten Sie? Wie teilt sich die Welt auf ihn Essayisten und Essayistinnen? Oder gibt es da gar keinen Unterschied mehr?
Andrea Roedig: Also, ich wäre vorsichtig was männliches und weibliches Schreiben angeht. Ich glaube, das ist relativ schwierig oder man begibt sich da sehr stark auf Glatteis, wenn man sagt, es gibt eine männliche und eine weibliche Form. Aber natürlich waren zuerst die Essayisten Männer, und man muss sagen, der Essay kann natürlich extrem eitel sein. Er ist eben auch schon ein rechter Gockel. Das heißt: Also, wer gut schreiben kann, kann sich da auch wahnsinnig produzieren und Eitelkeit, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein nicht so gutes Kriterium für den Essay. Aber es gibt natürlich viele eitle Essays, und das kommt mir dann schon sehr gockelhaft vor. Wir haben festgestellt, dass es vor allem im 20. Jahrhundert ziemlich viele Beispiele für Frauen gibt, die schreiben und hatten uns dann zuerst gefragt im Heft: Gibt's eigentlich so eine Art Fräuleinwunder der Essayistik jetzt? Also es gibt eben Masha Gessen Carolin Emcke, Nina Pauer, Monika Rinck, Rachel Cusk, Sheila Heti... Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die plötzlich auftauchen mit Essays, aber auch das mit dem Fräuleinwunder ist natürlich sehr despektierlich. Und wenn man zurückguckt, gibt es natürlich auch Virginia Woolf, Mary McCarthy, Susan Sontag, John Didion. Ich würde eher sagen, man muss mal bitte sich in Erinnerung rufen, wie wahnsinnig viele Frauen eigentlich auch Essays geschrieben haben und jetzt vermehrt schreiben. Der Essay ist natürlich, auch wenn er jetzt, sagen wir nicht so wahnsinnig das Meinungsstück ist, ist natürlich trotzdem eine Haltungbezeigung. Vermutlich ist sehr zu wünschen, dass der auch sehr stark von den Frauen entdeckt wird als Form. Mir scheint das tatsächlich der Fall.
Andrea Zederbauer: Die gültige Formel, wenn ich das noch anfügen darf, hat auch dafür Virginia Woolf gefasst. Was braucht es für dieses Schreiben? "500 pounds a year and a room of one's own." Das würde heute unverändert zu unterstützen sein. 500 Pfund im Jahr sind, glaube ich, inflationsbereinigt und umgerechnet 35000 Euro und ein eigenes Zimmer. Und dann wird das schon was.
"Essays brauchen Anlässe"
Pascal Fischer: Im eigenen Zimmer sitzen ja im Augenblick sehr viele... Um den Rahmen zu schließen: In den Corona-Zeiten, in denen wir alle so ein bisschen zu Hause sitzen müssen, zwangsweise, könnte da der Essay nicht auch zu einer Kunstform - oder vielleicht sogar etwas höher gegriffen - zu einer Selbstpraxis werden, durch die jeder von uns ein jeder von uns ein wenig mehr nachdenkt über das, was sein Leben ausmacht? In Ihrem Heft denkt ja Franz Schuh so ein bisschen in eine Richtung: Der Essay als Praxis für Jedermann.
Andrea Roedig: Ich würde erst einmal sagen: Ja, zumindest braucht der Essay Zeit, und wenn wir davon mehr haben, was ich gar nicht so richtig beobachte, dann wäre es eine gute Zeit für die Essayistik. Gleichzeitig muss man aber auch sagen: Wir versuchen ja sehr oft auch Autoren und Autor*innen zu animieren, Essays zu schreiben. So eine Zeitschrift wie das "wespennest" gibt Anlässe, Essays überhaupt zu produzieren, was ich für extrem wichtig halte, wenn es uns nicht gäbe.... Oder auch Zadie Smith bedankt sich in ihrem Essayband dafür, dass es Anlässe gegeben hat, von "Harper's Bazaar" oder von dem "New Yorker", dass sie zu Essays angehalten wurde. Das heißt, es braucht Gefäße, und es braucht Anlässe, Essays zu schreiben und eben auch Zeitschriften, die das anfragen. Das ist das erste, und das zweite ist: Man müsste den Essay nochmal vom Besinnungsaufsatz abgrenzen. Einerseits vom wissenschaftlichen Aufsatz auf der einen Seite, aber auch vom Besinnungsaufsatz: "Ich setze mich jetzt hin und mache mir Gedanken". Gute Essayisten und Essayistinnen sind vor allem und vor allem große Leserinnen. Das heißt, was einen guten Essay ausmacht, ist tatsächlich auch etwas, dass man sich trotz der subjektiven Form, die der Essay hat, auf eine sehr große Tradition oder auf eine Tradition bezieht, auf andere bezieht, die im Hintergrund stehen. Und das scheint mir extrem wichtig zu sein. Ansonsten muss man natürlich sagen: Ja, schreibt Essays, auf jeden Fall!
"Das Essayschreiben braucht freies Denken"
Pascal Fischer: Frau Zederbauer, wäre das auch ein bisschen Ihr Votum? Die fünfhundert Pfund sollte es vielleicht in Form von Förderungen geben, dass zumindest die Essayisten ans Schreiben kommen?
Andrea Zederbauer: Zumindest, glaube ich, muss man darüber nachdenken, dass es noch nicht damit getan ist, wenn Preise gestiftet werden. Dem will ich überhaupt nicht entgegentreten. Die soll es natürlich geben. Aber mit einem Preis ist sozusagen noch nicht die Gelegenheit geschaffen, dass jemand auch ein, zwei Monate Zeit hat, in der er sich mit dem Broterwerb sonst nicht beschäftigen muss, um einen Essay zu schreiben. Denn diese Zeit braucht es. Und was das Essayschreiben in Zeiten der Pandemie anlangt: Ich würde ein wenig davor warnen, dass wir sozusagen alles durch die Brille dieses Virus betrachten. Denn in erster Linie braucht es schon freies Denken, die Möglichkeit, frei zu denken, also eine liberale Gesellschaft! Denn die Form kann historisch immer wieder auch unter Druck kommen, dass es Zeiten gibt, wo die Ambivalenz sozusagen nicht in Mode ist, einfach, weil der Druck sehr groß ist auf Intellektuelle, einzutreten für Anderes: Wenn jetzt offener Rassismus in einem Land herrscht, ein Staat korrupt ist, Menschenrechte mit Füßen getreten werden, die Gewaltenteilung sozusagen zur Disposition steht, dann kommt sehr schnell die Situation, wo man erwartet, eben nicht "Wir betrachten das zweifelnd", oder "Man kann das so oder so sehen" zu schreiben, sondern wir haben das im Gespräch mit Josef Haslinger, in diesem aktuellen Heft, in dieser Jubiläumsausgabe, dass man eben dazu angehalten wird, Kante zu zeigen, Position zu beziehen. Das ist tatsächlich etwas, was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir auf die Pandemie blicken, dass beispielsweise ein Blogger in Ungarn dann angehalten wird, weil er in seinem Blog oder in seinem Facebook-Post das Wort "Diktator" vorkommen lässt, am nächsten Tag in der Früh die ungarische Polizei vor der Tür steht und untersucht, ob das nicht ein Fall dieser neuen Gesetzgebung Viktor Orbáns ist. Das, glaube ich, sollte nicht ganz unter den Tisch fallen.
Pascal Fischer: Ein starkes Schlusswort. Andrea Roedig und Andrea Zederbauer, vielen Dank für das Gespräch. "Essayistik in der Krise. Eine Textgattung als Sanitäter." Das war heute unser Thema hier in "Essay und Diskurs". In der Technik in Wien saß René Kornfeld. Am Mikrofon hier verabschiedet sich Pascal Fischer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag!
Andrea Roedig, geboren 1962 in Düsseldorf, lebt seit 2007 als freie Publizistin in Wien. Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift "wespennest". Zuletzt erschienen: "Schluss mit dem Sex!" (Klever-Verlag 2019).
Andrea Zederbauer, geboren 1969, lebt in Wien, ist Mitherausgeberin der Zeitschrift "wespennest" und Übersetzerin aus dem Schwedischen.
