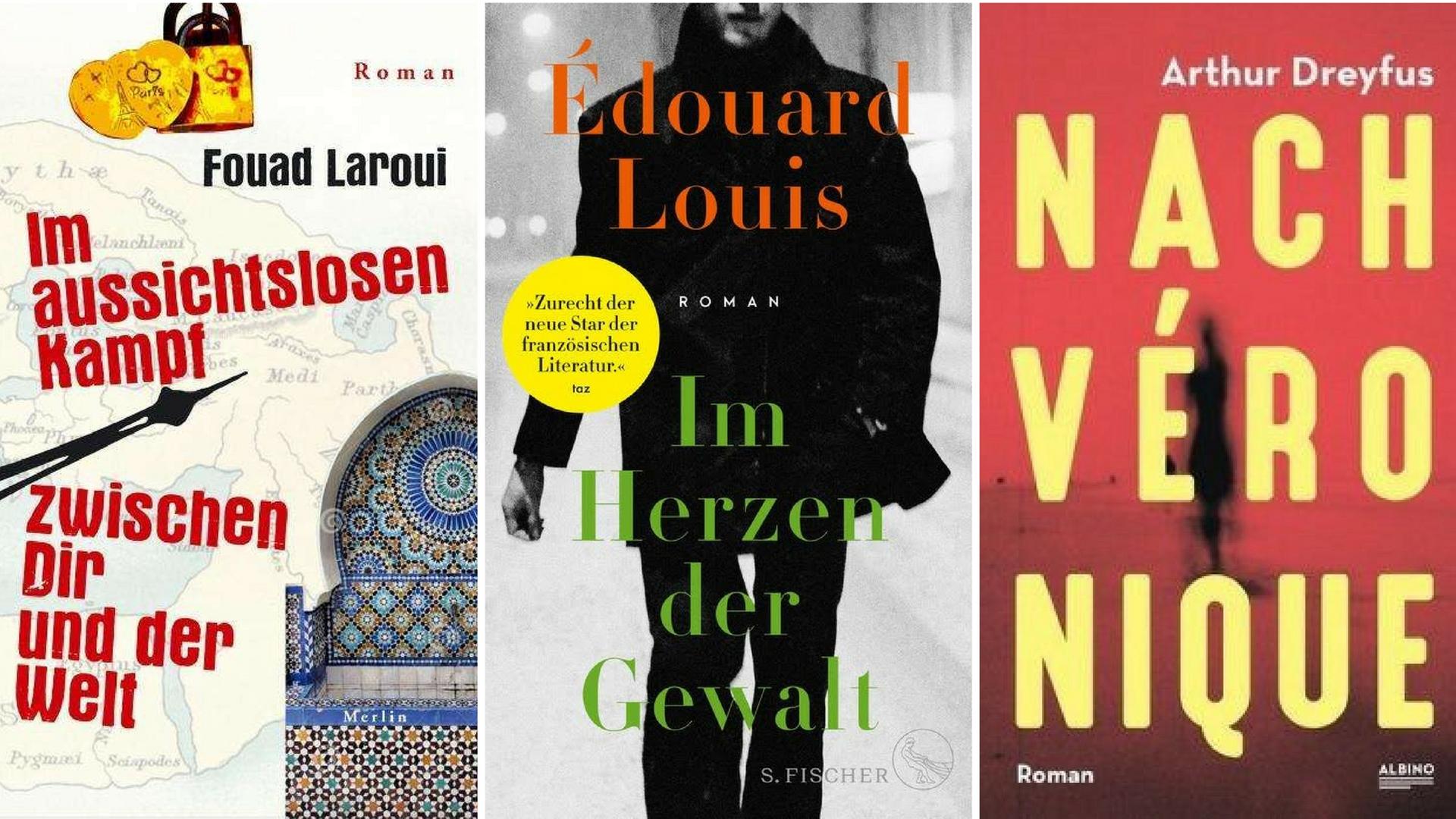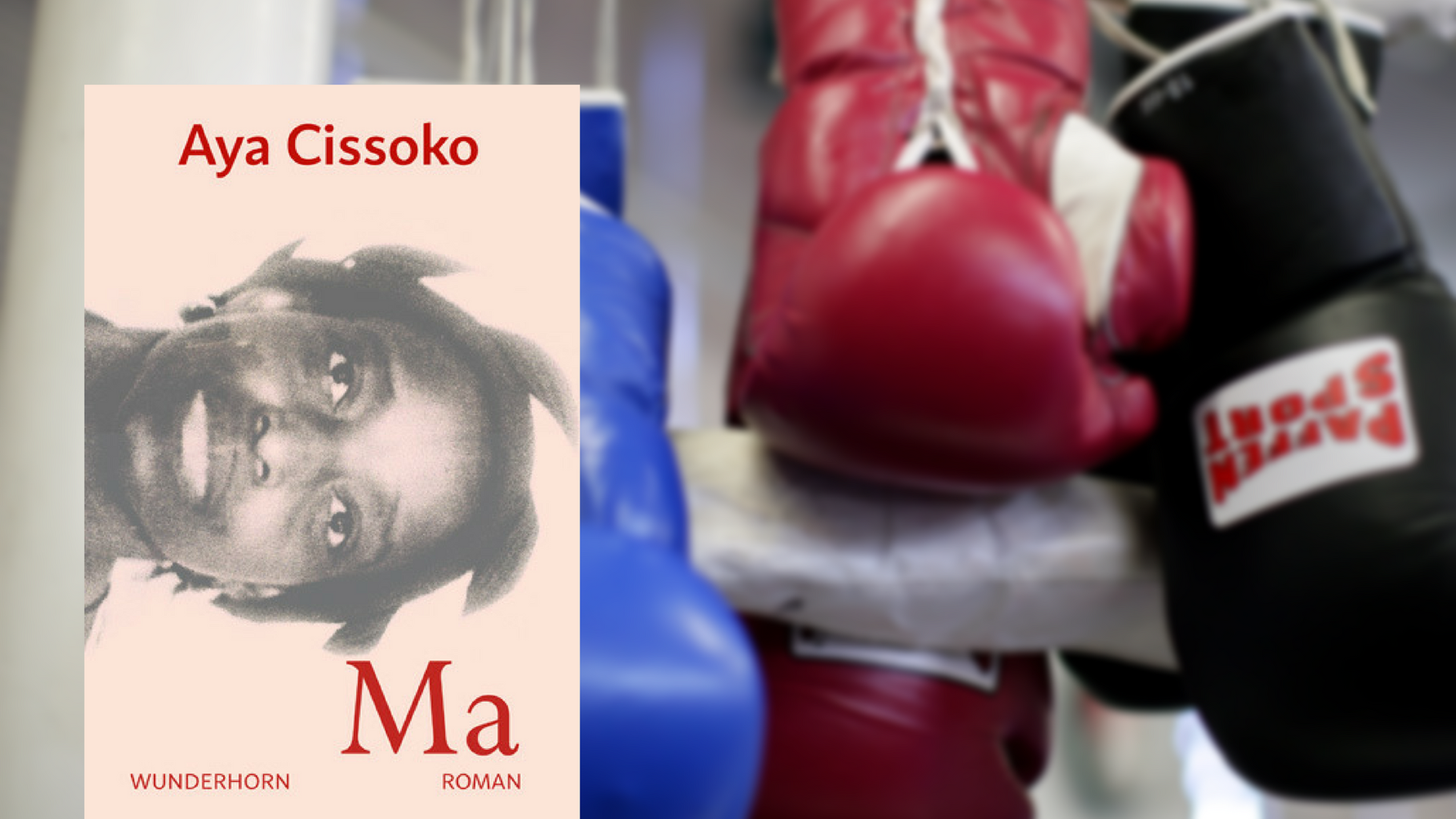"Frankfort en française - Frankfurt auf Französisch" - mit dieser Losung präsentiert sich Frankreich als Gast der Frankfurter Buchmesse. Gemeint ist damit aber genau genommen, dass sich nicht bloß ein Land, sondern ein Sprachraum vorstellt, der weit mehr umfasst als die Region zwischen Marseilles und Paris. Französischsprachige Literatur wird auch in Kanada, in der Karibik, in Belgien und in Afrika geschrieben. Die frankophonen Autoren, die Französisch häufig erst als zweite Sprache gelernt haben, bringen einen neuen Sound und andere Themen in die französischsprachige Literatur. Holger Heimann stellt vier dieser Schriftsteller und ihre Bücher vor. Er hat nicht nur mit ihnen, sondern auch mit dem Cheforganisator des Ehrengastes, Paul de Sinety, gesprochen.
"Frankreich war zum ersten Mal 1989 Gastland, einige Wochen vor dem Mauerfall. Seit 30 Jahren gibt es viele neue Ereignisse. Und wir haben die neue, frankophone Literatur in Frankreich entdeckt. Viele Schriftsteller aus Marokko, Burundi, der Karibik, Haiti, Asien Amerika sind in Frankreich neu. Ich wünsche mir, dass diese Schriftsteller in Deutschland besser bekannt werden."
Der Literaturwissenschaftler Paul de Sinety, der für die Organisation von "Frankfurt auf Französisch" zuständig ist, hat die Aufgabe, Werbung zu machen. Aber er hat Recht. Die französische Literatur verändert sich. Immer mehr Bücher stammen von Schriftstellern, die zwar Französisch schreiben, aber aus fernen Weltgegenden stammen. Sie erzählen andere Geschichten, von einem anderen Leben. Der Schriftsteller Alain Mabanckou, der 1966 im Kongo geboren wurde, ist Professor für frankophone Literatur in Los Angeles. Er ist einer der besten Kenner der französischsprachigen Literatur, die von afrikanischstämmigen Autoren verfasst wird. Dass deren Romane auf eine wachsende Neugier der Leser stoßen, ist für ihn leicht nachvollziehbar.
"Die Menschen schauen auf die frankophone Literatur, um Afrika und die afrikanische Kultur zu verstehen. Sie können nicht darauf warten, dass ein Franzose für eine Woche nach Afrika fährt, bloß um all seine Vorurteile bestätigt zu finden, Vorurteile, wie sie schon im 19. Jahrhundert verbreitet waren - dass Afrika keine Geschichte hat, wie Hegel meinte, und das Licht Europas braucht. Solche Positionen sind obsolet und nicht länger zu tolerieren. Wir müssen unsere Literatur in ganz Europa verbreiten, nicht nur in Frankreich. Ich möchte, dass meine Bücher auch in Schweden und in Deutschland Leser finden."
Literarische Rückkehr in den Kongo
Das geschieht bereits. Beim kleinen Münchner Liebeskind Verlag ist gerade das fünfte Buch von Alain Mabanckou erschienen. "Die Lichter von Pointe-Noire" erzählt von einer Reise in ein vertrautes und zugleich fremdes Land - die Republik Kongo. Nachdem er seine Heimat mit 23 Jahren verlassen hatte, um zum Studium nach Paris und von dort später weiter in die USA zu gehen, kehrte Mabanckou erst 2012 erstmals in das Land seiner Geburt zurück. Von dieser Rückkehr berichtet er nun.
"Ich habe begriffen, dass es wie ein Film war, der zu einer bestimmten Zeit angehalten wurde. Als ich jetzt zurückkam, begann er von neuem. Ich habe dieselben Straßen, dieselben Menschen gesehen, selbst wenn sie sich verändert haben. Ich fühlte mich nicht verloren. Aber die Leute schauten auf mich wie auf einen Fremden, einen Touristen aus dem Westen, wie auf jemanden, der nicht mehr zu dieser Welt gehört. Ich war kaum länger als eine Woche da und schon fragten mich alle, wann ich zurückkehre in die USA. Denn wenn man bleibt, folgern sie, dass man gescheitert ist."
Erzählen aus spöttischer Distanz
Alain Mabanckou will nicht im Kongo bleiben. Pointe-Noire hat sich verändert, es ist nicht mehr seine Stadt. Seine Streifzüge durch die Straßen, die ihm oftmals fremd erscheinen, setzen Erinnerungen frei, rufen Bilder seiner Kindheit wach. Seine Mutter, an die er immer wieder zurückdenkt, ist schon lange tot. Andere Menschen - Freunde und Verwandte, die er von früher kennt - trifft er hingegen wieder. Alle wollen Geld von ihm, da er jetzt in Nordamerika lebt, muss er reich sein, folgern sie. Alain Mabanckou porträtiert die zahlreichen Bittsteller mit spöttischer Distanz. Und er erzählt von dem zuweilen bizarr anmutenden, häufig durch kreative Improvisation bestimmten Lebensalltag in der Hafenstadt - voller Witz, aber auch mit viel Wärme. "Die Lichter von Pointe-Noire" ist so zu einer Art Biografie seiner Geburtsstadt geworden.
"Ich habe nichts erfunden. Lediglich die Art, wie ich versucht habe, meine Erfahrungen zu organisieren, damit sie gut zu lesen sind, weicht von der Wirklichkeit ab. Ich wollte, dass die Leute verstehen, was es heißt, ein Afrikaner zu sein, der seinen Kontinent verlassen hat, was es heißt, zurückzukommen nach 23 Jahren und als ein Fremder betrachtet zu werden. Alle Leute erwarten Hilfe von dir. Sie haben dich im Fernsehen gesehen und gehen davon aus, dass du erfolgreich bist und ihnen nichts abschlagen kannst. Es war für mich eine große Erfahrung, das aufzuschreiben, von realen, authentischen Menschen zu erzählen. Meine Arbeit als Schriftsteller bestand darin festzulegen, welchen Weg die Geschichte nimmt, wie ich die Poesie meines Landes verbreite."

Mabanckou schreibt so, als würde er einem Freund eine Geschichte erzählen. Die orale Tradition, aus der er kommt, spiegelt sich in allen seinen Büchern wieder. Das afrikanische Erbe ist in der Melodie, dem Rhythmus seiner Literatur präsent. Der Autor sagt von sich selbst: Ich bin Kongolese, Franzose wurde ich durch die Zuerkennung der Staatsbürgerschaft. Ursprünglich wollte er nach dem Studium zurückkehren in sein Geburtsland, doch ein Bürgerkrieg hielt ihn davon ab. Die Erfahrung des Exils und der Fremde hat er nicht zu seinem bleibenden Hauptthema gemacht. Es wurde für ihn vielmehr zu einer Art Mission, vom Leben auf dem afrikanischen Kontinent zu erzählen.
"Wenn man genau hinschaut, wird klar, dass Literatur schon immer von Heimatverlust erzählt. Ich habe Victor Hugo und Charles Baudelaire sowie eine ganze Reihe von lateinamerikanischen und kubanischen Autoren gelesen - sie alle schreiben darüber. Was viele frankophone Autoren mit afrikanischen Wurzeln vielleicht in besonderer Weise originell und zeitgemäß sein lässt, ist die Tatsache, dass Afrika noch immer ein unbekannter Erdteil ist. Die Leute wollen wissen: Warum gibt es so viele Bürgerkriege und Diktaturen? Wie konnte es zum Genozid in Ruanda kommen? Afrika ist ein Ort, wo sich womöglich viele Probleme unserer Zeit lokalisieren lassen."
Von Haiti nach Montreal
Literatur als Mittel der Aufklärung über einen fernen, fremden Kontinent - mag sein. Aber es gibt auch die Romane, die vom Ankommen in einem neuen Leben erzählen.
Dany Laferrière, der in Frankreich längst ein Star ist, hat seine Heimat Haiti mit 23 Jahren verlassen. 1976 war das, auf dem Höhepunkt der Duvalier-Diktatur. Laferrière arbeitete als Journalist, und es genügte, die Wahrheit zu schreiben, um auf die schwarze Liste des Regimes zu geraten. Einige Reporter wurden eingesperrt, ein Freund hingerichtet. Der Autor berichtet davon im Vorwort zu seinem jetzt erstmals auf Deutsch veröffentlichten Debütroman "Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne zu ermüden". Die Auswanderung nach Montreal war mithin eine Flucht. Aber Dany Laferrière hat sich nie als Flüchtling betrachtet und wollte nie als Exil-Schriftsteller gelten. Er ist strikt dagegen, seine haitianische Herkunft als etwas Besonderes ins Spiel zu bringen.
"Ich finde mich in Fragen nach Herkunft und Sprache nicht wieder. Für mich ist Identität nichts, was man einfordern sollte. Identität ist wie ein Fahrrad. Wenn man Fahrrad fährt, dann schaut man nicht auf die Räder, man schaut zum Horizont. Ich habe keine nationalistische Sicht auf die Literatur. Ich bin ein Schriftsteller und verfasse Bücher, aber ich muss darin nicht zum Ausdruck bringen, dass ich Haitianer bin."
Kein Blick zurück – es zählt das neue Leben
So spielt denn auch Haiti in seinem Debüt keine Rolle, die Diktatur bleibt ausgesperrt. Was zählt, ist das neue Leben, nicht das alte. Dieser Autor gibt sich von Beginn an nicht der Vergangenheit und der Trauer hin, sondern dem Neuen, der Gegenwart. Und ist es nicht fordernd und aufregend zugleich – das Leben in der kanadischen Metropole für einen Neuankömmling in den 70er Jahren? Verlangt es nicht, sich ganz darauf einzulassen?
"Ich wollte als Schriftsteller über den Ort schreiben, wo ich lebe. Montreal ist eine große, nordamerikanische Stadt mit einem ganz eigenen Rhythmus. Diesen Rhythmus, die Bewegung wollte ich einfangen. Ich glaube, dass sich heutige Leser nicht für nostalgische Autoren interessieren. Und die Leser sind für mich das wichtigste. Meine Leser lebten in Montreal, deshalb wollte ich davon erzählen, wie ich auf diese Stadt schaue."
Dany Laferrière wird zunächst Fabrikarbeiter. Acht Jahre verdient er so sein Geld. Es ist sein Weg, Amerika zu erobern, er lernt es von unten kennen. Die Erfahrungen, die er gemacht hat, sind wichtig für das Buch. Doch Laferrière erzählt keine Leidensgeschichte, sondern von einem großen Behauptungswillen. "Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne zu ermüden" ist ein Roman rund um zwei mittellose schwarze Migranten. Der Ich-Erzähler, in dem sich Dany Laferrière selbst porträtiert hat, besitzt wenig mehr als seine Träume von einer Schriftstellerkarriere und eine alte Remington. Auf der Schreibmaschine tippt er an seinem ersten Roman, in dem er festhält, was er und sein Freund Bouba miteinander erleben. Dieser hört am liebten Jazz und zitiert wechselweise Freud und aus dem Koran. Das schräge Duo haust in einer ärmlichen, immer unaufgeräumten Wohnung. Ist es die Exotik des Anderen, der Ruch des Unerlaubten, die Lust am Abenteuer - die so anziehend wirken? Die beiden lässigen Habenichtse werden jedenfalls von einer ganzen Schar weißer, gutbetuchter Bürgerstöchter umschwärmt und heiß begehrt. Mit seiner Mischung aus Leidenschaft und Coolness machte das 1985 im Original erschienene Buch den Autor über Nacht berühmt.

"Während des Schreibens wusste ich bereits, dass die Kritiker sagen würden, dass es ein neuartiges Buch, ein neuer Stil ist. Es ist die Geschichte eines Migranten, der nicht von seinem Herkunftsland erzählt. Es geht um Sex, Sex zwischen Menschen mit verschiedenen Hautfarben. In Nordamerika birgt das Zündstoff. Das Buch hatte alle Bestandteile, die für einen Erfolg nötig waren - Sinnlichkeit, Sex, Jazz, Literatur. Alles war sinnlich, körperlich und konkret."
Der Erfolg habe sein Leben nicht verändert, sondern es vielmehr enthüllt, sagt Dany Laferrière. Das ist ein schöner, selbstbewusster Satz eines Autors, der 32 Bücher verfasst hat und Mitglied der altwehrwürdigen Académie française ist.
Flucht aus dem Iran nach Paris
Ob die Debütromane zweier Frauen eine ähnliche Wirkung entfalten können, bleibt bleibt abzuwarten. Die im Iran geborene Négar Djavadi und die afrikanischstämmige Aya Cissoko erzählen jedenfalls in ihren Büchern gleichsam von schwierigen Migrantenbiografien. Ihr Montreal heißt Paris.
Négar Djavadi war elf Jahre alt als sie zu Pferd mit ihrer Mutter und den Schwestern über Kurdistan vor den Folgen der iranischen Revolution floh. Ihr Vater war ein bekannter Intellektueller. Er musste das Land schon vorher verlassen, um seiner Hinrichtung zu entgehen. In Frankreich traf die Familie 1981 wieder zusammen.
"Als wir nach Paris kamen, lebten hier nicht viele Iraner, meine Eltern waren sehr einsam. Aber für mich war es nicht schwierig. Im Iran zu leben, bedeutete kurz nach der Revolution, dass man von einem Tag auf den anderen tot sein konnte. Es war sehr beängstigend. Mein Vater lebte nicht mehr bei uns. Meine Mutter war allein. Meinen Eltern drohte die Verhaftung. Dennoch: Den Iran zu verlassen war gut für uns Kinder, nicht für unsere Eltern."
Bildreiche Beschreibungen des Alltags
Davon erzählt Négar Djavadi, die eigentlich als Drehbuchautorin und Regisseurin arbeitet, in ihrem autobiographischen Debütroman "Desorientale". Vor allem die Mutter der Ich-Erzählerin Kimiâ fühlt sich fremd in Paris. Während sich das Mädchen rasch dem neuen Alltag verschreibt, träumt ihre Mutter vom früheren Leben im Iran. Doch auch Kimiâ, die versucht, die Vergangenheit auf Distanz zu halten, wird von eben dieser bald eingeholt. Djavadi schildert in bildreichen Passagen einen durch enge Familienbande geprägten Alltag im Iran vor und während der Revolution. In Paris hingegen löst sich die Familie auf. In "Desorientale" wird ein schwieriger Aufbruch nachgezeichnet. Zugleich aber gab die Arbeit an dem Buch der Autorin die Gelegenheit, gedanklich noch einmal in das Land ihrer Herkunft zurückzukehren.
"Ich habe nur meine Erinnerungen. Meine Familie lebt in der ganzen Welt verstreut. In den Iran können wir nicht zurück, wahrscheinlich würden wir dort verhaftet werden. Daher lebe ich in meinen Erinnerungen. Der Iran ist nur in meinem Kopf. Ich habe das Land mit elf Jahren verlassen. Alles wurde Fiktion. Ich glaube, dass ich eine sehr spezielle Beziehung zu dem Land habe. Ich weiß manchmal selbst nicht, ob die Dinge, die ich vermeintlich erinnere, wirklich so geschehen sind oder nicht. Alles liegt sehr lange zurück. Es gibt nichts, was mich an die Revolutionszeit und an meine Großeltern erinnern könnte. Es existieren keine Fotos, keine Briefe."
Der Anfang eines neuen Lebens
Manche Erinnerungen brennen sich für immer in das Gedächtnis ein. So war es bei Aya Cissoko, die 1978 in Paris geboren wurde. Die Tochter malischer Einwanderer war sieben Jahre alt, als die Unterkunft der Familie plötzlich in Flammen stand und das Mädchen ihren Vater und ihre kleine Schwester verlor. Aya Cissoko hat bereits in ihrer Autobiographie "Würde" von dem vermutlich von Rechtsradikalen verübten Brandanschlag erzählt. In ihrem abermals entlang eigener Erfahrungen geschriebenen Debütroman "Ma", mit dem sie ihrer Mutter ein Denkmal setzt, berichtet sie nun nur knapp von den traumatischen Ereignissen. Sie wird diesen Tag im Herbst 1986 nie vergessen.
"Es war der Anfang eines neuen Lebens. Plötzlich wurde meine Mutter zum Familienoberhaupt. Doch sie hatte keinerlei Erfahrung damit, wie sie die Familie durchbringen sollte. Zuvor musste sie sich nur um den Haushalt kümmern. Jetzt ging es darum, auch Geld zu verdienen. So wurde sie unabhängig. Sie hat mir diesen Geschmack der Unabhängigkeit vermittelt. Und sie hat anderen Frauen vorgelebt, dass es Alternativen zur üblichen Rollenverteilung in afrikanischen Familien gibt. Meine Mutter machte ihren Job schlichtweg besser als viele Männer."
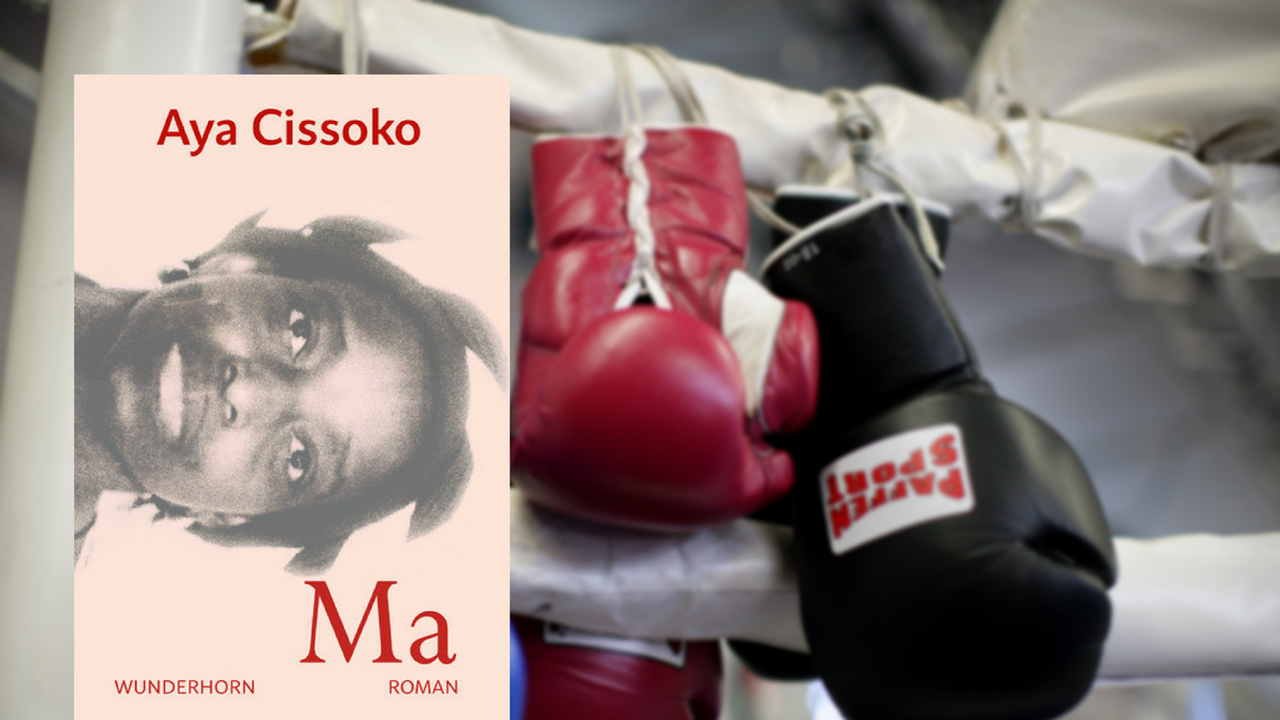
Aya Cissokos in einfachen Worten erzählter Roman, der vor allem durch die Wucht der Geschichte besticht, ist ein nachträgliches Geschenk an ihre 2014 verstorbene Mutter. Die Frau, die zeitlebens Analphabetin geblieben ist, ließ sich nie unterkriegen. "Ma ist meine Heldin geworden", schreibt Aya Cissoko. "Sie hat gelitten, ohne zu verbittern." Das gilt auch für Aya Cissoko selbst. Als junges Mädchen sucht sie verzweifelt ihren Platz. Sie rebelliert gegen einengende afrikanische Traditionen ebenso wie gegen eine rigide französische Assimilationspolitik. In der Schule wird dem begabten, aber aufmüpfigen Mädchen "inakzeptables Benehmen" attestiert. Doch da hat sie längst ihren eigenen Weg gefunden. Schon als Teenager steigt sie in den Ring.
"Boxen war für mich eine Möglichkeit, mich zu behaupten, stärker zu werden. Es wurde zu einem Weg, mein Leben, meinen Körper zu kontrollieren. Das war unglaublich wichtig."
Zusammenspiel verschiedener Traditionen
Aya Cissoko ist eine exzellente Kämpferin, behender, stärker, aggressiver als ihre Gegnerinnen. Zweimal gewinnt sie die Weltmeisterschaften im Kickboxen, 2006 holt sie sich auch den Weltmeistertitel im Amateurboxen. Dann, bei einem Grand Slam, endet ihre sportliche Karriere jäh: Halswirbelbruch. Die Fraktur wird nachlässig behandelt, bei der Operation das Rückenmark verletzt. Als Aya Cissoko aus der Narkose aufwacht, ist sie halbseitig gelähmt. Doch wenn sie eines gelernt hat, dann: nie aufzugeben. So kommt sie wieder auf die Beine, legt die Boxhandschuhe zur Seite und studiert Politikwissenschaften an einer Pariser Elitehochschule. Eine Narbe am Hals erinnert noch an die schwere Verletzung. Wie eine Verliererin wirkt die junge, grazile Frau jedoch nicht. Ganz im Gegenteil, sie strahlt eine selbstbewusste Gelassenheit aus.
"Als ich jung war, war das Leben manchmal sehr schwierig. Manche Leute bedauern mich, weil ich so viel Tragik erfahren habe. Aber ich empfinde das nicht so - und das habe ich vor allem meiner Erziehung zu verdanken. Alles, was mir widerfahren ist, hat mich stärker gemacht. Meine Identität speist sich aus einem Zusammenspiel verschiedener Erfahrungen und Traditionen. Ich begreife das als einen großen Reichtum."
Das Schreiben ist für Aya Cissoko auch der Versuch, diesen Reichtum in Worte zu fassen. Das gilt ganz ähnlich auch für Négar Djavadi, Dany Laferrière und Alain Mabanckou - so verschieden ihre Biografien auch sein mögen. Kein Zweifel, Autoren wie sie bringen mit ihren Büchern mehr Welt und einen anderen Ton in die französischsprachige Literatur. Diese wird vielfältiger und bunter.
Aya Cissoko (Aja Sisso’ko): "Ma".
Übersetzt von Beate Thill
Verlag Das Wunderhorn, 180 Seiten, 24,80 Euro
Übersetzt von Beate Thill
Verlag Das Wunderhorn, 180 Seiten, 24,80 Euro
Négar Djavadi: (Négar Dschahwadi)"Desorientale".
Übersetzt von Michaela Meßner
C.H. Beck Verlag, 400 Seiten, 22 Euro
Übersetzt von Michaela Meßner
C.H. Beck Verlag, 400 Seiten, 22 Euro
Dany Laferrière: (Danni Laferjer) "Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne zu ermüden".
Übersetzt von Beate Thill,
Verlag Das Wunderhorn, 142 Seiten, 19,80 Euro
Übersetzt von Beate Thill,
Verlag Das Wunderhorn, 142 Seiten, 19,80 Euro
Alain Mabanckou: (A’lä Mabba’ku) "Die Lichter von Pointe-Noire".
Übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller
Liebeskind Verlag, 272 Seiten, 20 Euro
Übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller
Liebeskind Verlag, 272 Seiten, 20 Euro