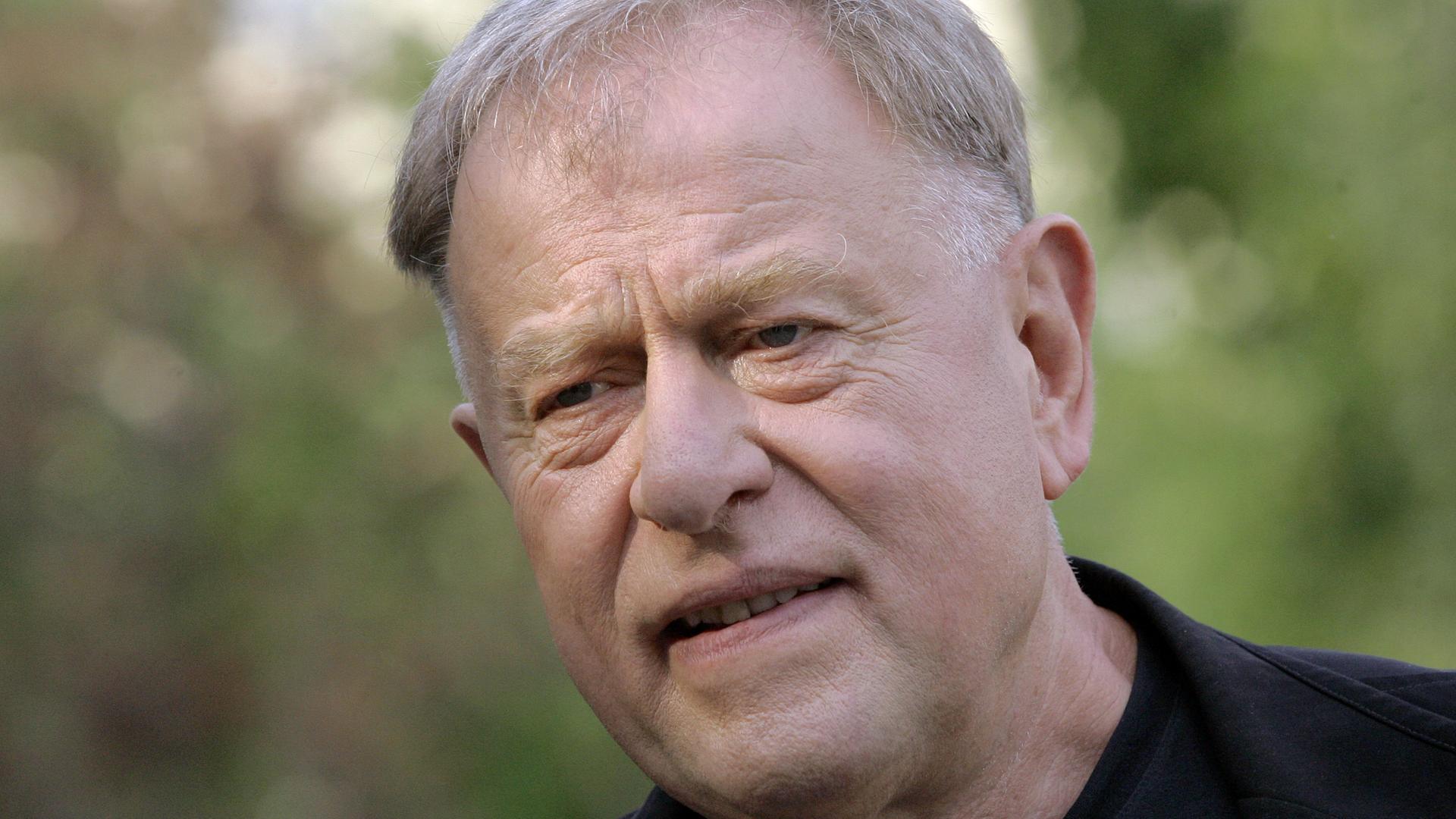
Staunen macht ja immer wieder die Selbstverständlichkeit, mit der der Mittsiebziger Peymann sich selbst und sein Theater zum Zentrum des Politischen auf Deutschlands Bühnenlandschaft erklärt – obwohl die Inszenierungen am "Berliner Ensemble” durchweg eher nicht danach aussehen … Am Ende der Pause gestern Abend allerdings bricht tatsächlich ein kleiner Aufstand los – das Publikum protestiert. Nicht in Massen und auch nicht gegen die Aufführung; nein – eine überschaubare Gruppe junger Leute im ersten Rang stimmt (wie kurz zuvor das Ensemble auf der Bühne) die "Marseillaise” an und protestiert dann unter Verwendung von Zitaten aus Büchners Text gegen prekäre Arbeitsverhältnisse im Theater selber, wo (bekanntermaßen und wie im verteilten Flugblatt zu lesen) Niedriglöhne gezahlt würden und es im übrigen auch keinen Tarifvertrag gebe. Die Protestierer kritisieren aber letztlich auch Peymanns chronisch große Klappe, wenn's um politische Fragen geht – und die kleine Münze, das kleine Karo, das ansonsten herrscht am privat geführten "Berliner Ensemble”.
Und eine Ahnung davon kommt auf, dass es doch um etwas gehen könnte in einer wirklich zeitgenössischen Inszenierung von "Dantons Tod” - und sei es um Tarifverträge …
Claus Peymanns Vom-Blatt-Inszenierung, im Programmheft wie immer philologisch brav und ordentlich dokumentiert, Strich für Strich, kommt allerdings auch diesmal wieder ohne jedes erkennbare Motiv aus. Die Revolutionen des vorigen Jahres, der Aufstand der arabischen Länder, die amerikanisch-europäischen Revolten unter dem "Occupy”-Motto? Nichts davon, nichts darüber, auch kein Hinweis auf mögliche Zusammenhänge zwischen Geschichte und Gegenwart – und selbst der wohlwollende Einwand, das Publikum werde die Hin-und-Her-Bezüglichkeiten bestimmt schon selber herausklamüsern, zieht hier nicht: Denn die Spielweise, die Peymann dem Ensemble verordnet hat, steht jeder Zeitgenossenschaft dezidiert im Wege. In der Chronik jener Revolution, die im Frankreich von vor zwanzig und zwei Jahrzehnten gnadenlos blutig hinweg schritt über die Helden ihrer frühen Jahre und letztlich keinen der Protagonisten des Aufstands verschonte, bis da wieder ein Kaiser herrschte, regiert bei Claus Peymann eine außerordentlich sonderbare Auffassung von szenischem Realismus – sie scheint das Publikum mit zeitgenössischen Details zu überschütten, verhindert aber gerade auf diese Weise jeden Gedanken, der von heute wäre.
Die Methode nutzt Requisiten und Effekte. Echte Handschellen gibt's, allerdings wie aus dem Spielzeugladen; auch echtes elektrisches Licht im Gefängnis der Revolution. Dort treten die versammelten Gefangenen, Danton und seine Freunde, den Gang zur Guillotine oben rum schon recht zerlumpt, doch unten rum in schwarzen Lackschuhen an. Und wenn mal ein Fenster eingeschlagen werden muss, dann klirrt es demonstrativ und detailliert aus der Ton-Abteilung. Die in jeder Inszenierung außerordentlich komplizierten Massenszenen in Konvent und Tribunal schließlich sehen schon sehr verdächtig nach Muppet-Show aus: mit applaudierenden weißen Handschuhen, die keinen Ton verlauten lassen. Was soll das alles sein? Abstraktion? Poetischer Realismus? Denn zugleich wird ja derart schlicht und geradeaus und unanimiert gesprochen, als sei das Ganze eine Schüler-Aufführung – wie lässt sich da die ziemlich fundamentale liberale Vision ernst nehmen, die auch bei Büchner im Rollentext des recht hallodrihaften Lebemanns Lacroix zu finden ist?
Durch all die vielen Kleinigkeiten, in denen sich die Inszenierung verstrickt (auf Karl-Ernst Herrmanns variabler Bühnen, die unentwegt damit beschäftigt ist, Büchners filmschnittschnelle Wechsel der Spielräume zu bewältigen), scheint nicht die Spur eines eigenen Gedankens hindurch; und eben erst recht nicht das Motiv, das Büchners Text für Peymann und fürs Publikum wichtig werden lassen könnte. So sehen wir eine zugleich recht schlicht und sehr angestrengt einhertappende Inszenierung eines Textes, der halt mal wieder "dran” war. Manche Szene aus Büchners Original behält Peymann bei, weil er sie wohl für unterhaltsam hält, die betrunkenen Henker nach getaner Arbeit gegen Ende zum Beispiel, sonst meist gestrichen; dafür eliminiert er unsinnigerweise den ziemlich prächtigen Religions- und Gottes-Diskurs um den englischen Denker Thomas Payne, der bei Büchner auch im Gefängnis der Revolution sitzt. Vielleicht fehlte dafür die Besetzung.
Ohnehin bleibt das Haus-Ensemble durchweg schwach an Profil, selbst die großen Wortgefechte sind bei Veit Schuberts Robespierre, Georg Brandhorsts Danton und dem eher clownesken Saint-Just von Giorgios Tsivanoglu nichts als nur laut. Angela Winkler fällt erst recht nicht weiter auf in einem Nebenröllchen dieses Männerstücks – aber was fiel schon auf bei diesem durchweg faden Auftakt fürs neue Berliner Theaterjahr?
Und eine Ahnung davon kommt auf, dass es doch um etwas gehen könnte in einer wirklich zeitgenössischen Inszenierung von "Dantons Tod” - und sei es um Tarifverträge …
Claus Peymanns Vom-Blatt-Inszenierung, im Programmheft wie immer philologisch brav und ordentlich dokumentiert, Strich für Strich, kommt allerdings auch diesmal wieder ohne jedes erkennbare Motiv aus. Die Revolutionen des vorigen Jahres, der Aufstand der arabischen Länder, die amerikanisch-europäischen Revolten unter dem "Occupy”-Motto? Nichts davon, nichts darüber, auch kein Hinweis auf mögliche Zusammenhänge zwischen Geschichte und Gegenwart – und selbst der wohlwollende Einwand, das Publikum werde die Hin-und-Her-Bezüglichkeiten bestimmt schon selber herausklamüsern, zieht hier nicht: Denn die Spielweise, die Peymann dem Ensemble verordnet hat, steht jeder Zeitgenossenschaft dezidiert im Wege. In der Chronik jener Revolution, die im Frankreich von vor zwanzig und zwei Jahrzehnten gnadenlos blutig hinweg schritt über die Helden ihrer frühen Jahre und letztlich keinen der Protagonisten des Aufstands verschonte, bis da wieder ein Kaiser herrschte, regiert bei Claus Peymann eine außerordentlich sonderbare Auffassung von szenischem Realismus – sie scheint das Publikum mit zeitgenössischen Details zu überschütten, verhindert aber gerade auf diese Weise jeden Gedanken, der von heute wäre.
Die Methode nutzt Requisiten und Effekte. Echte Handschellen gibt's, allerdings wie aus dem Spielzeugladen; auch echtes elektrisches Licht im Gefängnis der Revolution. Dort treten die versammelten Gefangenen, Danton und seine Freunde, den Gang zur Guillotine oben rum schon recht zerlumpt, doch unten rum in schwarzen Lackschuhen an. Und wenn mal ein Fenster eingeschlagen werden muss, dann klirrt es demonstrativ und detailliert aus der Ton-Abteilung. Die in jeder Inszenierung außerordentlich komplizierten Massenszenen in Konvent und Tribunal schließlich sehen schon sehr verdächtig nach Muppet-Show aus: mit applaudierenden weißen Handschuhen, die keinen Ton verlauten lassen. Was soll das alles sein? Abstraktion? Poetischer Realismus? Denn zugleich wird ja derart schlicht und geradeaus und unanimiert gesprochen, als sei das Ganze eine Schüler-Aufführung – wie lässt sich da die ziemlich fundamentale liberale Vision ernst nehmen, die auch bei Büchner im Rollentext des recht hallodrihaften Lebemanns Lacroix zu finden ist?
Durch all die vielen Kleinigkeiten, in denen sich die Inszenierung verstrickt (auf Karl-Ernst Herrmanns variabler Bühnen, die unentwegt damit beschäftigt ist, Büchners filmschnittschnelle Wechsel der Spielräume zu bewältigen), scheint nicht die Spur eines eigenen Gedankens hindurch; und eben erst recht nicht das Motiv, das Büchners Text für Peymann und fürs Publikum wichtig werden lassen könnte. So sehen wir eine zugleich recht schlicht und sehr angestrengt einhertappende Inszenierung eines Textes, der halt mal wieder "dran” war. Manche Szene aus Büchners Original behält Peymann bei, weil er sie wohl für unterhaltsam hält, die betrunkenen Henker nach getaner Arbeit gegen Ende zum Beispiel, sonst meist gestrichen; dafür eliminiert er unsinnigerweise den ziemlich prächtigen Religions- und Gottes-Diskurs um den englischen Denker Thomas Payne, der bei Büchner auch im Gefängnis der Revolution sitzt. Vielleicht fehlte dafür die Besetzung.
Ohnehin bleibt das Haus-Ensemble durchweg schwach an Profil, selbst die großen Wortgefechte sind bei Veit Schuberts Robespierre, Georg Brandhorsts Danton und dem eher clownesken Saint-Just von Giorgios Tsivanoglu nichts als nur laut. Angela Winkler fällt erst recht nicht weiter auf in einem Nebenröllchen dieses Männerstücks – aber was fiel schon auf bei diesem durchweg faden Auftakt fürs neue Berliner Theaterjahr?