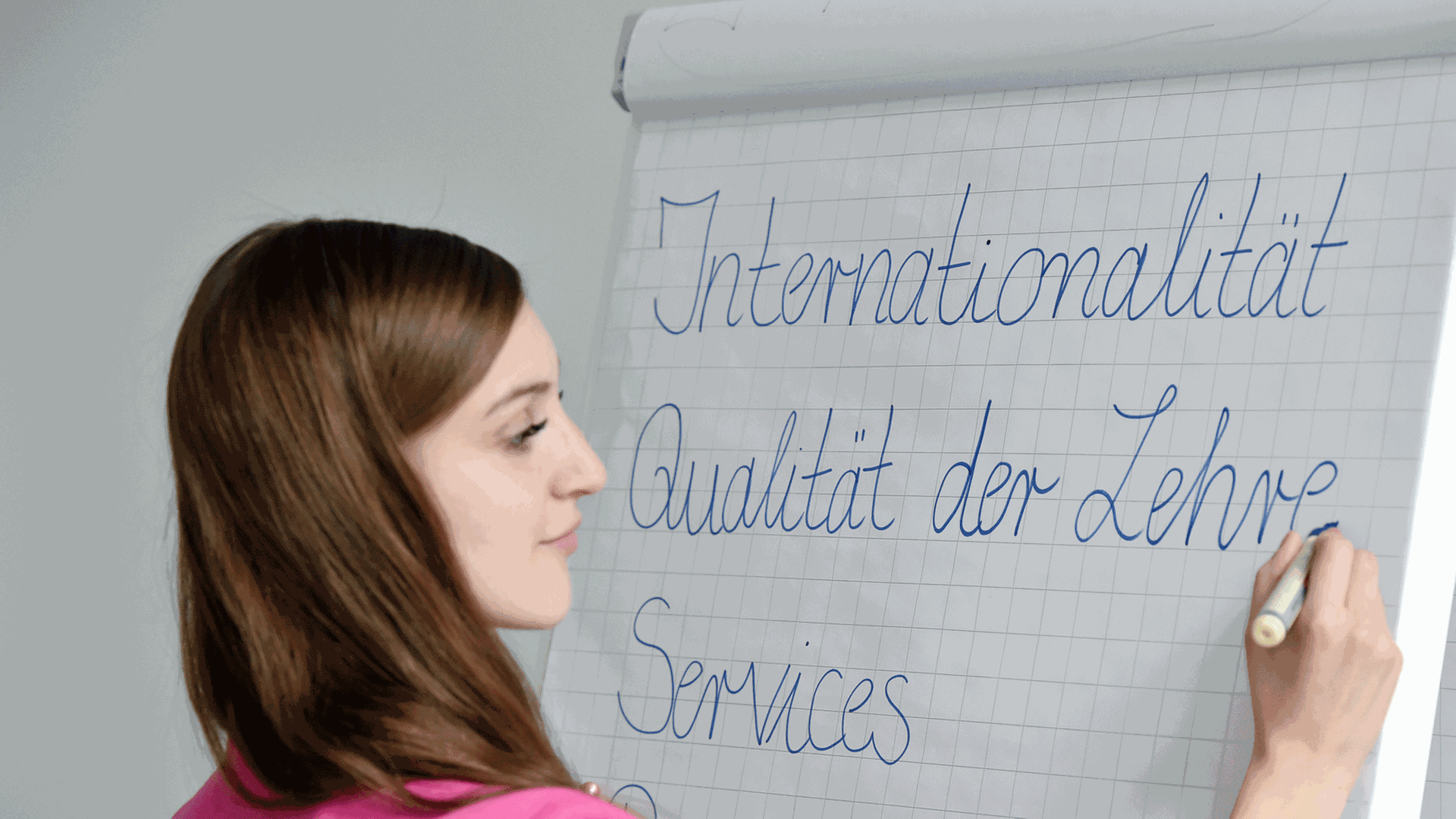
Vor 15 Jahren verabredeten 29 europäische Bildungsminister: Wir wollen einen einheitlichen europäischen Hochschulraum. Drei Ziele wurden dafür definiert. Erstens: europaweit soll es vergleichbare Studienbedingungen geben. Zweitens: Die Studieninhalte sollen sich stärker am Arbeitsmarkt orientieren. Und drittens: Das alles soll zu einer größeren Mobilität für Studierende und Forscher führen. Annette Schavan, deutsche Bildungsministern zwischen 2005 und 2013, beschrieb das mit Blick auf den Humanisten Erasmus von Rotterdam so:
"Geboren in Rotterdam, Studien in Paris, Doktor-Degree in Turin, Lecturer in Cambridge, Forscher in Freiburg und der Ruhestand in Basel. Das war ein Leben zwischen 1466 und 1536, und letztlich muss so etwas im 21. Jahrhundert wieder möglich sein in Europa."
Ein ambitioniertes Reformprojekt – aber war es auch erfolgreich? Ziel eins – die europaweit vergleichbaren Studienbedingungen – war eine große Herausforderung, wurde aber weitgehend eingelöst, sagt Franz Bosbach, Prorektor für Lehre und Studium an der Uni Duisburg-Essen.
"Wir mussten ja ein völlig neues System in unsere Studienangebote hineinbringen. Ich glaube, die Universitäten haben gezeigt, dass sie leistungsfähig sind, und dass sie solche Systeme tatsächlich adaptieren können. Aus der Perspektive des Erfolges muss ich sagen: Wir sind auf dem Wege zu einem guten, geordneten System. Es hat sich noch nicht alles zurecht gerüttelt. Wir sehen, dass es Nachsteuerungsbedarfe gibt."
"Wir mussten ja ein völlig neues System in unsere Studienangebote hineinbringen. Ich glaube, die Universitäten haben gezeigt, dass sie leistungsfähig sind, und dass sie solche Systeme tatsächlich adaptieren können. Aus der Perspektive des Erfolges muss ich sagen: Wir sind auf dem Wege zu einem guten, geordneten System. Es hat sich noch nicht alles zurecht gerüttelt. Wir sehen, dass es Nachsteuerungsbedarfe gibt."
Ziel zwei – die stärkere Arbeitsmarktorientierung – sei ebenfalls umgesetzt, sagt Wolfgang Lieb. Er hatte vor 15 Jahren als Staatssekretär im NRW-Wissenschaftsministerium den Bologna-Prozess begeistert vorangetrieben. Zufrieden ist Wolfgang Lieb trotzdem nicht – denn die Ausrichtung der Fächer auf den Arbeitsmarkt, neudeutsch: Employability, sei fatal:
"Ich war ein überzeugter Vertreter des Bologna-Prozesses, weil ich geglaubt habe, dass die Hochschulen eine europäische Identität stiften können, wie sie's im Verlauf der Geschichte ja immer getan haben. Die bildungspolitische Seite des Bologna-Prozesses ist an die Wand gedrängt worden zugunsten der wirtschaftspolitischen Flanke. Und dadurch sind die Hochschulen sehr stark in den Griff ökonomischen Denkens geraten."
Bleibt Ziel drei: die größere Mobilität. Das hat nur teilweise geklappt, findet Franz Bosbach von der Uni Duisburg-Essen.
"Wir haben eine hohe Rate von "incoming students" in Duisburg-Essen, die nicht nur aus dem Bologna-Raum kommen, sodass wir da ganz zufrieden sind. Wir sind nicht zufrieden mit der Outgoing-Quote, das liegt aber an spezifischen Voraussetzungen unserer Studierenden, die wir besonders motivieren müssen, ein Auslandssemester wahrzunehmen oder einen Auslandsaufenthalt oder ein Praktikum im Ausland."
Gerade bei deutschen Studierenden gibt es noch zu viel Zurückhaltung, was den Weg ins Ausland betrifft. Aber auch da sei man auf einem guten Weg – zumal aus den 29 Erstunterzeichnern mittlerweile 47 europäische Staaten geworden sind.
Gerade bei deutschen Studierenden gibt es noch zu viel Zurückhaltung, was den Weg ins Ausland betrifft. Aber auch da sei man auf einem guten Weg – zumal aus den 29 Erstunterzeichnern mittlerweile 47 europäische Staaten geworden sind.
Ein weiteres Ziel allerdings wurde beim Bologna-Prozess mit Pauken und Trompeten verfehlt: Eigentlich sollte der Aufbau des europäischen Hochschulraums bis 2010 abgeschlossen sein. Zwischendurch wurde als neue Zielmarke das Jahr 2020 ausgegeben – doch auch das wurde mittlerweile schon wieder stillschweigend einkassiert.

