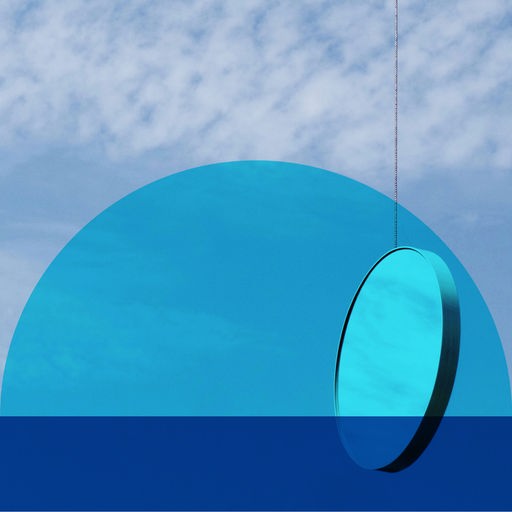Torsten Teichmann: Am Mikrofon heute Torsten Teichmann, heute aus Israel, genauer gesagt aus Jaffa, einer Jahrhunderte alten arabischen Stadt am Mittelmeer, die heute ein Teil von Tel Aviv ist.
Mir gegenüber sitzt Eva Illouz, sie ist Professorin für Soziologie an der hebräischen Universität in Jerusalem. Herzlich willkommen!
Eva Illouz: Good morning!
Teichmann: Eva Illouz ist in Marokko geboren, 1971 zog die Familie nach Frankreich, nach Sarcelles, einem Vorort im Norden von Paris. Sie hat in Paris und Jerusalem studiert; Soziologie, Kommunikation und Literatur, in den USA promoviert.
Eva Illouz forscht auf einem Gebiet der Emotionen, also der Beziehung zwischen Gefühlen, Wirtschaft und Kommunikation in der modernen Gesellschaft. Zur Arbeit gehören Vorlesungen, zum Beispiel am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main 2004, Forschung am Wissenschaftskolleg in Berlin und Gastprofessuren, zum Beispiel in Princeton, in den USA.
In Deutschland ist zuletzt ihr Buch "Warum Liebe weh tut" erschienen, das war 2011. Und in diesem Jahr gibt der Suhrkamp-Verlag eine Sammlung von Kolumnen und Essays heraus, das sind dann auch Texte zur gegenwärtigen Politik.
- Eva Illouz, Sie wurden in Marokko, in eine jüdische Familie geboren. Und als Sie zehn Jahre alt waren, beschloss Ihre Familie, nach Frankreich zu gehen. Warum entschieden sich Ihre Eltern 1971 für Frankreich?
Illouz: Sie meinen, warum Frankreich und nicht Israel? Nach dem Sechstagekrieg begannen die marokkanischen Juden, das Land in Scharen zu verlassen. Ich glaube, der Zionismus war für die nordafrikanischen Juden wirklich von großer historischer Bedeutung. Als meine Eltern sich für Frankreich entschieden, ging es meiner Ansicht nach eher um die Frage, wo ihre Kinder die bessere Ausbildung erhalten würden. Und obwohl sie leidenschaftliche Zionisten waren, kamen sie zu dem Schluss, dass Frankreich das Land war, wo das am ehesten zutraf. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen haben sie da die richtige Entscheidung getroffen. Wissen Sie, mit 12 oder 13 hatte ich schon Lateinunterricht, ich habe viele Jahre Altgriechisch gelernt. Und das war üblicher Bestandteil des Stundenplans einer regulären staatlichen Schule. Mit 16 oder 17 las ich Plato, und zwar im Original. Und das alles eben nicht an einer besonderen Bildungsstätte, ich war einfach in der normalen Schule in unserem Viertel. In der Nachbarschaft. Also, ich denke wirklich, meine Eltern haben die damals bestmögliche Entscheidung getroffen.
Teichmann: Und war das typisch für Ihre Familie? Dass Ihre Eltern auf eine sehr gute Ausbildung Wert legten?
Illouz: Wissen Sie, ich glaube, das hat damit zu tun, was es heißt, Jude in einem nichtjüdischen Land zu sein. Ich glaube, Juden sowohl in Nordafrika als auch in Europa hatten eine Art Ehrfurcht vor Bildung und Kultur, da sie spürten, dass Bildung der beste Weg in Richtung Integration war. Und auch in unserer Familie war dieser Aspekt sehr wichtig.
Teichmann: Erzählen Sie ein wenig über Sarcelles! Heutzutage verweist die Stadt gern auf ihre Vielfalt: drei katholischen Kirchen, eine protestantische, sieben Synagogen und zwei Moscheen. Das scheint mir eine interessante Mischung!
Illouz: Sehen Sie, meine Eltern, die eben religiös waren, wählten ... Also, wir zogen die ersten Jahre nach Sarcelles, erst später nach Paris. Es war sozusagen eine Art Zwischenstation auf dem Weg von Marokko und Paris. Und ich denke, Sie taten das, was jeder Immigrant gemacht hätte, nämlich dorthin zu gehen, wo man nicht alleine war, wo es viele gab, die waren wie sie. Zu dieser Zeit war Sarcelles voll mit nordafrikanischen Einwanderern, deren Identität sehr vergleichbar mit der meiner Eltern war.
Ich muss sagen, dass ich froh um meine Zeit in Sarcelles bin. Es war ein Vorort, ein Arbeiterklassenvorort mit einer sehr, sehr gemischten Bevölkerung. Damals gab es weniger Muslime als jetzt, es waren vor allem Juden, Katholiken, Protestanten, letztere allerdings weniger stark vertreten, und Atheisten. Dort lernte ich, was Sozialismus heißt, was französisches Nationalbewusstsein, was Universalismus bedeutet, denn ich fühlte mich in keiner Weise anders und wurde genauso behandelt wie die anderen Kinder in der Schule. Was es heißt, französischer Bürger zu sein, lernte ich also in diesem Arbeitervorort. Ich weiß nicht ... Ich habe mich immer gefragt, ob ich diese nationale Identität so verinnerlicht hätte, wenn wir direkt in das vornehme noble Pariser Viertel gezogen wären, in dem wir später lebten. Vermutlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich dort solch einen direkten Kontakt mit Marxisten, Sozialisten, Anarchisten gehabt hätte, die sich dort - auch schon in der Schule - in größeren Gruppen zusammengeschlossen hatten. Ich denke, auf den Pariser Schulen ging es vermutlich ruhiger zu, sie hatten generell weniger Berührungspunkte mit der politischen Linken jener Zeit.
Teichmann: Und haben Sie damals schon die vielen Unterschiede zwischen diesen Menschen wahrgenommen oder war das etwas, was Ihnen erst später bewusst wurde?
Illouz: Nun, da gibt es ja vor allem zwei Unterschiede, da ist der ethnische und der religiöse Unterschied ... Ich denke, was es ausmacht, sich als Franzose zu fühlen, ist Folgendes: Kennen Sie diese Fische, die amphibisch sind? Die sowohl im als auch außerhalb vom Wasser leben können? So ähnlich verhält es sich auch mit diesem nationalen Identitätsgefühl, man ist amphibisch in dem Sinne, dass man sozusagen ständig aus seiner Identität schlüpft und dann wieder hinein, sowohl aus seiner spezifischen religiösen Identität als auch der französischen. So waren wir uns gleichzeitig dessen bewusst, dass wir zwar alle zu unterschiedlichen Religionen gehörten, aber dass doch ein jeder von uns Franzose war, und zwar in erster Linie Franzose.
Also ganz anders als in den Vereinigten Staaten, wo die Unterschiede in Rasse und Herkunft und die damit verbundenen Spannungen immer eine große Rolle spielten und es auch weiterhin noch tun; ich erinnere mich, dass es in meiner Klasse nicht wenige Kinder gab, die aus den französischen Kolonien Afrikas stammten und ich aber erst viel später bewusst wahrgenommen habe, dass ihre Hautfarbe schwarz war. Ich war ihrer Hautfarbe gegenüber sozusagen blind, da die einzige relevante Frage für mich damals die war, ob jemand Franzose war oder nicht. Ich wurde später Französin, also ein paar Jahre nach unserer Ankunft in Frankreich wurden wir eingebürgert. Und sobald ich offiziell Französisch war, hatte ich wirklich das Gefühl, dazu zu gehören. Also in diesem Sinne kann ich mich nicht erinnern, mit dem Gefühl aufgewachsen zu sein, dass meine jüdischen oder nordafrikanischen Wurzeln eine bedeutende Rolle in meiner Beziehung zur französischen Gemeinschaft gespielt hätten.
Teichmann: Was hat Sie besonders angesprochen in der Soziologie?
Wie entstehen Gruppen?
Illouz: In der Soziologie? Wissen Sie, Simmel hatte diese These, dass Soziologen Fremde sind und ich denke, es ist kein Zufall, dass viele Soziologen Juden sind. Es ist der Beruf des "inneren Fremden". Und ein Jude ist oft jemand, den ich als "inneren Fremden" bezeichnen würde. Jemand, der dazugehört, sich aber manchmal ein wenig anders wahrnimmt. Und ich würde sagen, dass ich Soziologin wurde, weil ich mich als Jüdin eben immer ein bisschen wie eine innere Fremde fühlte. Obwohl ich dazugehörte. Man gehört dazu, aber eben nicht ganz und gar. Und das Wissen darum lässt einen darüber nachdenken, was "Dazugehören" eigentlich bedeutet. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage aus den Ursprüngen der Soziologie als Wissenschaft.
Warum gibt es Gruppen als Gegenentwurf zu Menschen, die alleine oder zu zweit leben? Wie entstehen Gruppen? Wie behaupten und erhalten sie sich? Was macht die Beziehung zwischen Individuum und Gruppe aus? All das sind Fragen, die ich mir als Immigrantin tatsächlich stellte, als jemand, der nicht der Mehrheitskultur angehörte. Ich stellte mir diese Fragen und daher war der Versuch, die Elemente meiner Biografie verstehen zu wollen, die mir am prägendsten, am wichtigsten erschienen, ein ganz natürliches Bedürfnis für mich. Ich zog von Marokko nach Frankreich. Von Frankreich in die USA. Von den USA nach Israel. Ich war oft Immigrantin, also spielte das in meinem Leben eine entsprechend wichtige Rolle. Und ich denke, in gewisser Weise bietet die Soziologie die Möglichkeit, dem Erleben von Immigration, dem Gefühl des Fremdseins einen Sinn zu geben und es deuten zu können.
Teichmann: In Deutschland werden Sie heute oft als "die israelische Soziologin" bezeichnet und man findet kaum einen Artikel, der sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen beschäftigt, ohne auf Ihre Bücher oder Aussagen Bezug zu nehmen. Und das stammt von einer These, die Sie recht früh formulierten und die sich mit dem Einfluss der Wirtschaft auf das Privatleben beschäftigt und auch damit, wie Emotionen das Geschäftsleben beeinflussen. Wann kamen Sie auf diesen Zusammenhang?
Illouz: Ich habe diese Gedanken erstmals 2004 im Rahmen der Adorno-Vorlesungen vorgestellt. Ich denke, das war zum einen Resultat meines Interesses an der romantischen Liebe. Was ist aus ihr geworden, was waren die Auswirkungen der Psychologie auf Romantik, auf Liebe? Und zum anderen gründete es auf meinem Interesse für die Art und Weise, wie Emotionen Eingang in die Arbeitswelt gefunden haben. Und da ich mich für diese beiden Aspekte interessierte, war es mir möglich, zu erkennen, dass wir inmitten eines Prozesses waren, in dem Konsum und Arbeitsmarkt neue Wege hervorgebracht hatten, Emotionen zu kontrollieren und zu nutzen. Schauen wir auf die Managementlehre. Managementtheorien: Wie wird man ein guter Manager, wie führt man seine Leute gut? In den 20er-, 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts wurde deutlich, dass man das erreicht, indem man den Gefühlen der Leute mehr Aufmerksamkeit schenkt. Indem man deren und die eigenen Emotionen beeinflusst, um auf diese Weise funktionierende emotionale Bindungen zu schaffen. Und es gab Versuche, Lösungen auf die Frage nach der besten Zusammenarbeit zu finden. Emotionen wurden also zu einem wichtigen Bestandteil des Bestrebens, die Arbeiterschaft produktiver und den Arbeitsprozess kooperativer werden zu lassen. Und zwar durch Psychologie.
Psychologie hat eine bedeutende Rolle dabei gespielt, Menschen, die normalerweise ausschließlich am Profit, an Bilanzen interessiert sind, über die emotionalen Aspekte des Arbeitsprozesses nachdenken zu lassen. Das war der eine Punkt. Die andere Sache, die sehr faszinierend war, betraf die romantische Liebe. Und zwar in einem Zusammenhang, zu dem Erich Fromm schon sehr viel früher geschrieben hatte, das konnte man dann später und in einer ausgeprägteren Form bestätigt sehen, jedenfalls ging es um die Beobachtung, dass Liebende und Verliebte sich mehr und mehr wie Geschäftsleute verhielten, in Beziehungen investierten, nach Profit suchten, den Preis ihrer Emotionen erwogen.
Emotionen bestimmen das Wirtschaftsleben
Man könnte also sagen, man hat da diese beiden Prozesse, wo auf der einen Seite eine ganze Kultur über Gefühle nachdenkt, wo die Bürger das Bedürfnis haben, die eigenen Emotionen zu analysieren und zum Ausdruck zu bringen. Wo Wohlbefinden, Glücklichsein nach emotionalem Kriterien bemessen werden. Und auf der anderen Seite haben wir diese Entwicklung, die Emotionen in großem Maße Teil des Wirtschaftslebens werden lässt. Durch die die Menschen Gefühle als etwas betrachten, das sie zu ihrem Vorteil manipulieren müssen. Und diese beiden Prozesse, in ihrem paradoxen Zusammenspiel, waren das, was mich so interessierte.
Teichmann: Vielleicht können wir sie kurz einzeln betrachten und dann wieder zusammenführen. Aber zunächst würde ich gerne auf etwas eingehen, was Sie zu Beginn erwähnten. Dass man im Wirtschaftsleben, in der Ökonomie seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, fast ausschließlich darauf bedacht war, den Gewinn zu maximieren. Und oftmals mit Hilfe besserer Produktionsketten, Arbeitsteilung, Spezialisierung. Wie genau hat die Psychologie den Weg in die Arbeitsablauf gefunden, in den Prozess des ständigen Strebens nach größerer Effizienz?
Illouz: Im 19. Jahrhundert war Psychologie eine neue Wissenschaft, die versprach, das Verhalten der Menschen besser verstehen und kontrollieren zu können. Ab dem 19. Jahrhundert entsteht ein neues Produktionssystem, es gibt eine Entwicklung von den kleinen Werkstätten und Betrieben zu immer größeren Fabriken und Werkanlagen. Neue Technologien werden geschaffen, die eine schnelle und billige Herstellung von Gütern ermöglichen. Und so kommen an den einzelnen Arbeitsstätten mehr und mehr Menschen zusammen. Das ist einfach so, es werden immer mehr Arbeiter, also gibt es nun auch die neue Gruppe der Vorsteher, der Geschäftsführer, der Direktoren. Vor den 1920er-Jahren gab es sie noch nicht, aber nun sind sie da und ihre Aufgabe besteht in der Vermittlung zwischen Arbeitern und den Eignern, den Besitzern einer Fabrik. Die vorher in unmittelbarer Beziehung zueinander standen, und einige, oder besser gesagt viele Eigner, benutzten allerlei Arten von Zwangsmitteln, um ihre Arbeiter nach ihren Maßstäben funktionieren zu lassen. Und nun, mit der neuen Schicht der Geschäftsführer, kommen auch neue Fragen auf, diese Manager sollen die Leute führen, aber wie? Was ist der beste Weg? Und um das herauszufinden, wendet man sich der neuen Wissenschaft zu, der Psychologie. Die ersten Psychologen waren überhaupt nicht von der Freudschen Art, es waren mehr experimentelle Psychologen. Und an die wenden sich diese neuen großen Unternehmen nun. Sie hatten vor allem Probleme mit der Disziplin der Arbeiter, viele kamen nicht zum Dienst oder waren unpünktlich; das wollten sie bekämpfen, sie wollten die Arbeiter disziplinieren. Und sie wollten aber auch etwas gegen die Unzufriedenheit dieser Menschen tun. Die ersten Psychologen, an die man sich also wandte, um das Problem der Mitarbeiterführung anzugehen, dachten zunächst im Rahmen herkömmlicher Variablen, so wie Loyalität, Religiosität, Intelligenz, Disziplin etc. und suchten diesbezüglich nach Zusammenhängen. Aber sie wurden nicht fündig. Das ging ein paar Jahre so.
Und dann kam ein Psychologe ins Spiel, Elton Mayo war sein Name, er war ein Anhänger der Jungschen Psychologie. Und er wurde von General Electrics um Hilfe gebeten, in New Jersey, meine ich, wo die Produktivität der Arbeiter gesunken war. Also ging er nach New Jersey, um sich das anzusehen und er hatte ein ganzes Team an Mitarbeitern dabei. Sie vermuteten, dass der Produktionsrückgang etwas mit dem Licht, der Helligkeit zu tun hatte, man nahm also allerlei Veränderungen an den Raum- und Lichtbedingungen vor und tatsächlich beobachteten die Psychologen, dass die Produktivität sich wieder steigerte. Nun waren sie sich allerdings nicht sicher, welcher Aspekt genau dafür verantwortlich war, denn sie hatten ja allerhand verändert. Und schließlich stellte sich heraus, dass der Grund, warum die Produktivität wieder zunahm, die einfache Tatsache war, dass ein Team von Leuten gekommen war und mit den Arbeitern geredet hatte. Mit anderen Worten, die Arbeiter konnten ihrer Unzufriedenheit Ausdruck geben, erzählen, warum sie glaubten, dass das Arbeitsumfeld nicht ideal war und über das schlechte Verhältnis mit der Geschäftsführung sprechen.
Diese Erkenntnis erscheint uns heute trivial, aber man musste diesen Zusammenhang erst einmal entdecken. Warum? Wissen Sie, viele Menschen sahen damals Arbeiter - von denen einige weder lesen noch schreiben konnten - kaum als menschliche Wesen an, man hielt sie ganz einfach für dumm. Und so waren die Führungstheorien vor den 1910er-, 1920er-Jahren im Großen und Ganzen von der Vorstellung geprägt, dass man diese ungebildeten Arbeiter bestmöglich kontrollieren müsse, man sah sie tatsächlich mehr als bessere Tiere denn als Menschen an. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber nicht sehr. Diese frühen Managementlehren, wenn man so will, basierten auf der Vorstellung von Arbeitern als unkultivierte, gewalttätige, stumpfsinnige Analphabeten. So dachte man.
Und zusammen mit der wachsenden Demokratisierung der Gesellschaft, die unabhängig davon stattfand, haben Mayo und die Psychologen dazu beigetragen, dass sich das Bild vom Arbeiter verbesserte, dass die Geschäftsführer, die Manager sie als Menschen, als Menschen mit Gefühlen, wahrnahmen und auch als solche behandelten. Und so eine neue Sichtweise auf Emotionen im Arbeitsprozess ermöglicht wurde.
Teichmann: Was halten Sie im heutigen Arbeitsleben für die wichtigsten Emotionen, die kontrolliert oder genutzt werden müssen?
Illouz: Oh, ich würde sagen, zunächst natürlich Ärger. Frustration. Und Neid. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die einerseits egalitär ist - wir werden mit dem Bewusstsein geboren, dass wir alle gleich sind - und ehrlich gesagt haben die meisten von uns auch sehr vergleichbare Grundfähigkeiten, eine ähnliche Intelligenz und Kompetenz.
Aber auf der anderen Seite leben wir auch in einer extrem wettbewerbsorientierten Gesellschaft, einer Gesellschaft, die denjenigen wertschätzt, der im positiven Sinne etwas Besonderes darstellt, heraussticht, erfolgreich ist.
Und diese Diskrepanz ist ein idealer Nährboden für das meiner Ansicht nach verheerendste aller Gefühle, den Neid. Der ja im Grunde daher rührt, dass jemand etwas hat, das er nach Ansicht des anderen nicht verdient. Wenn man nun in einer hoch strukturierten hierarchischen Gesellschaft lebt, dann ist die Tatsache, dass jemand etwas hat, das man selber entbehrt, dass man vielleicht ein einfacher Bauer ist und der andere ein Aristokrat, für sich genommen kein Grund, Neid zu empfinden. Denn dann wurde man in eine Gesellschaft hineingeboren, in der man akzeptiert, dass es eine soziale Rangordnung gibt und unterschiedlich gestellte Gruppen. Aber in einer egalitären Gesellschaft ist das anders. Weil wir davon ausgehen, dass im Prinzip jeder das Gleiche haben sollte. Aber moderne Gesellschaften sind nun einmal sehr stark wettbewerbsorientiert und gepaart mit unserer Achtung vor Eigenwilligkeit, Einzigartigkeit und Erfolg sorgt dieser Gegensatz von theoretischer Gleichheit bei tatsächlicher Ungleichheit natürlich für Unmut. Und das macht die modernen Arbeitsplätze zu Orten, die voller Neider sind.
Geschäftsmodelle auch für das Privatleben
Teichmann: Wenn wir uns nun der privaten Seite zuwenden, den Paaren, den Liebenden, der Romantik. Welche Geschäftsmodelle sind es, die heute in unser Privatleben spielen?
Illouz: Nun, lassen Sie uns das am Beispiel von Online-Dating-Seiten, Partnerbösen betrachten ...
Teichmann: Sehr professionell heutzutage ...
Illouz: Ja. Viele Menschen nutzen das Internet auf der Suche nach Sex, Romantik, Ehe und so weiter. Man sucht dort nach jemandem, als wäre man auf einem Markt. Man hat alle Möglichkeiten vor Augen. Und man kauft sozusagen ein, in dem man jemandem einen gewissen Wert zuordnet. Man hat einige sehr klare Kriterien und nach denen wird die Person, die man quasi erwerben will, beurteilt, bewertet.
Es gibt also verschiedene Wahlmöglichkeiten, so, wie in einem Supermarkt.
Das Sortiment befindet sich direkt vor einem. Und man versucht natürlich, ein gutes Geschäft zu machen. Ich würde sagen, das ist eine Art, auf die ein Geschäftsmodell in Beziehungen einfließen kann. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Art der Auswahl, die für uns so sichtbar ist, wie es Produkte sind, die wir erwerben können - dass die Auswahl nun die Beziehung begründet.
Das Sortiment befindet sich direkt vor einem. Und man versucht natürlich, ein gutes Geschäft zu machen. Ich würde sagen, das ist eine Art, auf die ein Geschäftsmodell in Beziehungen einfließen kann. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Art der Auswahl, die für uns so sichtbar ist, wie es Produkte sind, die wir erwerben können - dass die Auswahl nun die Beziehung begründet.
Teichmann: In which way?
Illouz: So, wie ich es gerade beschrieb. Bevor es die Online-Partnerbörsen gab, lief es so: Man traf jemanden und wenn es nicht funkte, dann wartete man, bis der Zufall, das Leben einen jemand anderen treffen ließ. Das konnte passieren. Oder auch nicht. Sehen Sie, als Jane Austen einen Heiratsantrag bekam, lehnte sie ab, weil ihre Eltern der Meinung waren, dass es dem Bewerber an Mitteln fehlte.
Sie hoffte dann auf einen anderen Antrag, aber dazu kam es nie. Also in dieser Gesellschaftsordnung gab es nicht sonderlich viel Auswahl. Heute läuft das anders. Nehmen wir an, ich bin 55 Jahre alt und suche einen Mann, der zwischen 55 und 65 ist. In einer typischen Online-Partnerbörse würde ich sofort eine Auswahl von 150 Männern präsentiert bekommen. Und meine Beziehung zu ihnen würde zunächst darin bestehen, sie zu begutachten, mir ihre Profile anzusehen, ihre Daten, Eigenschaften, Besonderheiten. Und ich würde beurteilen, welcher der attraktivste ist, welcher unter ihnen am besten zu mir passen würde. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn man über einen größeren Zeitraum hinweg verschiedene Personen real kennenlernt.
Hier sind die Menschen wie Waren auf einem Tisch ausgelegt, es ist ein bisschen wie ein Buffet. Und alle auf diesem Buffet stehen zur Verfügung. Es ist also eine völlig andere Erfahrung.
Von Maximierern und Optimierern
Teichmann: Und wie benimmt man sich an diesem Buffet? Denn, darüber sprachen wir schon, aus dem wettbewerbsorientierten Berufsleben lernen wir ja, uns nicht zufriedenzugeben, immer nach dem Besten zu greifen. Und Neid zu empfinden, wenn das anderen besser gelingt.
Illouz: Ich denke, zunächst sollte man zum Maximierer werden. Man will ja eine möglichst große Auswahl haben, das Angebot ständig maximieren, nach dem Besten Ausschau halten. Wohingegen ein Optimierer jemand ist, der sich mit einer Auswahl arrangieren kann, die eben gut genug ist. Und ich denke, einer der Hauptunterschiede zwischen der Auswahl, die man im Internet hat, und dem Kennenlernen von Personen im wirklichen Leben ist, dass letztere eher dem Optimierungstyp entsprechen. Man gibt sich auch mit einem Kompromiss zufrieden, während die Partnerbörsen einem den Eindruck vermitteln, dass es ein scheinbar endloses Angebot gibt. Dass, wenn man heute niemanden findet, morgen sicher jemand dabei sein wird. Und das lässt einen zum Maximierer werden, der fortwährend nach einer besseren Option sucht. Es bedeutet außerdem, dass man eher dazu tendiert, jemanden wegen Kleinigkeiten einen Korb zu geben. Ich denke also, die Entwicklung geht nicht nur dahin, dass wir zu Maximierern werden, sondern auch, dass wir sehr auf Details achten, wenn es darum geht, jemanden auszuwählen oder abzulehnen. Wenn man im wirklichen Leben im Alltag jemanden kennenlernt, unterwirft man diese Person automatisch und intuitiv einer ganzheitlichen Beurteilung. Man sieht auf den ersten Blick, was einem gefällt und was nicht. Und das lässt einen eher akzeptieren, was nicht so ideal ist. Weil man gleichzeitig das Positive sieht. Im Internet ist es wahrscheinlicher, dass man einen potenziellen Partner ausschließt, wenn eine bestimmte Eigenschaft, ein Merkmal nicht gefällt.
Teichmann: In dieser Welt des Maximierens, wer ist besser darin? Können Sie das sagen? Oder ist das ausgeglichen?
Illouz: Ich glaube, Frauen sind rationaler als Männer, was die Liebe angeht. Ich denke, dass Frauen mehr dazu tendieren, Männer nach ihren verschiedenen Attributen zu beurteilen, rationaler vorgehen. In den Interviews, die ich geführt habe, wird das deutlich; Frauen zählen eine ganze Reihe von Kriterien auf, nach denen sie Männer beurteilen, sie haben eine Art Checkliste. Männer hingegen haben eher eine ganzheitliche Herangehensweise. Sie achten zum Beispiel viel mehr auf den Körper, der ja per Definition ein Ganzes ist. Und Frauen tendieren dazu, diesen gesamten Prozess zu kognitivieren, um eine größere Kontrolle über den Beziehungsaufbau im Sinne ihrer spezifischen Bedürfnisse oder Vorlieben zu haben. Männer hingegen legen, da sie sich sehr stark an der Sexualität orientieren, in der Regel mehr Wert auf eine ganzheitliche Sichtweise, was Beziehungen angeht.
Teichmann: Eva Illouz, vielen Dank für das Gespräch!
Illouz: Dankeschön!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Eva Illouz schreibt regelmäßig für die israelische Tageszeitung "Haaretz". "DIE ZEIT" zählt sie zu den zwölf Intellektuellen weltweit, die das Denken der Zukunft verändern könnten.