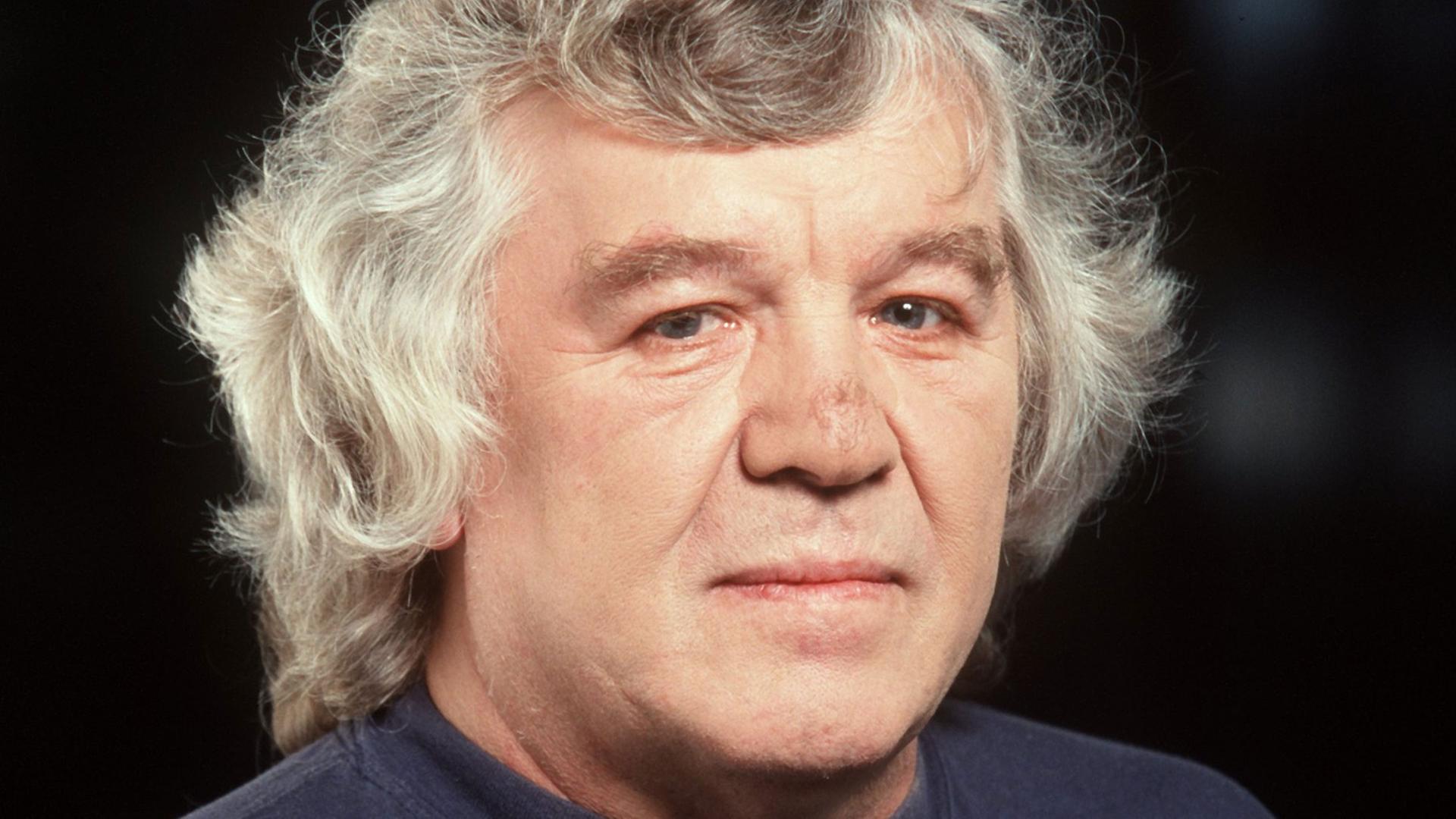Er kam im Wortsinn von ganz unten: aus dem Kesselhaus einer Maschinenfabrik. Ein Heizer, ein Arbeiter, ein Literaturautodidakt, der nebenher geradezu manisch schrieb: Gedichte, Geschichten, Romane. Jahre-, jahrzehntelang verstaubten seine Manuskripte in der Schublade. Doch dann machte ein in Westdeutschland veröffentlichter Gedichtband den DDR-Autor Wolfgang Hilbig 1979 auf einen Schlag berühmt.
Geboren 1941 und aufgewachsen in der thüringischen Kleinstadt Meuselwitz nahe Leipzig, war Hilbig ein Ausnahmetalent, ein Einzelgänger und ein radikaler Schreiber, der die Deutschen in seinen Texten unbeirrbar an ihre Dämonen erinnerte: An die Repressionen des Überwachungsstaats DDR. An die Ausbeutung von Natur und Kreatur im Industrie-Kapitalismus. Und nicht zuletzt: An die monströse Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. Sein Schreibprogramm war auch ein Sich-die-deutsche-Schuld-von-der-Seele-Schreiben. Oder, wie Michael Opitz früh in seiner Hilbig-Biografie resümiert:
"Kein anderer Autor seiner Generation hat sich an Adornos These, es sei nach Ausschwitz nicht mehr möglich, ein Gedicht zu schreiben, so abgearbeitet wie Wolfgang Hilbig. (...) Deutschland konnte ihm Heimat nicht sein. (...) Zeit seines Lebens war es ihm unmöglich, diesen auf seiner Geburt liegenden Schatten zu ignorieren."
Viel gerühmt und preisgekrönt
Innerhalb der deutschen Literaturkritik war man sich schnell einig, dass man es bei Wolfgang Hilbig mit einem herausragenden Schriftsteller zu tun hatte. Im Anschluss an seine Übersiedelung nach Westdeutschland 1985 erhielt er quasi alle wichtigen Literaturpreise der Bundesrepublik. Darunter 2002 auch den wichtigsten: den Georg-Büchner-Preis.
Und doch wurde der hochgelobte Selfmade-Autor aus Meuselwitz nie ein Bestseller. Und kennen ihn viele Leser bis heute nicht, obwohl Wolfgang Hilbig doch eigentlich idealtypisch die Lieblingsfigur des lange verkannten Genies verkörpert:
"Wenn das Feuer die Kohle in Asche verwandelte, wurde aus dem Heizer ein Schriftsteller, der an einem staubigen Pausentisch (...) Texte schrieb, die heute zur Weltliteratur zählen."
Schwärmt auch Michael Opitz in seiner Einleitung. Wie aber schreibt man eine Biografie über ein verkanntes Genie, ohne in die Heiligenlegende abzugleiten? Und: Wie kann einem das gelingen, wenn man diese Biografie auch noch im Auftrag des Hausverlags ebenjenes Genies verfasst? Also im Fall von Opitz im Auftrag des S. Fischer Verlags, wo man Wolfgang Hilbig bis heute als Hausheiligen verehrt?
Ein Lektürebrocken von 663 Seiten
Michael Opitz, ein 1953 in Berlin geborener Literaturwissenschaftler und -kritiker, geht seine ebenso hochambitionierte wie hochriskante Schreibmission wohltuend nüchtern, allerdings auch sehr akribisch an. Denn er hat für seine Hilbig-Biografie ungeheuer viel recherchiert. Nicht nur den Nachlass gesichtet, sondern auch mit den ehemaligen Lebenspartnerinnen Hilbigs gesprochen, dazu noch mit der 2011 verstorbener Mutter. Er ist nach Meuselwitz, Leipzig und Berlin gereist. Hat sich in unzählige Briefe, Tagebücher, Notizen, Artikel und Stasi-Akten vertieft. Und natürlich das umfangreiche Werk Hilbigs noch einmal ganz genau gelesen, inklusive vieler unveröffentlichter Texte.
Herausgekommen ist dabei ein mit Informationen prall gefüllter Lektürebrocken von 663 Seiten, davon 75 Seiten allein nur Quellen-Anhang. Und schon dieser riesige Umfang von Opitz’ neuer Hilbig-Biografie macht von vornherein klar: Dies hier soll nicht einfach nur ein weiterer Lebensbericht über den sogenannten "Hölderlin aus Sachsen" sein. Nein: Opitz will ganz offensichtlich die eine große Standardbiografie über Wolfgang Hilbig vorlegen. Das eine Schlüsselwerk, das den immer noch rätselhaft anmutenden Schriftsteller letztgültig enthüllt.
Leben und Werk untrennbar verknüpft
Wie aber lässt sich eine derart riesige Menge von Daten überhaupt ordnen? Opitz versucht es über eine zentrale Aussage, die Hilbig selbst mehrfach zu Lebzeiten über seine Bücher gemacht hat. Nämlich über die Aussage, dass alle seine Texte autobiografisch grundiert seien:
"Die Basis von Hilbigs Werks bildete Durchlebtes. Oft sind die Ähnlichkeiten zwischen der Biografie seiner Figuren und der des Autors so frappierend, dass es berechtigt erscheint, von autofiktionalen Texten zu sprechen."
Tatsächlich lässt sich nicht bestreiten, dass Leben und Werk bei Wolfgang Hilbig untrennbar miteinander verknüpft sind. Opitz nimmt das in seiner Biografie zum Anlass, um vor allem die Familien- und Herkunftsgeschichte des Autors noch einmal genauestens auszuleuchten.
In platonischer Blutschande mit der Mutter
Dabei stößt er schnell auf einen Verlust, der Hilbigs Leben früh überschattete. Denn dessen Vater Max, ein Wehrmachtssoldat, kehrte nie von der Ostfront zurück und galt seit 1942 als verschollen. Ein nie völlig geklärtes Verschwinden, das Hilbigs Mutter Marianne dadurch zu kompensieren versuchte, dass sie ihren kleinen Sohn zu einem Stellvertreter des Vaters erzog - und unter anderem von ihm verlangte, jahrelang neben ihr im Ehebett zu schlafen:
"Ich habe mit meiner Mutter in platonischer Blutschande gelebt bis in mein vierzigstes Jahr."
Notierte Wolfgang Hilbig selbst rückblickend resigniert. Er schaffte es nie ganz, sich aus der traumatischen Umklammerung seiner Mutter zu lösen und wohnte bis Ende dreißig bei ihr im Haus. Was umso tragischer anmutet, als Hilbigs Mutter, eine Verkäuferin und überzeugte SED-Parteiangehörige, überhaupt kein Verständnis für ihren künstlerisch hochbegabten Sohn hatte. Sie schlug den Jungen mit dem Teppichklopfer oder mit der Schöpfkelle, weil er ihrer Meinung nach zu viel Zeit mit Lesen und Geschichtenschreiben vertrödelte. Sarkastisch bilanziert Opitz das Mutter-Sohn-Verhältnis einmal so:
"Wolfgang Hilbig blieb für seine Mutter ein Fremder. Ihr Anteil an seinem Erfolg als Autor war, dass sie mit einer unglaublichen Beharrlichkeit versucht hat zu verhindern, dass ihr Sohn ein Schriftsteller wird: Dadurch stärkte sie seine Willenskraft und seinen Widerspruchsgeist, und sie lehrte ihn darüber hinaus mit Misserfolgen umzugehen."
Schreiben als Refugium
Komplettiert wurde Hilbigs Kindheits-"Hölle", wie Opitz es nennt, durch einen Großvater, der als Bergmann arbeitete und weder schreiben noch lesen konnte. Denn auch dieser Großvater hatte für die Literaturbegeisterung seines Enkels nur Spott oder Prügel parat. Kurzum: Das hochbegabte Arbeiterkind Wolfgang Hilbig hatte das Pech, in einer völlig a-literarischen Familie aufzuwachsen, die sein Ausnahmetalent nicht nur nicht förderte, sondern sogar als strafwürdigen Makel ansah.
Unschwer sich vorzustellen, wie zutiefst verletzend und verunsichernd diese familiäre Zurückweisung auf den Jungen gewirkt haben muss. Ebenfalls unschwer sich vorzustellen, wie viel Kraft es Wolfgang Hilbig gekostet haben muss, trotz solcher Widerstände an seiner Schreibleidenschaft festzuhalten. Das Schreiben wurde für ihn zum Überlebensmittel. Zu einem Refugium inmitten einer gewalttätigen, bedrohlichen Umwelt.
Freiwilliger Karriereverzicht
Um hier nicht noch weiter anzuecken, schlug der Heranwachsende dann eine typische Arbeiterlaufbahn ein: Er boxte in seiner Freizeit für den Meuselwitzer Sportclub BSG Motor. Verließ die Volksschule schon nach Klasse Acht. Absolvierte eine Lehre zum Bohrwerksdreher. Und ließ sich schließlich 1970 mit 29 Jahren fest als Heizer in der ortsansässigen Maschinenfabrik anstellen. Was auch in der DDR einem Job auf unterster Stufe entsprach.
Zehn Jahre lang arbeitete Wolfgang Hilbig als Heizer, obwohl er dafür eigentlich überqualifiziert war. Doch hier unten im Kesselhaus, so hat er seine Entscheidung selbst einmal begründet, hatte er in den Pausen immerhin Ruhe fürs Schreiben. Und wurde nicht so streng überwacht wie andere Berufstätige in der DDR:
"Bei mir war es so, dass ich mir dann Berufe gesucht habe, wo man von der Arbeit nicht so in Anspruch genommen war, dass man nicht mehr ans Schreiben denken konnte. Das sind dann Berufe, die weniger qualifiziert sind. Für die Öffentlichkeit aber wird man dann immer mehr zu einer Figur, die sich rückwärts entwickelt."
Inspiriert von den Romantikern
Es liest sich beeindruckend, wie hartnäckig der Heizer Hilbig an seinem Traum von einer Schriftstellerexistenz festhielt, obwohl er auf seine eingeschickten Manuskripte von DDR-Verlagen immer nur Absagen erhielt.
Interessant liest sich auch, wie Opitz anhand früherer Texte Hilbigs literarische Entwicklung nachzeichnet. War der junge Autodidakt zunächst stark von Romantikern wie E.T.A. Hoffmann beeinflusst, wandelte er sich mit der Zeit zu einem Skeptiker der Moderne, der Worte, aber auch Identitäts- und Gesellschaftskonzepte immer mehr auf dem Papier hinterfragte.
Von der Blauen Blume zur Asche der Moderne
Besonders deutlich wird das anhand eines von Opitz ausführlich besprochenen gescheiterten Romanprojekts mit dem Titel "Die Blaue Blume". Ein Titel, der bereits andeutet, dass Wolfgang Hilbig hiermit eine moderne Version des berühmten Novalis-Romans "Heinrich von Ofterdingen" vorlegen wollte. Über zehn Jahre lang hat er an seiner "Blauen Blume" gearbeitet, das Manuskript siebenmal umgeschrieben. Am Ende aber half alles nichts. 1979 gab Hilbig sein ehrgeiziges Projekt schließlich auf. Denn er hatte erkannt, dass die Sprache nach den Gräueln des Holocausts und des Zweiten Weltkriegs nicht mehr dieselbe sein konnte. Und dass die Suche nach einer quasi reinen Poesie damit sinnlos geworden war. Entsprechend findet Hilbigs Neo-Romantiker im Text auch keine blaue Blume mehr, sondern nur noch Asche. Jene Asche, die die Verwüstungen des 20. Jahrhunderts übriggelassen haben:
"Ich sehe, ich schmecke Asche. (...) Die Asche des Himmels und der Hölle. Die Asche des Feuers, die Asche des Wassers, die Asche der Religion, die Asche der Arbeit, die Asche der Macht. (...) Die Asche Millionen Ermordeter. Aus dieser Asche werden uns die Wörter neu
geboren."
Kein sozialistischer Arbeiter-Schriftsteller
Kein Wunder, dass ein so desillusionierter und sprachkritischer Poet wie Wolfgang Hilbig dann nicht zu einem jener propagierten "Arbeiterschriftsteller" werden konnte, den sich die SED-Funktionäre so lautstark wünschten. Forderten diese doch eine sogenannte "realistische" Literatur, die den sozialistischen Alltag möglichst positiv und fortschrittlich darstellen sollte. Eine ideologische Umdeutung des Wirklichkeitsbegriffs, die Hilbig zutiefst empörte:
"Die Spürhunde der Realität haben die Sprache ausgerauft, der Tonfall der Realität ist das ätzende Agens, in dem die Stimmen der Lyrik ersticken."
Für Hilbig, der sich an den Romantikern und an den Avantgardisten der Moderne wie Baudelaire, Rimbaud oder Samuel Beckett orientierte, gehörte das Unsichtbare, das Erträumte oder auch nur Erahnte genauso zur beschreibenden Wirklichkeit dazu wie das klar Sichtbare. Seine Gedichte und Prosatexte waren darum von Anfang an bevölkert von Traum- und Alptraumgestalten, die sich oft als Gespenster einer nur scheinbar vergangenen Vergangenheit erweisen. Dieses Interesse am Düsteren, am Fantastischen und auch Verdrängten aber war mit den Leitlinien des "Sozialistischen Realismus" natürlich nicht vereinbar. Zumal Hilbig in seinen Texten keinen Hehl aus seinen generellen Zweifeln am Sozialismus machte. So wie im Gedicht Fraktur, das 1965 entstanden ist:
"Ihr habt mir ein Haus gebaut
lasst mich ein andres anfangen.
ihr habt mir Sessel aufgestellt
setzt Puppen in eure Sessel.
ihr habt mir Geld aufgespart
lieber stehle ich.
ihr habt mir einen Weg gebahnt
ich schlag mich durchs Gestrüpp seitlich des Wegs."
lasst mich ein andres anfangen.
ihr habt mir Sessel aufgestellt
setzt Puppen in eure Sessel.
ihr habt mir Geld aufgespart
lieber stehle ich.
ihr habt mir einen Weg gebahnt
ich schlag mich durchs Gestrüpp seitlich des Wegs."
Unverhoffter Erfolg in Westdeutschland
Eine Lesung in Hessischen Rundfunk im Oktober 1977 - die allererste Lesung von Wolfgang Hilbig überhaupt vor einem größeren Publikum - wurde dann unverhofft zum Ruf mit Donnerhall. Plötzlich war der lange übersehene Dichter in aller Munde und erhielt gleich mehrere Publikationsangebote von West-Verlagen. Die Biermann-Ausbürgerung lag noch kein Jahr zurück. Und Literatur von DDR-Dissidenten stand in Westdeutschland hoch im Kurs. Trotzdem entbehrt es nicht der Ironie, dass man damals ausgerechnet den Einzelgänger Wolfgang Hilbig als Stimme des ostdeutschen Widerstands feierte.
Was umgekehrt prompt die DDR-Staatsmacht auf den Plan rief. Man steckte Hilbig im Mai 1978 für zwei Monate in Untersuchungshaft, verhörte und schikanierte ihn. Und ließ den schon beim Wehrdienst auffällig Gewordenen nun noch strenger von der Stasi überwachen.
Ein neuer Georg Trakl
Gleichzeitig aber wurde jetzt auch die berühmte inoffizielle Literaturszene vom Prenzlauer Berg auf Hilbig aufmerksam. Allen voran der Lyriker Franz Fühmann, ein einflussreicher, überzeugter Sozialist, der damals viele systemkritische Autoren förderte - und jetzt auch Wolfgang Hilbig unter seine Fittiche nahm. Fühmann schwärmte den Kulturfunktionären von einem neuen Georg Trakl aus Meuselwitz vor - und erreichte immerhin, dass mit "Stimme, Stimme" 1983 doch noch ein Lyrikband des unliebsamen Dichters in der DDR erschien.
Übersiedlung und Enttäuschung
Der Bruch zwischen Hilbig und dem SED-Regime aber war irreversibel. 1985 nutzte der inzwischen beim Fischer-Verlag publizierende Autor ein Aufenthaltsstipendium in Hanau, um sich endgültig nach Westdeutschland abzusetzen.
Eine Flucht in den vermeintlich freieren Westen, die für den DDR-Flüchtigen allerdings schon bald zur großen Enttäuschung wurde. Oder, wie Opitz schreibt:
"Er hatte sich von dem Weggang aus dem Osten eine Befreiung erhofft und auch eine positive Auswirkung auf sein Schreiben. Doch das genaue Gegenteil trat ein. 'Wie soll ich mich töten?' schrieb er im August 1986 (...) ins Tagebuch. "
Im Westen wurde Wolfgang Hilbig mit einem Markt konfrontiert, der Bücher in erster Linie nach ihrer Verkäuflichkeit bewertete und vorrangig als Konsumprodukte betrachtete. Was auch bedeutete, dass die Literatur in der BRD gesellschaftspolitisch einen viel geringeren Stellenwert hatte als in der DDR. Für Wolfgang Hilbig, der im Schreiben und Lesen vor allem Mittel zur Selbstreflexion sah, eine höchst kränkende Erfahrung.
Zwei Flaschen Wodka täglich
Er fühlte sich als nicht-massenkompatibler Autor in der Bundesrepublik fehl am Platz. Und griff aus Kummer bald immer öfter zur Flasche. Bis er sich 1987 selbst in eine Entzugsklinik einlieferte und seiner Dichterkollegin Sarah Kirsch anvertraute:
"Ich landete in Haar bei München, was eine ziemlich berüchtigte Trinkeranstalt (...) ist. Ich musste dorthin, ich war dabei, mich mit zwei Flaschen Wodka täglich zu ermorden."
Mit Unterstützung seiner dritten Lebenspartnerin, der Schriftstellerin Natascha Wodin, mit der Hilbig von 1994 bis 2002 verheiratet war, schaffte der Alkoholabhängige dann zwar den Entzug. Den Schmerz über den Bedeutungsverlust der Literatur innerhalb der spätkapitalistischen Gesellschaft aber konnte Wolfgang Hilbig nie ganz verwinden. In "Das Provisorium", seinem letzten und persönlichsten Roman aus dem Jahr 2000, klagt sein alter ego, der Schriftsteller C.:
"Der Schreibende hat in Europa kein Obdach mehr. Aber wahrscheinlich verbirgt sich hinter diesem Leiden nur die Flucht vor dem Gedanken, dass er seinen Ernst verloren hat. Verlorene Bedeutung und Resonanz."
Die trügerische Instanz des "Ich"
Die Schonungslosigkeit, mit der Hilbig in "Das Provisorium" seine Seelenabgründe offenbarte, erschütterte viele Kritiker. Denn auch wenn der Autor für den Roman die unpersönliche Er-Perspektive gewählt hatte, so war doch auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich bei dem beschriebenen Schriftsteller C. nur um Hilbig selbst handeln konnte. Dieser C. zeigt sich nach seiner Ankunft im Westen 1985 völlig derangiert, weil er einerseits von seiner DDR-Vergangenheit nicht loskommt - sich andererseits aber auch nicht mit seiner neuen Heimat BRD anfreunden kann. Ruhe- und orientierungslos irrt er durch die Städte und fährt mit dem Zug zwischen West und Ost hin und her, von der neuen zur alten Geliebten - und umgekehrt. Und auch: von einem Besäufnis zum nächsten.
Protagonist C. aus "Das Provisorium" ist innerlich völlig zerrissen, so wie eigentlich alle Helden von Wolfgang Hilbig. Der Autor, der selbst jahrelang ein unverdauliches Doppelleben als Heizer und Schriftsteller geführt hatte, machte die Ich-Gespaltenheit zu einem seiner zentralen Themen. Und er erschuf in seinen Geschichten immer wieder aufs Neue Charaktere, die nachhaltig in ihrer Identität verunsichert sind. Dazu erklärte Hilbig selbst 1987:
"Bei mir war es so, dass ich meine Existenz gespalten sah. Und mich hat eigentlich immer sehr diese Gespaltenheit beeinflusst und interessiert. (...) Ich habe es ziemlich lange geheim gehalten, dass ich schreibe. Und das beeinflusst natürlich das Schreiben sehr stark. Das fließt dann auch in den Text ein."
Wie verlässlich ist das "Ich" als Instanz? Und wenn das "Ich" als Konstrukt trügerisch ist: Wie verlässlich ist dann noch die sogenannte Wirklichkeit? Solche, seit dem frühen 20. Jahrhundert von Autoren immer wieder problematisierten Zweifel am Identitätsbegriff, beschäftigten Hilbig sehr. Von daher können sich seine Protagonisten nie ihres Ichs gewiss sein. Und sind ständig damit überfordert, Realität und Fiktion, Wirklichkeit und Täuschung auseinanderzuhalten.
Die DDR wird zur fiktionalen Erzählung
Im Roman "Ich", dem wohl bekanntestem Werk Hilbigs, bei dem der Titel "Ich" nicht ohne Grund in Anführungsstriche gesetzt ist, trieb der Autor sein Spiel mit zweifelhaften Identitäts-Konstruktionen dann 1993 auf die Spitze. Denn Cambert, die Hauptfigur in "Ich", ist Schriftsteller und Stasi-Spitzel zugleich. Die meiste Zeit befindet sich Cambert wie ein Unterweltsgeist in den Kellergängen Berlins und denkt hier vor allem darüber nach, wie er seine Stasi-Berichte am besten nach Willen seines Vorgesetzten verfassen soll.
Das heißt: Cambert achtet weniger auf das, was sich wirklich ereignet, als darauf, wie er es beschreiben soll.
Die Folge: Der Stasi-Spitzel weiß bald schon nicht mehr so recht, was eigentlich wahrhaftiger ist: Die Realität, wie er sie wahrnimmt, oder die Realität, wie sie in den Stasi-Berichten behauptet wird? Auf diese Weise, so Opitz, wird der Staat DDR in "Ich" selbst zur fiktionalen Erzählung:
"Alles ist Simulation. (...) In den Berichten, die Cambert schreibt, wird eine Realität erschrieben, die sich immer weiter von der Wirklichkeit entfernt. Es handelt sich um ein Konstrukt, das aus Versatzstücken besteht."
Ein bisschen arg detailliert
Es ist nicht leicht, eine Biografie über einen so komplex, anspielungsreich und kompromisslos schreibenden Autor wie Wolfgang Hilbig zu verfassen, der zudem auch noch die deutsche Teilungsgeschichte repräsentiert. Trotzdem würde man sich stellenweise wünschen, dass Opitz etwas mehr Mut zur Lücke gehabt hätte - und etwas weniger detailliert berichten würde. Etwa dort, wo er auch noch die Stadtgeschichte von Meuselwitz von 1139 an bis heute nacherzählt. Oder auch dort, wo er seitenlang darüber spekuliert, ob der Heizer Hilbig womöglich einen Namens-Doppelgänger in seiner früheren Maschinenfabrik kannte.
Solche Nebensächlichkeiten lenken nur ab und stoppen den Erzählfluss unnötig. Zumal andere Informationen fehlen. Beispielsweise die, wie und wo Hilbig eigentlich auf seine Schriftstellerfreunde Gert Neumann und Wolfgang Hegewald gestoßen ist.
Gelegentlicher Kurzschluss von Leben und Werk
Noch fragwürdiger - und vielleicht sogar heikel - wirkt außerdem, wie selbstverständlich der Biograf Opitz immer wieder Leben und Werk Hilbigs miteinander kurzschließt. Sicherlich: Hilbig war ein autobiografisch schreibender Autor. Doch trotzdem kann man seine Texte natürlich nicht wie Tagebuch-Notizen lesen und herbeizitieren.
Trotzdem: Ein wichtiges, lesenswertes Buch
Nichtsdestotrotz ist diese erste umfassende Hilbig-Biografie von Michael Opitz ein wichtiges und lesenswertes Buch, weil sie interessant darlegt, aus welchen Quellen der 2007 an Krebs verstorbene Schriftsteller geschöpft hat. Wie er seine Motive und seine bildmächtige Sprache fand - und wie er beides mit der Zeit weiterentwickelte.
Keine Heiligenlegende
Außerdem begeht Opitz glücklicherweise nicht den klassischen Fehler vieler anderer Biografen: nämlich aus dem Porträtierten einen Heiligen zu machen. Stattdessen wahrt er angenehm Distanz. Und verschweigt auch die menschlichen Schwächen von Wolfgang Hilbig nicht, der nicht nur phasenweise ein schwerer Alkoholiker war und vierzig Zigaretten täglich rauchte, sondern auch ein sehr scheuer, launischer und unpraktischer Mensch.
In Gemeinschaft fühlte sich Hilbig schnell unwohl. Besucher empfand er oft störend. Und die lästigen Haushalts- und Alltagspflichten delegierte er ungeniert an seine Partnerinnen weiter, während er selbst tagsüber schlief, um dann erst nachts, ganz alleine für sich, an seinen Texten zu arbeiten.
Das alles macht diesen Schriftsteller nicht unbedingt sympathisch. Es verdeutlicht aber umso mehr, wie radikal Hilbig sein Leben dem Schreiben unterordnete - und wie unbeirrt er dabei seine außergewöhnlichen Werke erschuf.