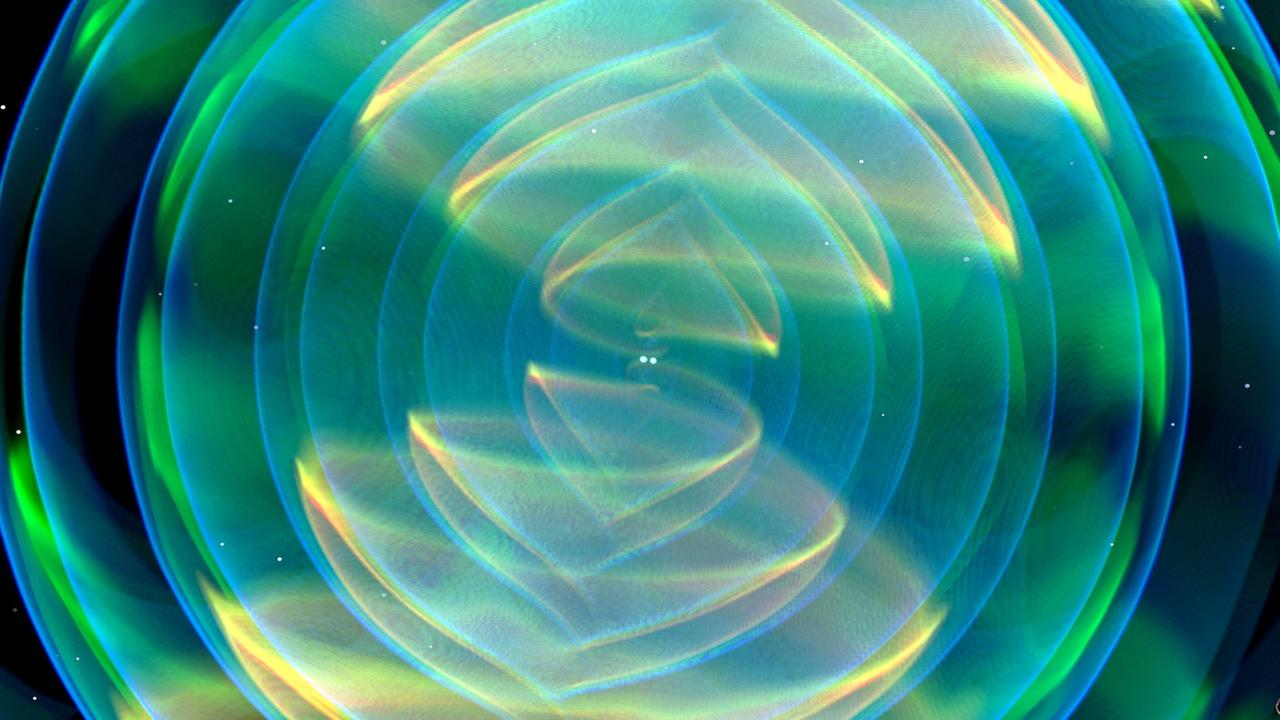Wenn Sie möchten, hören Sie hier die Langfassung des Interviews
Ralf Krauter: Wenn Sie zurückschauen auf das vergangene Jahr, die Max-Planck-Gesellschaft, der Sie vorstehen - 1,63 Milliarden Budget, 84 Forschungsinstitute, 23.000 Mitarbeiter, davon 14.000 im wissenschaftlichen Bereich - was waren 2017 die größten Erfolge der Max-Planck-Gesellschaft?
Martin Stratmann: Das war zunächst mal, aus wissenschaftlicher Sicht, die Entdeckung der Gravitationswellen. Das hat im letzten Jahr große Aufmerksamkeit erregt. Es hat einen Nobelpreis gegeben, es hat für Karsten Danzmann den Körber-Preis gegeben, es hat für Frau Buonanno den Leibniz-Preis gegeben. Das war ein wissenschaftliches Ereignis, wie man es nur alle paar Jahrzehnte auch erleben kann. Das war ein großer wissenschaftlicher Durchbruch.
Krauter: Und Max-Planck-Forscher waren da maßgeblich beteiligt.
Stratmann: Ja, maßgeblich beteiligt.
Krauter: Aber den Nobelpreis haben Sie leider nicht bekommen.
Stratmann: Den Nobelpreis haben wir leider nicht bekommen. Das Zweite klingt ein bisschen trivial: Wir haben ganz tolle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen rekrutieren können, insgesamt 15 im vergangenen Jahr aus Topuniversitäten weltweit. Das ist immer in jedem Einzelfall ein großer Erfolg für die MPG, weil wir leben von diesen Personen. Und zum Dritten – auch für mich persönlich –, das ist der Startschuss der Max-Planck-Schools, ein großer forschungspolitischer Erfolg. Wir haben uns vorgenommen, die besten Wissenschaftler in Deutschland in zukunftsweisenden Gebieten zusammenzubringen, einmal die Konkurrenz untereinander vergessen zu lassen und gemeinsam eine Graduiertenschule zu schaffen, in der die verteilte wissenschaftliche Exzellenz in Deutschland wirklich gebündelt ist. Das war ein großer, auch für mich persönlich großer, Erfolg. Und da sind wir alle sehr stolz drauf.
Krauter: Das greife ich direkt mal auf, weil meine nächste Frage wäre, was waren die größten Misserfolge aus Ihrer Sicht? Das Stichwort Max-Planck-Schools steht da auch auf meiner Liste, weil da draußen entstand auch der Eindruck, dass man da vielleicht so ein bisschen Schiffbruch erlitten hatte. Die Universitäten haben das ja zunächst mal als Konkurrenz zu ihren Graduiertenschulen gesehen und dann letztlich auch Einspruch erhoben. Und die Max-Planck-Gesellschaft konnte sich auch nicht mit der ursprünglich mal erhobenen Forderung durchsetzen, vielleicht das Promotionsrecht für diese Max-Planck-Schools zu erwerben. War das dennoch eine Erfolgsgeschichte?
Stratmann: Nein, nein, das ist auch wirklich in der Tat nicht richtig rübergekommen. Wir wollten nie das Promotionsrecht haben. Die Max-Planck-Gesellschaft ist keine Universität, will keine Universität werden, wir hatten das nie auf unserer Tagesordnung, von Anfang an nicht. Es gibt kein Papier, in dem wir das Promotionsrecht gefordert hätten.
"Am Ende waren alle dafür"
Krauter: Also gab es da Missverständnisse?
Stratmann: Das hat man unterstellt manchmal, aber das war nie so. Dass die Universitäten das kritisch gesehen haben, das habe ich von Anfang an gewusst. Das war, denke ich mal, auch Teil der Diskussionskultur, die man nun mal haben muss, wenn man so etwas noch Ungewöhnliches etablieren möchte, aber ich kann Ihnen sagen: Am Ende waren alle dafür. Es waren alle, auch die Universitäten waren dafür, die Hochschulrektorenkonferenz war dafür, wir haben eine gemeinsame Pressekonferenz gemacht. Unser ursprüngliches Modell ist zu 95 Prozent auch durchgesetzt worden. Der Name Max Planck ist akzeptiert worden. Nein, für mich war das ein großer Erfolg, und wie immer, wenn man um etwas Neues ringt, muss man auch zwischendurch mal akzeptieren, dass es kritische Diskussionen gibt. Ich glaube, das ist ganz normal in einer Demokratie.
"Wir sind immer noch zu sehr unseren eigenen Themen verhaftet"
Krauter: Wenn Sie die Max-Planck-Schools jetzt als erfolgreich an den Start gebracht werten - gab es andere Themen, gab es Misserfolge 2017, die Sie nachträglich bedauern?
Stratmann: Ja, es gibt immer Misserfolge. Ich denke, es gibt zwei Dinge, die ich vielleicht gerne anders gemacht hätte: Zunächst mal ist es so, dass die eine oder andere Berufung nicht geklappt hat. Wir hatten insbesondere für unser Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen einen Plan, das in ein Neuroprothetik-Institut umzuwandeln. Wir hatten Gründungsdirektoren ausgesucht, wir haben verhandelt, leider haben beide Gründungsdirektoren abgesagt, und das war dann schon ein Ärgernis. Aber ich denke, auch hier gibt es einen neuen Plan, den wir derzeit haben, den wir dann auch weiter verfolgen werden.
Das Zweite, was mich auch doch gestört hat: Es ist uns und anderen nicht wirklich gelungen, die Bevölkerung so für Wissenschaft zu begeistern, wie das notwendig wäre. Ich denke, wir sind immer noch zu sehr unseren eigenen Themen verhaftet, wir haben unsere eigene Sprache. Wir haben die Bevölkerung nicht so mitgenommen, wie man das machen muss. Die Kritik, die an Wissenschaft generell geäußert wird, die haben wir nicht wirklich befriedigen können. Und ich denke, das ist auch ein Misserfolg.
Krauter: Sie haben es erwähnt: Die Wissenschaft steckt nach Meinung vieler in so einer Art Glaubwürdigkeitskrise. DFG-Präsident Peter Strohschneider sprach im Juli 2017 in einer viel beachteten Rede von einer Qualitäts-, Vertrauens- und Reproduzierbarkeitskrise. Das Gefühl ist: Viele Menschen hören heutzutage lieber auf ihr Bauchgefühl, pfeifen auf die Expertise der Fachleute, denen viele irgendwie misstrauen. Wie reagieren Sie, wie reagiert die Max-Planck-Gesellschaft auf diese aktuelle Vertrauenskrise, die Sie offenbar selbst auch bemerken?
Stratmann: Zunächst mal muss ich sagen, es gibt nicht nur eine Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise der Wissenschaft. Es ist, glaube ich, eine Glaubwürdigkeitskrise der gesellschaftlichen Eliten ganz allgemein. Das betrifft die Wissenschaft, das betrifft aber auch die Politik, das betrifft Unternehmen und vieles mehr. Es gibt ein mangelndes Vertrauen in Eliten als solche. Aus Sicht der Wissenschaft müssen wir, denke ich mal, vier Dinge tun, und da bin ich mit dem Kollegen Strohschneider völlig einer Meinung: Zunächst mal, wir müssen die Publikationsflut reduzieren. Wir sollten nur noch das publizieren, was wirklich wichtig ist, und wir müssen aufpassen, nicht unser Ansehen nur durch die Menge des Publizierten zu definieren. Die Qualität ist wichtiger als die Menge.
"Wissenschaft darf nie fremdbestimmt sein"
Krauter: Also Klasse statt Masse?
Stratmann: Klasse statt Masse. Das Zweite ist, Wissenschaft muss ehrlicher werden. Wissenschaft im Allgemeinen verkündet keine Wahrheiten, sondern Erkenntnisse auf dem aktuellen Stand des Wissens. Das ist ein Stand, der jederzeit revidiert werden kann. Wir sollten auch nicht der Versuchung erliegen, der Öffentlichkeit Versprechungen zu machen, Krankheiten zu heilen, die wir am Ende nicht halten können. Wir machen viele Erkenntnisse, vieles führt dazu, dass man auf Dauer auch Krankheiten, schwere Krankheiten angeht, dass man neue Verfahren entwickeln kann. Aber meistens ist das nicht so simpel und nicht so kausal. Wir sollten ehrlicher werden.
Drittens, wir müssen Abhängigkeiten vermeiden. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wissenschaft darf nie fremdbestimmt sein, weder von der Politik noch von der Wirtschaft. Ein Problem, das wir zurzeit haben, und das ist auch der Kern der Kritik, denke ich: Es gibt viele, viele Studien, wissenschaftliche, angeblich wissenschaftliche Studien, die bei näherem Hinsehen dann doch qualitativ nicht wirklich einer kritischen Analyse standhalten. Wir müssen Standards definieren, und ich glaube, es wird uns nicht gelingen, Standards der Wissenschaft allgemein zu definieren. Es gibt viel zu viel Wissenschaft. Es muss dann Standards auch von Wissenschaftsorganisationen wie der Max-Planck-Gesellschaft geben. Und für die Max-Planck-Gesellschaft heißt das: Wir müssen in unseren Publikationen höchsten Qualitätsanforderungen genügen. Wir haben es nicht nötig, uns abhängig zu machen, von wem auch immer. Und ich glaube, das muss ein Anspruch der Max-Planck-Gesellschaft sein, den wir täglich leben müssen.
Und das Letzte: Wir müssen uns einem öffentlichen Diskurs stellen - und zwar so, dass die Öffentlichkeit wirklich mitkommt. Und das geht nur durch das persönliche Engagement von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nicht nur durch eine PR-Abteilung. Ich denke, um nur mal einen Namen zu nennen: Wolf Singer ist hier für mich ein herausragendes Beispiel. Wolf Singer ist jemand, der immer wieder sich der Öffentlichkeit gestellt hat, auch wenn seine Tierversuche, die er macht – er macht Experimente mit Primaten –, von Tierschützern angegriffen werden. Er hat sich der Öffentlichkeit gestellt und hat für seine Wissenschaft gerungen und ist für seine Wissenschaft eingestanden. Und das ist, glaube ich, ein Modell, dem wir alle nachfolgen sollten.
Krauter: Wolf Singer – um das nachzuschieben –, der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt, wenn ich es recht weiß.
Stratmann: Ja, so ist es.
"Wissenschaft lebt von dem Unerwarteten"
Krauter: Jetzt haben wir über das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit und Gesellschaft gesprochen. Schauen wir konkret auf die Forschung: Welche Trends, aus Ihrer Sicht, werden das Jahr 2018 prägen, und wie stellt sich die Max-Planck-Gesellschaft auf, um die zu adressieren?
Stratmann: Zunächst mal eine vielleicht triviale Bemerkung: Ganz zu Beginn – und das ist das Schöne an der Wissenschaft –, es wird auch im kommenden Jahr viele Überraschungen geben, die ich zurzeit noch gar nicht kenne. Wissenschaft lebt von dem Unerwarteten. Und Sie sagten schon, wir haben über 20.000 Wissenschaftler in unseren Reihen. Dieses Unerwartete wird uns auch im nächsten Jahr hin und wieder überraschen. Das ist eines der spannenden Elemente jeder Wissenschaftsorganisation. Trotzdem gibt es natürlich große Trends, die man sehen kann, und denen man auch genügen muss.
Das ist zum einen die Digitalisierung der Wissenschaft und nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Wirtschaft. Das ist ein Thema, das eben auch uns nachhaltig verändert. Das betrifft unser Publikationswesen – ich denke an Open Access –, das betrifft das Speichern und Nutzen großer Datenmengen, und es betrifft die Informatik selbst, die ein Treiber dieses Fortschritts ist. Hier muss es uns auch im kommenden Jahr weiter gelingen, Räume zu schaffen, in denen Wissenschaft, Lehre und Industrie sich verdichten. Das haben wir im vergangenen Jahr mit dem Cyber Valley in Stuttgart und Tübingen versucht: Und ich denke, das Cyber-Valley-Projekt wird uns auch im kommenden Jahr sehr beschäftigen. Das ist ein Raum der Verdichtung, in dem gerade Digitalisierung ganz im Zentrum des Interesses steht - und insbesondere Themen wie maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz und ähnliches.
Krauter: Das Cyber Valley, das ist die Region zwischen Stuttgart und Tübingen, –
Stratmann: So ist es.
"Naturwissenschaft und auch Geisteswissenschaft rücken immer näher aneinander"
Krauter: – wo versucht wird, eine kritische Masse kluger Köpfe miteinander zu vernetzen, um in diesem Bereich künftig Maßstäbe zu setzen.
Stratmann: So ist es, und das ist eine Idee, die letztlich auf die Max-Planck-Gesellschaft zurückgeht und die darauf zurückgeht, dass wir ein großes Institut dort im Bereich der Künstlichen Intelligenz seit etwa zehn Jahren aufbauen. Zum Zweiten, zweite große Linie, die ich sehe: Wissenschaft orientiert sich immer weniger an klassischen Disziplinen. Das ist übrigens etwas, was der Max-Planck-Gesellschaft sehr zugutekommt, weil unsere Institute auch nicht klassisch organisiert sind. Ich sehe zum Beispiel, dass Themen zwischen Geistes- und Naturwissenschaften entstehen, die ganz neue Wissenschaftsfelder definieren.
Ein Beispiel dafür ist unser jüngst gegründetes Institut für Menschheitsgeschichte, in dem die Geschichte neu geschrieben wird, weil Naturwissenschaftler mit biologischen Methoden, mit DNA-Sequenzierung und ähnlichen Verfahren sich Themen der Geschichte widmen und auf einmal verstehen, wie in Urzeiten, im frühen Mittelalter, in der Steinzeit sich Menschen bewegt haben, was ihre Bewegungsprofile waren. Und ich denke, dieses völlig neue Verständnis von Geschichte – ist nur ein Beispiel – zeigt, dass Naturwissenschaft und auch Geisteswissenschaft immer näher aneinanderrücken. Und schließlich im nächsten Jahr, ganz konkret: Wir planen die Gründung von zwei neuen Max-Planck-Instituten. Ein Max-Planck-Institut auf dem Gebiet der Cyber-Security und Privacy und ein zweites Institut auf dem Gebiet Origins of Life: Und das letzte Institut, Origins of Life, ist eben ein Thema, das ich ganz spannend finde.
Das ist eines der großen Mysterien der Wissenschaft: Wie entstand und wie entsteht denn überhaupt Leben aus einer unbelebten Ursuppe, in der nur chemische Verbindungen und Moleküle enthalten sind? Sie können an dem letzten Thema erkennen, dass die Max-Planck-Gesellschaft immer noch eines macht: Nämlich ihre Themen primär aus der Wissenschaft selbst zu definieren. Und ich denke, wir sind sehr froh und dankbar, dass uns das auch heute möglich ist.
"Zwei Drittel unserer neuen Aktivitäten entstehen aus altem Bestand"
Krauter: Es gab und gibt ja, glaube ich, bei der Max-Planck-Gesellschaft die Direktive: neue Institute gibt es nur, wenn alte geschlossen werden. Welche zwei wird es denn dann künftig nicht mehr geben?
Stratmann: Wir machen beides. Wir haben ja – das muss ich doch sagen – einen Zuwachs, einen finanziellen Zuwachs, der uns auch erlaubt, Neues zu machen, in Maßen Neues zu machen, und von da aus leben wir von beidem: Von Neugründungen, in denen wirklich ein neues Institut entsteht – und ich denke, in beiden Fällen könnte das so sein –, und wir leben von der Umstrukturierung. Die Menschheitsgeschichte ist aus einem Institut für Ökonomie entstanden. Dieses Institut für intelligente Systeme, das ich eben erwähnte im Rahmen des Cyber Valley, ist entstanden aus einem großen Institut für Metallforschung: Und so würde ich mal sagen, zwei Drittel unserer neuen Aktivitäten entstehen aus altem Bestand, indem wir Dinge umwidmen, und ein Drittel etwa ist echtes Wachstum.
Krauter: Sie haben in einem Positionspapier im Sommer zusammen mit 21 anderen Organisationen aus der Wissenschaft und Industrie von der künftigen Bundesregierung gefordert, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2025 auf 3,5 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen - von derzeit rund drei Prozent. Vereinfacht gesagt heißt das: Sie fordern mehr Geld für Wissenschaft- und Technologieentwicklung. Welche anderen forschungspolitischen Signale erhoffen Sie sich von der neuen Bundesregierung, wie auch immer die dann aussehen mag?
Stratmann: Zunächst mal muss ich sagen: Wir fordern nicht nur einfach mehr Geld, weil jeder mehr Geld fordert, sondern wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Wissenschaft und Innovation der Treiber des Fortschritts in den nächsten Jahrzehnten ist und unser Wohlstand ganz entscheidend davon abhängt, dass wir im Bereich Wissenschaft und Innovation international eine Spitzenstellung einnehmen. Und ich glaube, diese Meinung, die wird auch von der Politik geteilt. Wir haben ja unterschiedlichste Koalitions- und Sondierungsgespräche gehabt im letzten halben Jahr, und bei allen diesen Gesprächen war dieses Dreieinhalb-Prozent-Ziel ein gemeinsames Ziel. Also fast alle Parteien erkennen, dass wenn man nicht in Wissenschaft, Forschung und Bildung investiert, dass man dann wahrscheinlich schlechte Karten hat, im Wettbewerb der Länder um Ressourcen und Fortschritt.
Ich glaube, neben diesem allgemeinen Ziel geht es der Wissenschaft und auch der Bildung natürlich um Menschen. Wissenschaft entsteht ja nicht aus Geld alleine heraus, sondern sie entsteht, weil Menschen mit diesem Geld etwas ganz Tolles anfangen. Das sind hochbegabte, hochmotivierte Menschen, die letztlich den Erkenntnisgewinn vorantreiben. Und es muss deswegen für uns ein Ziel sein, nicht nur für die Max-Planck-Gesellschaft, sondern auch für Deutschland, diese Menschen für Deutschland zu gewinnen. Wir haben bis vor wenigen Jahren immer noch von dem Braindrain gesprochen und haben uns darüber ausgetauscht, dass Menschen Deutschland verlassen, in die USA gehen zum Beispiel. Dieser Braindrain ist aus meiner Sicht Vergangenheit. Ich kann das aus Sicht der Max-Planck-Gesellschaft sagen. Wir reden zurzeit von einem Braingain: Wir gewinnen zwei Drittel unserer Direktoren inzwischen aus dem Ausland. Das heißt, wir haben eine enorme Attraktivität - wir, die Max-Planck-Gesellschaft, aber auch wir in Deutschland. Und diese Attraktivität sollten wir in den kommenden Jahren nutzen, weil auch unsere Konkurrenten schwächeln, Menschen in das Land zu holen: Studenten, Doktoranden, Wissenschaftler. Wir müssen, um das zu erreichen, unsere Hochschulen attraktiver machen. Wir müssen attraktive Stipendienprogramme einführen. Und wir müssen die Internationalität unserer Städte weiter ausbauen. Denn diese Menschen, die zu uns kommen, die brauchen häufig internationale Schulen für ihre Kinder und vieles mehr.
Und letztlich: Ich glaube, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, das klar signalisiert, wenn du nach Deutschland kommst, zum Beispiel als Wissenschaftler, dann würden wir dich auch gerne hierbehalten. Und zwar nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in unseren Unternehmen. Das ist also ein wesentliches Ziel. Und das Dritte, was ich vielleicht noch erwähnen möchte ist Innovation. Wir sprechen hier von Wissenschaft. Die Max-Planck-Gesellschaft macht Erkenntnisse, aber wir müssen, mehr als in der Vergangenheit, aus diesen Erkenntnissen auch wirtschaftlichen Erfolg generieren. Und das hat zwei Facetten für mich: Zum einen sind diese Erfolge, um die es mir eigentlich geht, häufig unerwartet. Das sind unerwartete wissenschaftliche Erkenntnisse, die plötzlich ganz neue Perspektiven eröffnen. Dafür brauchen wir Freiheitsgrade in der Wissenschaft, die uns ermöglichen, diesen unerwarteten Charakter auch ganz nach vorne zu tragen.
Und zum Zweiten: Wir müssen dann sehen, wenn es diese unerwarteten Erkenntnisse gibt, dass man die auch wirklich nutzt. Und wir plädieren für eine Agentur für Sprunginnovationen – auch das finden Sie übrigens zurzeit in den ganzen Koalitionsdiskussionen und Sondierungspapieren –, die genau das zum Ziel hat: nämlich das Unerwartete zu identifizieren und im Sinne der Nutzung auch zu fördern.
Krauter: Da geht es um die viel gepriesenen disruptiven Technologien, die ganz neue Anwendungsfelder eröffnen.
Stratmann: Ja.
Krauter: Um dahinzukommen, müsste man vielleicht auch riskantere Projekte fördern, als das bisher passiert.
Stratmann: Absolut.
Krauter: Sie haben, glaube ich, mal das Vorbild der amerikanischen DARPA ins Rennen geschickt.
Stratmann: Ja.
Krauter: Aber wäre sowas denn in Deutschland überhaupt denkbar?
Stratmann: Also wir haben das sehr intensiv diskutiert in sehr unterschiedlichen Kreisen – mit der Bundeskanzlerin, mit vielen anderen – im vergangenen Jahr. Ich glaube, es ist denkbar. Ich glaube, es arbeiten viele derzeit daran, diese Grundidee in ein Konzept zu überführen, was dann auch tragfähig ist. Wir müssen den Mut haben, Dinge zu machen, die riskanter sind. Wir müssen den Mut haben, auch häufiger Dinge zu machen, die dann doch nicht funktionieren. Aber ich sage auch: Das ist typisch für Wissenschaft. Wenn wir Dinge anfangen in der Wissenschaft, dann klappt das nicht immer, was wir vorhaben. Und das Entscheidende ist, rechtzeitig zu erkennen, wenn etwas nicht funktioniert, und es abzubrechen. Und so muss auch diese Agentur funktionieren. Es muss ähnlich wie Wissenschaft funktionieren: Das Unbekannte wollen, in das Unbekannte investieren, und wenn es nicht funktioniert, möglichst schnell aufhören, damit man nicht Geld investiert in eine Richtung, die am Ende doch nicht trägt.
Ich glaube, dass das nicht trivial ist. Ich glaube, dass das Mut auch in der Politik erfordert. Aber ich glaube, auch die Politik erkennt, dass es ein wesentliches Element der Zukunftssicherung für Deutschland ist. Und vielleicht, wenn ich ein anderes Thema auch noch erwähnen darf, was mir auch ganz wichtig ist: Europa. Wir reden ja nicht nur von Deutschland, sondern wir reden auch von großen Forschungsräumen, die untereinander in Konkurrenz stehen. Das sind im Wesentlichen die USA, Asien und Europa, und unsere Heimat ist Europa. Wir müssen also dafür sorgen, dass Europa stark bleibt, stark wird. Wir werden durch den Brexit erleben, dass im Bereich der Wissenschaft Europa sich neu aufstellen muss. Wir müssen zwischen Großbritannien und dem Rest Europas einen neuen Modus des Zusammenarbeitens finden. Wir müssen in der europäischen Gemeinschaft dafür sorgen, dass Qualitätsanforderungen eine Voraussetzung für Forschungsförderung sind, damit der europäische Forschungsraum am Ende im Wettbewerb mit anderen Großräumen auch bestehen kann.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.