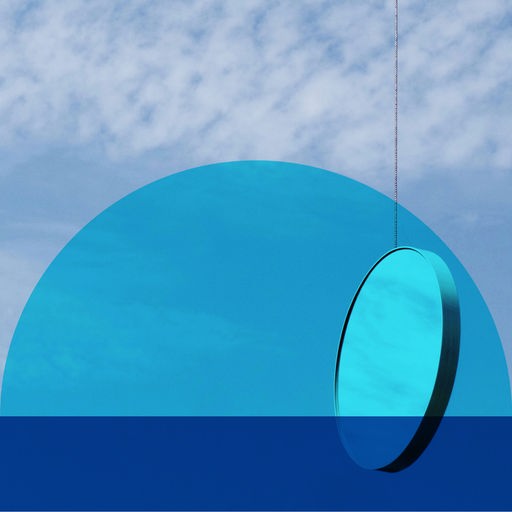Denn die rasante Entwicklung in Kommunikations- und Computertechnologie, die in immer kürzeren Zeitabständen aufeinanderfolgenden Krisen, die sich potenzierenden Risiken unserer Wirtschafts- und Lebensweise lassen eine Reihe von Verdachtsmomenten aufkommen. Dass Neues in die Welt kommt, macht die Antwort zunehmend schwieriger, wie dies geschieht. Zudem: Könnte es nicht sein, dass ausgerechnet der Ursprung des Innovativen sich in völlig unberechenbaren Kategorien wie Unfall, Katastrophen und Zufall abspielt - so wie es beispielsweise das Denken Paul Virilios, Harald Welzers oder Byung-Chul Han nahelegt?
Das würde bedeuten: Die Moderne basiert darauf, eben nicht alles im Griff zu haben. In zwei aufeinanderfolgenden Sendungen der kurzen Serie "Wie kommt das Neue in die Welt?" wird ein Versuch der Würdigung dieses Ansatzes unternommen.
Produktion: DLF 2013
"An manchen Abenden im Jahr quillt selbst aus den solidesten Quartieren der Stadt allerlei Gerümpel heraus - Lumpen, Alteisen, ramponierte Matratzen, Badewannen, Reifen, Bildschirme, Klaviere. Schon sind die Jäger und Sammler unterwegs, Rentner auf dem Moped, Kinder per Fahrrad, Stadtnomaden, die sich mit Entsorgtem versorgen. Bis in die Morgenstunden rumort es in den Straßen, als wäre die öffentliche Ordnung in Gefahr. Ich verlasse mein Gebäude und schaue mich unter dem Sperrmüll um, auf der Suche nach Stücken, die zu keiner Einrichtung passen."
Was der Frankfurter Philosoph Martin Seel hier in seinem 2009 erschienenen Aphorismen-Band "Theorien" beschreibt, erscheint auf den ersten Blick als Relikt unseres evolutionären Erbes: Jäger und Sammler begeben sich abends auf die Jagd nach Brauchbarem unter dem, was andere wegschmeißen. Doch der Denker begibt sich auf die "Suche nach Stücken, die zu keiner Einrichtung passen". Es ist ein Hinweis darauf, wie das Neue in die Welt kommt - im Gegensatz zum mainstream des gängigen Wissenschaftsbetriebs und Krisenmanagements.
Denn nichts scheint in der Neuzeit mit ihrer Innovationsversessenheit, ihrem von dem Philosophen Günther Anders so benannten "Geschehniszwang" wichtiger als eine Metaphysik des Neuen: nicht nur die Herstellung des Niedagewesenen, sondern vor allem der Reproduktionsprozess von immer wieder Neuem soll fass- und nachvollziehbarer gemacht werden. Mit think tanks, brainstorming, Intelligenz- und Exzellenzclustern wird versucht, eine möglichst reibungslose creatio ex nihilo, die Schaffung aus dem Nichts, zu institutionalisieren. Der Zweck: Lösung von Problemen und Vermeidung von Krisen. Resultat ist ein weitgehendes Funktionieren, ein allgemeiner Glaube an Machbarkeit und dem ständigen Zugriff auf Lösungen.
Neues entsteht, so die Grundmelodie der Hypermoderne, weil der denkende und forschende Geist sich in einem Regelwerk organisiert hat, das durch das Festhalten an Ordnung und Methodik wie von selbst Jungfräuliches und Erstmaliges ausspuckt. Die Gebäudemetapher für diese Sichtweise ist die des Labors. Über dessen Eingangstür steht ein über 2.000 Jahre altes Verbot, das das glatte Gegenteil von Martin Seels Sperrmüll-Gleichnis darstellt. Es stammt von Aristoteles und lautet: metabasis eis allo genos - willkürlicher Übergang in eine andere Disziplin. In seiner Wissenschaftslehre notiert er:
"Folglich darf man auch Behufs eines Beweises nicht in ein anderes Gebiet übergreifen. So darf zum Beispiel das Geometrische nicht durch arithmetische Sätze bewiesen werden."
Trennung der einzelnen Disziplinen zur Vermeidung von Denkfehlern
Die klare Trennung der einzelnen Disziplinen zur Vermeidung von Denkfehlern wird hier angeordnet: Ein Biologe kann nicht mit Zellstrukturen argumentieren, wenn es um die Planetenbewegungen geht, ein Physiker nicht mit Bewegungsgesetzen, wo von chemischen Substanzen die Rede ist. Am Anfang wissenschaftlicher Problemlösungsstrategien steht die eindeutige Aufforderung zur Beschränkung. Erfindungen, Einsichten und Erkenntnisse sind das Produkt eines regelgerechten und disziplinierten Verfahrens.
Das Neue kommt nicht wie der Blitz in die Welt, sondern dadurch, dass man ihm hilft zum Vorschein zu kommen: Geordneter Betrieb und Systematik als Garanten der Innovation, Chaosvermeidung sind die Voraussetzungen jeder intellektuellen Leistung. Mehr als zwei Jahrtausende später weist Friedrich Nietzsche darauf hin, dass dieses Programm defizitär ist und einer wichtigen Ergänzung bedarf. Denn es stimmt nur solange, wie Erkenntnis nicht auch als ästhetisches Phänomen und Bedürfnis verstanden wird. Philosophie sei eben nicht nur Wissenschaftslehre, sondern auch Kunst. In seinen nachgelassenen Schriften aus dem Jahr 1872 findet sich der Eintrag:
"Es entscheidet nicht der reine Erkenntnistrieb, sondern der ästhetische. Die wenig erwiesene Philosophie des Heraklit hat einen größeren Kunstwert als alle Sätze des Aristoteles. Man muss beim Denken schon haben, was man sucht, durch Fantasie - dann erst kann die Reflexion es beurteilen. Es ist jedenfalls etwas Künstlerisches, dieses Erzeugen von Formen. Denken ist ein Herausheben. Vielleicht kann der Mensch nichts vergessen. Die Operation des Sehens und des Erkennens ist viel zu kompliziert, als dass es möglich wäre, sie völlig wieder zu verwischen."
Folgt man Friedrich Nietzsches Ausführungen - seine spätere Philosophie wird diese Position noch emphatischer formulieren - dann ist das Labyrinthische, das Ungeordnete Movens des Neuen. Anders als der Wissenschaftler nämlich bekämpft der Künstler weder seine eigenen noch allgemeine Krisen, sondern braucht sie als notwendige Voraussetzung seines Schaffens. Für das Artistische sind Krise, Zuspitzung, mögliches Scheitern und Verwandlung die eigentlichen Bausteine des Neuen. Hinzu kommt ein oftmaliger Rückgriff auf bereits Vorhandenes.
Feuerwehrleute sprechen von Brandnestern, die noch jahrelang nach einem erfolgreichen Löschangriff im Dachstuhl eines Hauses für Gefahr sorgen können. Friedrich Nietzsche selbst ist hierfür ein Beispiel: Sein gesamtes Werk durchzieht die Aktivierung des Brandnestes "vorsokratische Philosophen", die den erkenntnistheoretischen Löschangriff des sokratisch-platonischen Denkens überlebten. Und in der Tat: Erweitert man mit Nietzsche das Blickfeld, so geht für das Erkenntniswesen Mensch nie etwas gänzlich verloren. Immer wieder sind es Splitter von Großtheorien oder vergessenen Ideen, die an die Oberfläche geholt werden. Das Neue ist das Alte, das nicht richtig zum Zug gekommen ist.
Die Ideen- und Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts provoziert zudem die Frage, ob es nicht ausgerechnet die Vermischung von Disziplinen und irrationales Denken ist, wodurch Neues entsteht - und zwar immer dann, wenn eine massive Krise des bisherigen Forschens und Denkens eintritt. Eine Erfolgsgeschichte in dieser Hinsicht ist das Atommodell des dänischen Physikers Niels Bohr. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten Physiker entdeckt, dass Atome Licht aussenden. Dies konnte zwar berechnet werden, doch wie diese Lichtstrahlen entstehen, wusste zunächst niemand. Max Planck postulierte die Existenz von Energiepaketen, später so benannter Quanten, die er jedoch als rein mathematische Größen betrachtete.
Niels Bohr deutete sie dagegen als Qualität von Elektronen, die den Atomkern umkreisten und in der Lage seien, ihre Bahnen durch spontane Sprünge zu verlassen und dabei Energie abzugeben - ohne jede Kausalität und ohne physikalisch fassbar zu sein. Für Niels Bohrs Atommodell gab es keine rational nachvollziehbare Referenz. Stattdessen bereicherte er die Physik um ein irrationales Element - das der akausalen Bewegung. Mit der Kreation des rätselhaften Quantums hatte Niels Bohr ein praktikables Erklärungsmodell für die Stabilität der Materie geliefert.
Zufall und künstlerische Intention
Möglich geworden war ihm dies, weil er mit einem jahrhundertealten Grundsatz, zurückgehend auf den Philosophen und Naturwissenschaftler Gottfried Wilhelm Leibniz gebrochen hatte, und der immer als unabdingbar für alles naturwissenschaftliche Forschen gegolten hatte: natura non facit saltus - die Natur macht keine Sprünge, und deshalb können wir ihre stetigen Bewegungen in Gesetze fassen. Niels Bohr verließ seine Disziplin zugunsten des Zufalls und der künstlerischen Intuition. Sein Konzept des Quantensprungs bedeutet ein wissenschaftliches Unding, denn es ist frei erfunden. In seiner 1969 erschienenen Autobiografie schrieb der lange mit ihm zusammenarbeitende Physiker Werner Heisenberg:
"Es war ganz unmittelbar zu spüren, dass Bohr seine Resultate nicht durch Berechnungen und Beweise, sondern durch Einfühlen und Erraten gewonnen hatte. Bohr benützt die klassische Mechanik oder die Quantentheorie so, wie ein Maler Pinsel und Farbe benützt. Es ist also gar nicht so sicher, dass Bohr selbst an die Elektronenbahnen im Atom glaubt. Aber er ist von der Richtigkeit seiner Bilder überzeugt. Dass es für diese Bilder einstweilen noch keinen sprachlichen oder mathematischen Ausdruck gibt, ist doch gar kein Unglück. Es ist im Gegenteil eine außerordentlich verlockende Aufgabe."
Doch das wesentliche Vermächtnis Niels Bohrs liegt nicht in seinem Atom- oder Quantenmodell, sondern darin, dass er Kunst und Wissenschaft als komplementäre Formen der Erkenntnissuche propagierte. Unter Komplementarität verstand er, dass zu jeder Beschreibungsart eine ergänzende Variante existiert, die an der Oberfläche zwar völlig anders aussieht, die Tiefe eines Phänomens jedoch ebenso ausloten kann. Jede Interpretation ist richtig, keine ist wahr. Nur zusammen ergeben sie ein Bild der Wirklichkeit, dessen Annäherungswert bedeutend höher ist als wenn sie einzeln dastünden.
Im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg sollte sich die volle Gebrauchstiefe von Bohrs Methode des kreativen Durcheinanders erweisen. In dieser Zeit kam es zu einem sprunghaften Anstieg der technologischen Entwicklung, hervorgerufen durch den technologischen Wettlauf während des Kalten Krieges. Im militärischen Bereich tauchten die ersten Computer auf - und damit zwei Größen, die die Entwicklung der nächsten Dekaden prägen sollten: Information und Kommunikation. Wie wird Wissen weitergegeben und verarbeitet, sind diese Prozesse steuerbar? Eine Frage, durch die die bisherige Wissenschaftspflege krisenhaft an ihre Grenzen stieß. Abgeleitet von dem griechischen Wort kybernetes für Steuermann prägte der US-amerikanische Mathematiker Norbert Wiener 1948 den Begriff "Kybernetik". Seinen Bereich definierte er so:
"Unter einer einzigen Überschrift vereinigt er die Erforschung dessen, was in Zusammenhang mit dem Menschen manchmal etwas vage als Denken beschrieben wird und was auf technischem Gebiet als Steuerung und Kommunikation bekannt ist. Mit anderen Worten unternimmt die Kybernetik den Versuch, gemeinsame Elemente in der Funktionsweise automatischer Maschinen und des menschlichen Nervensystems aufzufinden."
Paradigma des systemischen Denkens
Neu war an Norbert Wieners Ansatz vor allem die völlige Suspendierung des aristotelischen Metabasis-Satzes. Die Betrachtung technischer Systeme und lebender Organismen bis hin zu Gesellschaftsformationen wurde nicht in Einzelwissenschaften wie Physik, Biologie oder Soziologie aufgespalten, sondern deren Bausteine wurden auf ihre Brauchbarkeit füreinander abgeklopft. Wieners Behauptung, dass sowohl technische Erzeugnisse als auch lebende Organismen wie Systeme mit Rückkopplungsmechanismen, gegenseitiger Bedingtheit und Energiehaushalt aufzufassen seien, tat ihr Übriges. Wissenschaftler der verschiedensten Sparten fassten Norbert Wieners Schriften als Aufforderung auf, ihre Verscheuklappung abzustreifen und die Früchte der Erkenntnis auch in anderen als den eigenen Gärten zu suchen. Das neue Paradigma des systemischen Denkens wurde geboren - aus dem Geist eines in die Krise geratenen Modells wissenschaftlichen Forschens: Alles hängt mit allem zusammen - auch die unterschiedlichen Herangehensweisen an wissenschaftliche Problemstellungen. So löste die auf Norbert Wiener zurückgehende kybernetische Denkfigur im Bereich der psychotherapeutischen Methodik eine wahre Explosion aus.
Es war vor allem der Anthropologe Gregory Bateson, der in Anlehnung an Wiener seelische Störungen als primär durch die Gleichsetzung von Energie und Information generiert sah. Denn wie in einem physikalischen Gebilde, so sei auch menschliches Miteinander Energieströmen ausgesetzt, die entweder erhaltend oder zerstörend sind. Bateson adoptierte dabei einen Begriff aus dem physikalischen Teilgebiet der Wärmelehre, genauer gesagt deren zweiten Hauptsatz für die Seelenheilkunde: den der negativen Entropie. Besagt der erste Hauptsatz noch, dass ein in Ruhe gelassenes System - beispielsweise ein heißer Topf Suppe auf einem Ofen - seine Energie nicht verlieren kann, geht es bei dem zweiten um deren Verlust.
Treten zufällige Störungen auf, strebt jedes System nach einem energetisch günstigen Zustand. Gas dehnt sich gleichförmig in einem Behälter aus, die heiße Suppe auf dem kälteren Teller wird mit ihm zusammen eine bestimmte gemeinsame Mischtemperatur erzeugen. Mit der Information ist es ähnlich: Jede Aussage einem anderen gegenüber enthält eine Information und gleichzeitig die Verneinung des Gegenteils. "Ich will meinen Urlaub in Island verbringen" schließt einen Strandurlaub auf Mallorca aus - vorausgesetzt, mein Gegenüber akzeptiert die Spielregeln unserer Kommunikation. Tut er dies nicht, treten Störungen im Gesamtsystem auf, zum Beispiel in einer Familie. Dies bleibt solange nicht bedrohlich, wie der Zustand eines Interessenausgleichs, eines Abgleichs der unterschiedlichen energetischen erhalten werden kann. In seiner Aufsatzsammlung Ökologie des Geistes fasst Gregory Bateson die Gleichheit sozialer, biologischer und physikalischer Systeme sowie deren Fähigkeit zur Selbsterhaltung folgendermaßen zusammen:
"Alle biologischen und evolvierenden Systeme (das heißt individuelle Organismen, menschliche Gesellschaften, Ökosysteme) bestehen aus komplexen kybernetischen Netzwerken, und alle diese Systeme teilen gewisse formale Charakteristika. Sie werden durch verschiedene Arten von Regelkreisen im Griff gehalten, um einen Zustand des Fließgleichgewichts zu erreichen. Solche Systeme sind homöostatisch, das heißt die Auswirkungen kleiner Veränderungen der Eingabe werden negiert und der Zustand des Fließgleichgewichts wird durch reversible Anpassung beibehalten."
Systemerhaltung als Reaktion auf Krisen innerhalb dieses Gefüges - die Parallele zur gegenwärtigen Finanz- und Bankenkrise drängt sich auf. Denn trotz der enormen Belastungen für die Staatshaushalte und damit der Steuerzahler, trotz der tickenden Zeitbombe weiterer Desaster vom Kaliber Lehmann-Brothers oder Griechenland wird die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Systemänderung nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Statt dem Turbokapitalismus die Zähne zu ziehen, ist von Regulierung, Kanalisierung und Zügel anlegen die Rede. Das reibungslose Funktionieren des Gesamtsystems Finanzwesen, die Erhaltung seines Fließgleichgewichts, wird immer wieder aufs Neue durch die Verfolgung eines neurotischen Prinzips erreicht: mehr desgleichen.
Während Staaten, die unter normalen Umständen schon längst zahlungsunfähig wären, mit Milliardenspritzen im künstlichen Koma gehalten werden, gehen bankrottgefährdete Kleinbanken leer aus, da sie nicht "systemrelevant" sind. Erstaunlich ist dabei, dass sich die gegenwärtige Krise von allen vorhergegangenen dadurch unterscheidet, dass sie sich althergebrachten und nachvollziehbaren Erklärungsmustern entzieht. Denker der französischen Postmoderne wie Paul Virilio oder Jean Baudrillard reagierten bereits in den 1990er-Jahren auf das neue Gesicht solcher Krisen mit einer völligen Ablehnung rein ökonomischer Erklärungsmuster. Vielmehr seien Bankenabstürze und Börsenkatastrophen auf eine Veränderung in unserem Wirklichkeitsbild zurückzuführen. Theoretisch fruchtbar wird diese Behauptung, wenn man sich den computerisierten Devisen- und Aktienhandel ansieht: Er bewegt sich in einer virtuellen Realität, ohne jeden Bezug zu tatsächlichen Werten.
Krisen ohne Entwicklung von Neuem
Deshalb lässt sich mit der Vermutung experimentieren, dass alle Beschreibungsmuster, Schadensbeschreibungen und Lösungsansätze zum Scheitern verurteilt sind, solange sie dieser Virtualität nicht Rechnung tragen. Dennoch kann der seltsame erkenntnistheoretische Fall, dass durch Krisen ausnahmsweise nichts Neues entsteht, zumindest verständlicher werden. Nämlich dann, wenn man akzeptiert, dass es hier noch nicht einmal um das Herrschen eines irrationalen Prinzips geht, sondern dass eine Realität schlichtweg nicht vorhanden ist. Jean Baudrillard sprach 1995 in diesem Zusammenhang von einem "perfekten Verbrechen": Es sei nicht aufzudecken, weil im herkömmlichen Sinne weder ein manifester Täter noch eine ihm zuschreibbare Tat existiere.
"Das perfekte Verbrechen ist das einer uneingeschränkten Realisation der Welt durch Aktualisierung aller Daten, durch Transformation all unserer Handlungen, aller Ereignisse in reine Information. Die vorzeitige Auflösung der Welt durch Klonung der Realität und Vernichtung des Realen durch sein Double. Die Abwesenheit der Dinge von sich selbst, die Tatsache, dass sie nicht stattfinden, obwohl sie so tun als ob, die Tatsache, dass alles sich hinter seinen eigenen Schein zurückzieht, und deshalb nie mit sich selbst identisch ist, darin liegt die materielle Illusion der Welt."
Klonung der Realität - ganz von der Hand zu weisen scheint das nicht zu sein. Vor allem, wenn man sich ansieht, was am Beginn der Wirtschaftskrise in den USA geschah. Es wurden Kredite an Menschen vergeben, die definitiv nicht in der Lage waren, sie zurückzuzahlen. Diese Schuldverschreibungen wurden dann von den Kreditgebern an Interessenten weiterverkauft. Und von diesen wiederum in Pakete geschnürt, die nochmals weiter veräußert wurden - bis schließlich die Blase irgendwann platzte. Das Verschwinden der handfesten Wirklichkeit wird in dieser Krise besonders deutlich. Schätzungsweise werden pro Tag an die 50 Billionen US-Dollar rund um den Globus geschickt - wovon noch nicht mal ein Prozent gebraucht wird, um reale Rechnungen zu bezahlen.
Wir operieren also mit etwas, dass gleichzeitig existent und nicht existent ist. Und das geschieht auch in einem größeren Maßstab. Paul Virilio äußerte in einem 1990 erschienenen Essay einen Gedanken, den er als "rasenden Stillstand" bezeichnete. Wegen der ungeheuren Beschleunigung sozialer und ökonomische Vorgänge wird die Welt zunehmend unkontrollierbar. Die hohe Geschwindigkeit, mit der wir leben, täuscht darüber hinweg, dass wir uns in einem Stillstand befinden, wir reagieren nur noch auf die Beschleunigung, statt sie zu kontrollieren. Virilio bezog sich damals auf die Einführung des computerisierten Börsenhandels, des sogenannten program tradings, das im Jahr 1987 einen Aktiencrash nach sich zog.
"Glaubt man, dass das berühmte program trading der Finanzplätze London und New York nur die Ökonomie der Erde, nur die automatische Notierung der Börsenwerte betrifft? Welch ein Irrtum! Die Implosion der Realzeit bedingt von nun an die Gesamtheit des Austauschs und die Erfahrung des von der Computertechnik verursachten Börsencrashs im Jahre 1987 ist nur das Vorzeichen für andere ökonomische Katastrophen, vor allem aber ist sie das Vorzeichen für die Vielzahl der dramatischen Brüche im Bereich des sozialen Austauschs und der sozialen Kommunikation."
Es herrscht ein System der Regellosigkeit. Regulationsmaßnahmen wären also vor diesem Hintergrund, wie wir ihn jetzt erleben und wie er wohl auch noch einige Jahre bestehen wird, sinnlos - und deshalb sollten wir uns in Zukunft immer stärker auf den Einbruch des Unvorhersehbaren einrichten. Mit dieser Regellosigkeit haben wir es seit Entstehung des sogenannten Neuen Marktes an den Börsen zu tun. Ende der 80er-Jahre entstanden Firmen, die keinen realen und messbaren Warenhintergrund mehr hatten, sondern nur noch reine Spekulationsobjekte für Börsenanleger waren.
Damit wurde ein wesentliches Kriterium des Aktienmarktes außer Kraft gesetzt: Jedes Wertpapier muss eine Deckung haben; ein Konzern, der unbrauchbare Produkte herstellt, wird auch schwache Aktien besitzen. Die Aktien des Neuen Marktes repräsentierten jedoch keine Produkte im herkömmlichen Sinne. Der Börsencrash von 1987, der in der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen wurde, gab Jean Baudrillard den Anlass für eine damals abenteuerlich anmutende Behauptung: In seinem Buch Die Transparenz des Bösen sagte er, dass die bei dem Crash entstandenen Schulden einfach in eine Umlaufbahn geschossen worden wären, in der Hoffnung, sie würden dadurch von selbst verschwinden. Baudrillard nahm eine Analogie zum Giftmüll vor, der auch von einem Lager zum nächsten weitergereicht - dadurch allerdings nicht weniger giftig wird.
"Wenn die Schulden zu hinderlich werden, stößt man sie ab in den virtuellen Raum, wo sie die Form einer eingefrorenen Katastrophe auf der Umlaufbahn annehmen. Die Schulden werden zu einem Satelliten der Erde wie die Milliarden Dollar flottierenden Kapitals Satellitenansammlungen geworden sind, die uns unablässig umkreisen. Und es ist sicherlich besser so. Denn die Hoffnung, die fiktive und reale Ökonomie zu versöhnen, ist utopisch. Diese flottierenden Dollarmilliarden sind nicht in reale Ökonomie umwandelbar - glücklicherweise übrigens. Denn wenn man sie auf wundersame Weise in die Produktionsökonomie zurückfließen lassen könnte, hätten wir damit die wahre Katastrophe. Gewöhnen wir uns daran, im Schatten dieser Auswüchse zu leben: Finanzspekulation, Weltschuld."
Gewöhnung statt Transformation
Gewöhnung statt Transformation oder Veränderung: Es ist das Charakteristikum postmodernen Denkens, sich von lösungsorientierten Deutungsangeboten endgültig verabschiedet zu haben. Die Denkfiguren von Jean Baudrillard oder Paul Virilio sind ernüchternd: Neues kann es nur noch in immer originelleren Formen der Beschreibung geben, die auf immer neue anfallartige Steigerungen einer bereits bestehenden Krankheit reagieren. Die Entstehung des Neuen scheint durch das blockiert zu werden, was in der Soziologie mit dem Terminus shifting baselines belegt wird.
Er beschreibt das langsame Anwachsen einer zunächst geringen Belastung oder Zumutung, die sich im Laufe eines langen Zeitraums zu einem ausgewachsenen Problem entwickelt, das schwer zu beseitigen ist. Hätten wir unsere Klimaschutzbestimmungen vor 60 Jahren erlassen, gäbe es in dieser Größe den Wirtschaftszweig Umwelttechnologie heute wahrscheinlich nicht. Dass die Beantwortung der Frage, wie Neues im Sinne von Rettendem in die Welt kommt, zu einem großen Teil ausgerechnet von der Ökologie erwartet wird, mutet fast wie ein Überforderungsszenario an. Unter den Wissenschaften scheint sie zu einem wahren Hoffnungsträger geworden zu sein - obwohl sie eine der jüngsten ist.
Sieht man am Ende dieser Betrachtungen über die Entstehung des Neuen noch einmal mit der Brille von Niels Bohr auf die Brandnester unserer Zeit, zeigt sich eines: komplementäres Denken, das ergänzende Nebeneinander unterschiedlicher Lösungsansätze ist heute in der Versenkung verschwunden. Um beispielsweise die Folgen der Klimakatastrophe zu bändigen, ja sie überhaupt erst angemessen zu beschreiben, werden vornehmlich die Naturwissenschaften herangezogen. Die Krise unserer Ökosysteme, so die Botschaft, sei nur durch die Intensivierung wissenschaftlich-technischer Bemühungen zu meistern. Je mehr Geld in die Entwicklung erneuerbarer Energien, besserer Müllverbrennungsanlagen oder leistungsfähigerer Deiche und Dämme gesteckt werde, desto wahrscheinlicher sei es, dass Südseeinseln oder Grönland auch noch in 50 Jahren in der heutigen Größe existierten.
Die immensen intellektuellen Möglichkeiten, von der Menschheit in den letzten 300 Jahren in mühevoller Arbeit angehäuft, versprechen ihr nach wie vor Macht über die Natur und nähren damit den Alleinvertretungsanspruch ihrer Wahrnehmungsweise. Der Blick für andere Lebenswelten, zum Beispiel die der Pflanzen oder Tiere ist verstellt. Die Mitwelt, von der wir abhängen, wird zur bloßen Ressource, bestenfalls noch zur Umwelt, die es zu schonen gilt.
René Descartes und Francis Bacon
Zwei Prämissen, aufgestellt im 17. Jahrhundert von René Descartes und Francis Bacon, machten diese fatale Optik überhaupt erst möglich: zum einen eine wissenschaftliche Methodik, die das Ich außerhalb der zu erforschenden Welt sieht. Und zum anderen: Je distanzierter sich der Betrachtende zu seinen Objekten verhält, je mehr er sich in die Beziehungslosigkeit treibt, desto erfolgversprechender sind seine Operationen.
Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts fiel einigen Theoretikern auf, dass ein solches Verhalten in auffälliger Weise an schwere Störungen im Bereich der Selbst- und Fremdwahrnehmung erinnert. Nur das diesmal nicht der einzelne Kranke auf die Couch oder in die Psychiatrie gehörte, sondern die gesamte Lebensweise der Industrienationen. Einer dieser Denker war der US-amerikanische Psychohistoriker Theodor Roszak. In seinem mittlerweile zum Klassiker gewordenen Buch Öko-Psychologie heißt es:
"Vernünftige Umweltpolitik bedarf einer neuen psychologischen Sensibilität, einer Fähigkeit, mit dem dritten Ohr auf die Leidenschaften und Sehnsüchte zu lauschen, die den scheinbar gedankenlosen ökologischen Gewohnheiten unserer Kultur zugrunde liegen. Es muss irgendeinen Grund dafür geben, dass sich Menschen dafür entschieden haben, die wahnsinnige Vernichtung ihres eigenen Planeten zu betreiben. Die Veränderung der Wahrnehmungen auf der tiefsten persönlichen Ebene ist für die Bewältigung unserer ökologischen Krise genauso wichtig wie jede denkbare Wirtschaftsreform."
Wie also kommt das Neue in die Welt? Unter anderem durch die Notwendigkeit, auf eine wie auch immer sich darstellende Krise zu reagieren. Hinzu kommen die Freiheit der Methodenwahl, die Ablehnung jeder Art von Denkverbot und das Vertrauen in die Zielgenauigkeit von Blindflügen.