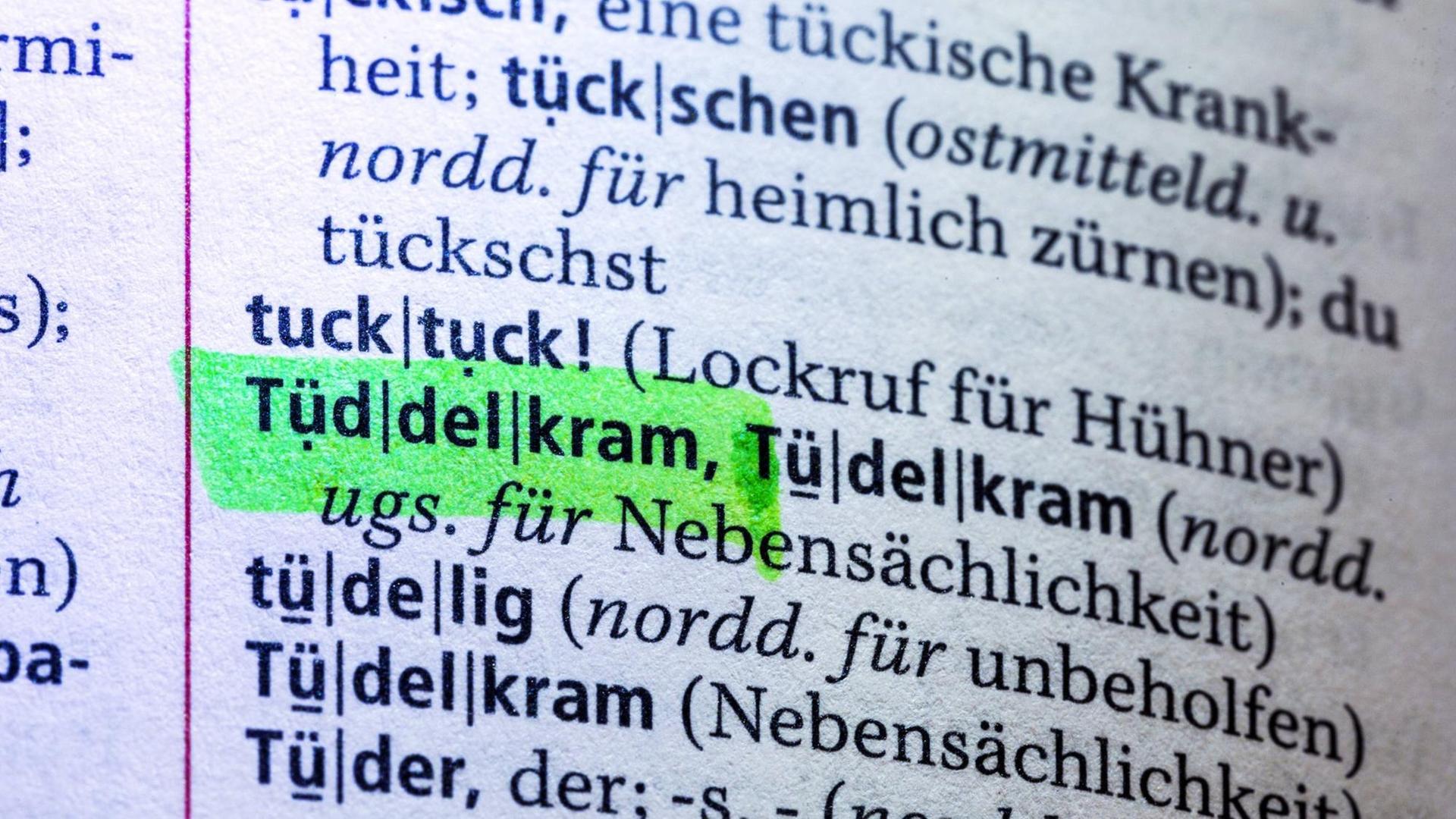
Vor wenigen Tagen machte ein eher unbekanntes Wort Furore: "I bims". Klingt seltsam, wurde aber von einer 20-köpfigen Jury des Langenscheidt-Verlags zum Jugendwort 2017 gekürt. "I bims" – übersetzt bedeutet es "ich bin" oder "ich bin's" – entstammt der Vong-Sprache, die seit 2010 vor allem im Internet Verbreitung findet. Sie lebt von Wortspielen, verkürzten Sätzen, Anglizismen, außerdem nimmt sie grammatikalische Fehler auf die Schippe. Ein Beispiel: "Das Wetter ist schön vong Sonne her." Wie gesagt, das klingt seltsam, zählt aber zur deutschen Sprache, genauer zur Jugendsprache, die der "Zweite Bericht zur Lage der deutschen Sprache" natürlich auch behandelt. Herausgegeben haben den Bericht die "Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung" und die "Union der deutschen Akademien der Wissenschaften". Nun wäre der Bericht unvollständig, würde er nicht auch Grundsätzliches thematisieren. Und dazu zählt eine ebenso schlichte wie schwierig zu beantwortende Frage: Was zählt eigentlich alles zur deutschen Sprache?
"Wenn man das so einfach sagen könnte! Es gibt eigentlich zwei wichtige Begriffe der deutschen Sprache", sagt Professor Wolfgang Klein, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik im niederländischen Nijmegen und Vizepräsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Ein Bündel von Varietäten
"Das eine ist das, was man so manchmal Hochsprache nennt, manchmal auch Hochdeutsch, was kein guter Ausdruck ist, oder auch Standardsprache, das ist das Deutsch, was man heute in den Schulen lernt, wie es in der geschriebenen Sprache verwendet wird, wie es auch bei den Rundfunknachrichten gesprochen wird oder von uns beiden im Augenblick gesprochen wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die ganze Fülle an verschiedenen Formen des Deutschen. Erstens mal gibt es historische Sprachstufen, also das Althochdeutsch, das ja auch deutsch ist, das versteht heute außer Experten eigentlich niemand mehr, es gibt viele Dialekte, es gibt Jugendsprache, es gibt Sprache von Migranten, es gibt dann Fachsprachen und so weiter und so fort. Das Deutsche ist eigentlich ein Bündel von Varietäten, also von Spielarten und Ausprägungen. Die deutsche Standardsprache ist eine davon, die wichtigste, aber eine davon."
Historisch hat sich die deutsche Sprache aus dem Indogermanischen entwickelt, genauer aus dem Westgermanischen. Die Geburt des Deutschen datieren Wissenschaftler auf das Jahr 800 nach Christi Geburt, als auf die Zeit Karls des Großen. Einheitlich war das Deutsche damals natürlich nicht.
"Deutschland hat zu der Zeit größtenteils aus Wäldern und Sümpfen bestanden, also das, was wir heute als Deutschland beschreiben, und dazwischen gab es einzelne Dörfer und einzelne Kontakte, Städte und sowas gab es da einfach noch nicht. Das heißt, die Leute haben in verschiedenen Gegenden ganz anders gesprochen. Es gab also von Anfang an eine ganze Reihe von Dialekten und nicht ein einheitliches Deutsch."
Bestrebungen der Vereinheitlichung
Natürlich gab es im ausgehenden Mittelalter und der Renaissance Bestrebungen, das Deutsche zu vereinheitlichen. Martin Luther darf nicht unerwähnt bleiben, ebenso der Buchdruck, der es möglich machte, Texte in die letzten deutschsprachigen Winkel zu transportieren. Überhaupt spielten Medien bei der Vereinheitlichung eine zentrale Rolle. Den Durchbruch schafften aber erst im 20. Jahrhundert die Elektronischen Medien. Rundfunk und Fernsehen waren und sind seit knapp 100 Jahren omnipräsent und legten binnen weniger Jahrzehnte die Standardsprache fest. Auf der einen Seite war das ein Gewinn, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft sind auf reibungslose Kommunikationsformen angewiesen. Auf der anderen Seite sieht Wolfgang Klein den damit einhergehenden Bedeutungsverlust von Dialekten aber auch mit einem weinenden Auge.
"Ich finde es eigentlich sehr, sehr traurig, dass Dialekte zunehmend weniger gebraucht werden, und ich liebe es, Dialekt zu reden, weil es, ja, es gibt ein Gefühl der Heimatverbundenheit, der Vertrautheit, der Kindheit, die damit verbunden ist."
Die Zahl der Dialekte und regionalen Sprachfärbungen lässt sich kaum ermitteln, teilweise verändert sich die Aussprache von Dorf zu Dorf. Allerdings ist nicht alles, was Menschen in Bayern und Baden-Württemberg, Sachsen und Ostfriesland sprechen, Dialekt. Sprachwissenschaftlich – so Professor Jürgen Erich Schmidt, Direktor des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas, Marburg, sind Dialekte:
"Diese alten Formen, die 1500 Jahre alt sind, die so alt sind, wie unsere Sprache selbst und die normalerweise nicht verstanden werden. Die haben also einen Radius von etwa 40 bis 100 Kilometern, und dann verstehen auch Dialektsprecher die Dialekte nicht mehr."
Regiolekte und Schriftsprache
Neben diesen alten Sprachvarietäten, die es natürlich auch heute noch gibt, haben sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts Regiolekte oder regionale Umgangssprachen entwickelt. Dieser Prozess erforderte erstens eine Schriftsprache, die spätestens mit dem Buchdruck Verbreitung fand; und zweitens die Bereitschaft, diese Schriftsprache nach den Regeln alter Dialekte zu sprechen.
"Und dieses Sprechen nach der Schrift mit den Lautregeln der Dialekte, das ist das, was man als landschaftliches Hochdeutsch bezeichnet, und das war bis etwa 1900 die einzige Form des Hochdeutschsprechens."
Eine Reise quer durch Deutschland war vor 150 Jahren kommunikationstechnisch eine Herausforderung. Und würde es die Standardsprache "Deutsch" nicht geben, hätte sich daran nichts geändert.
"Wir haben heute eine Regionalsprache, die aus zwei gesprochenen Varietäten besteht. Das eine sind die fortlebenden alten Dialekte, die gibt es immer noch, und das andere ist das, was mal landschaftliches Hochdeutsch war, also diese regionalen Umgangssprachen, diese Regiolekte. Und die werden eben heute nicht mehr als Hochdeutsch akzeptiert, da hat ein gewaltiger Umwertungsprozess stattgefunden."
Besserer Vertrauensverhältnis
Ohne das Standarddeutsch geht es nicht, seine Rolle ist unangefochten. Und doch bieten Dialekte und Regiolekte erstaunliche Vorteile. Sprecher derselben Regionalsprache etwa, so Jürgen Erich Schmidt, haben ein besseres Vertrauensverhältnis zueinander, weil sie die Emotions- und Beziehungssignale des Gesprächspartners verstehen.
"Ich selbst komme aus dem Kölner Raum, aus der Eifel, dort sprechen wir beispielsweise Tonakzente, das heißt, wir können Wörter, wie das etwa im Chinesischen auch ist, nur durch den Tonhöhenverlauf unterscheiden, und solche kleinen Tonmodulationen, die einfach eine zusätzliche linguistische Unterscheidungsmöglichkeit darstellen, die werden von Sprechern anderer Varietäten als Emotionssignale interpretiert, und das ist natürlich nicht adäquat. Sprecher, die denselben Regiolekt sprechen, verstehen sich auch auf dieser emotionalen und auf der Beziehungsebene."
Regiolekte und Dialekte geraten zunehmend in die Defensive. Wer ausschließlich Dialekt spricht, befindet sich häufig in einer beruflichen Sackgasse. Trotzdem plädiert Jürgen Erich Schmidt für die Pflege von Dialekten.
"Wenn Sie etwa die wunderbaren Romane von Ulla Hahn nachlesen, da können Sie genau sehen, welche Rolle der Dialekt in einer Welt spielt für Menschen, die eben nur den Dialekt sprechen. Das haben wir heute nicht. Alle Sprecher des Deutschen, praktisch alle, sind mit zwei Varietäten groß geworden und die Standardsprache ist die dominante Varietät, das heißt, die wird sowieso erworben über die Medien, über die Schule. Wenn wir unseren Kindern was Gutes tun wollen, dann lassen wir die alten Formen weiterleben!"
"Fly sein", "Smombie", "Babo", "Yolo", "Niveaulimbo"
Von Kindern und Jugendlichen "sowieso erworben" wird noch eine weitere Varietät des Deutschen: die Jugendsprache. Und die ändert sich rasend schnell. "I bims" ist wie schon erwähnt das Jugendwort 2017. In den Jahren davor wurden "Fly sein" ausgewählt, "Smombie", "Babo", "Yolo", "Niveaulimbo" und "Gammelfleischparty". Alles Begriffe, mit denen ältere Menschen kaum etwas anfangen können. Was ja durchaus Sinn macht, mag mancher denken, Jugendsprache ist Jugendlichen vorbehalten, die sich zudem in einer unangepassten Lebensphase befinden.
"Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben", gibt allerdings Dr. Nils Bahlo, Sprachwissenschaftler an der Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster, zu bedenken. "Es mag sein, dass die Jugendphase in gewisser Weise mehr Freiräume lässt und es auch um das Ausprobieren, Austesten von Grenzen, Normen und Werten geht, also um ein Identitätsfinden, aber dass die Jugend nicht angepasst ist, das würde die Forschung so nicht unterstützen. Wir wissen zumindest aus den Shellstudien seit ungefähr 85, dass die Jugend sich doch mehr an der Werten und Normen ihrer Eltern orientiert, als es so den ersten Anschein hat."
Hinzu kommt, dass das Phänomen "Jugendsprache" keineswegs für alle Jugendlichen Bedeutung hat. Einige können mit Begriffen "I bims" etwas anfangen, andere schütteln bei der "Gammelfleischparty" verständnislos den Kopf. Ein Grund dafür ist, dass die Jugendsprache ja nicht nur entsteht, weil es Jugendliche gibt. Wie bei der Entwicklung jeder anderen Sprachvarietät spielen vier Faktoren eine Rolle.
"Das ist zum großen Teil der Raum, in dem gesprochen wird, die Region könnte man auch sagen, es ist die Situation, die einen ganz gewaltigen Einfluss auf den Sprachgebrauch hat, das heißt, in einem Vortrag würde ich mich anders verhalten sicherlich als in einem Gespräch mit meinen Freunden sprachlich, es ist die Zeit, 1900 hat man anders gesprochen als 2007, und es ist sicherlich auch ein Stückchen weit das Milieu, früher hat man gesagt, die Schicht, aber von dem Schichtgedanken sind wir weg, das heißt, wir sprechen von Milieus, von Gruppen, die sich zu irgendetwas zugehörig fühlen, und da gibt es nicht nur eine Gruppe oder ein Milieu, sondern ganz viele dann."
Ein irreführender Begriff
Was auch bedeutet: Der Begriff "Jugendsprache" ist irreführend! Es gibt nicht nur eine Jugendsprache, sondern viele. Wobei der Münsteraner Sprachwissenschaftler Nils Bahlo "Jugendsprache" durch "Stile" ersetzen möchte. Und mit der jährlichen Suche des Langenscheidt-Verlages nach coolen Jugendwörtern können Sprachwissenschaftler ebenfalls nur wenig anfangen. Ein überzeichneter Sprachgebrauch sei das, der allenfalls einige wenige Nutzer betrifft. Gleiches gilt für das sogenannte Kiezdeutsch, bei dem mit Vorliebe Präpositionen wegfallen: "Ich mach Dich Messer", oder "Ich steh rote Ampel". Wichtiger ist für Nils Bahlo der Bildungshintergrund von Kindern und Jugendlichen, wobei er allerdings auch da zur Vorsicht mahnt.
"Man muss sich das so vorstellen, dass nicht nur die Bildung für das verantwortlich ist, was wir so von uns geben als sprachliche Produktion. Es gibt genügend Hauptschüler, die ein lupenreines Deutsch sprechen, und es gibt genügend Gymnasiasten, die sich sprachlich anpassen, um cool zu sein. Die Variationsfreude ist in jugendlichen Stilen sehr, sehr groß. Jugendliche beherrschen mehr als nur einen bestimmten Code, könnte man sagen, sie passen sich sprachlich. Das mag sicherlich sein, dass es dem einen besser gelingt, der anderen wieder schlechter."
Vergleichsweise ähnlich müsste die Situation bei der internetbasierten Kommunikation sein, immerhin tummeln sich viele Kinder und fast alle Jugendlichen in den Sozialen Medien. E-Mail, Twitter und Co. sind für sie Alltag. Angelika Storrer, Professorin für Germanistische Linguistik an der Universität Mannheim, hat sich für den "Zweite Bericht zur Lage der deutschen Sprache" mit diesem Thema beschäftigt.
"Linguistisch interessant ist, dass sich dabei eine neue interaktionsorientierte Haltung zur Schriftsprache herausbildet, und diese neue Haltung unterscheidet sich in vielen Merkmalen vom Verfassen redigierter Schrifttexte, also vom textorientierten Schreiben, wie wir das aus dem journalistischen Schreiben, aus dem wissenschaftlichen Schreiben und auch aus der Belletristik kennen."
Internetbasierte Kommunikation
"Interaktionsorientierte Haltung" bedeutet, jemand schreibt, der Angeschriebene antwortet sofort beziehungsweise zeitnah. Diese Form internetbasierter Kommunikation sind Chats, die Angelika Storrer unter die Lupe genommen hat. Unter die Lupe genommen hat sie darüber hinaus die Diskussionsforen von Wikipedia.
"Was man generell zeigen kann an diesen Formen, ist, dass im interaktionsorientierten Schreiben die Schnelligkeit der Reaktion oft wichtiger ist, als die geschliffene Formulierung. Das ist ganz wichtig, wenn man die schriftlichen Produkte von Chats bewertet. Es ist auch wichtig, zu betrachten, wer mit wem chattet, also Umgangssprache in der Kommunikation mit Freunden und Familie ist durchaus angemessen, und es gibt in allen Formen auch immer Beispiele, in denen bewusst von Orthografie und Grammatik abgewichen wird, also Dialektschreibungen, bewusst eingebaute Rechtschreibfehler, die verschiedenste soziale Funktionen haben, zum Beispiel aufzufallen, sich interessant zu machen, in einem Chatraum Kontakte zu knüpfen, da haben wir Beispiele auch in unseren Daten."
Parallelen zur Jugendsprache sind unverkennbar, trotzdem zählt Chatkommunikation nicht dazu. Vor allem ist internetbasierte Kommunikation keine Kommunikation zweiter Klasse – so Angelika Storrer:
"Die neuen interaktionsorientierten Schreibformen sind einfach in ganz anderen Bereichen angesiedelt, im alltagssprachlichen Bereich, im informellen Bereich. Sie erweitern eigentlich unser Spektrum der kommunikativen Möglichkeiten. Das normkonforme textorientierte Schreiben wird dabei nicht ersetzt, sondern ergänzt."
Stirbt die deutsche Sprache aus?
Der "Zweite Bericht zur Lage der deutschen Sprache" zeichnet ein weitgehend positives Bild. Deutsch zählt zu den bedeutendsten Kultursprachen der Welt, Sprachvarietäten wie Regio- und Dialekte sind eine Bereicherung, gleiches gilt für die Jugendsprache und die internetbasierte Kommunikation. Niemand müsse – bezogen auf die Entwicklung des Deutschen – Angst vor Migranten haben, auch ihr Einfluss auf die deutsche Sprache ist fruchtbar. Steht also alles zum Besten um das Deutsche? Fast. Weit in der Zukunft sieht Wolfgang Klein dunkle Wolken.
"Ich habe über längere Zeit ein Forschungsprojekt am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen geleitet, das befasste sich mit der Dokumentation bedrohter Sprachen. Und von den 7.000 Sprachen verschwinden immer mehr, weil die Sprecher entweder aussterben oder sich anderen Sprachen zuwenden. Das Deutsche hat als schätzungsweise 100 Millionen Sprecher, da ist das nicht unmittelbar bedroht, aber es geht als internationale Sprache schon ganz, ganz deutlich zurück, und es würde mich nicht wundern, wenn das Deutsche in sagen wir mal in zwei-, dreihundert Jahren eine ausgestorbene Sprache wäre."


