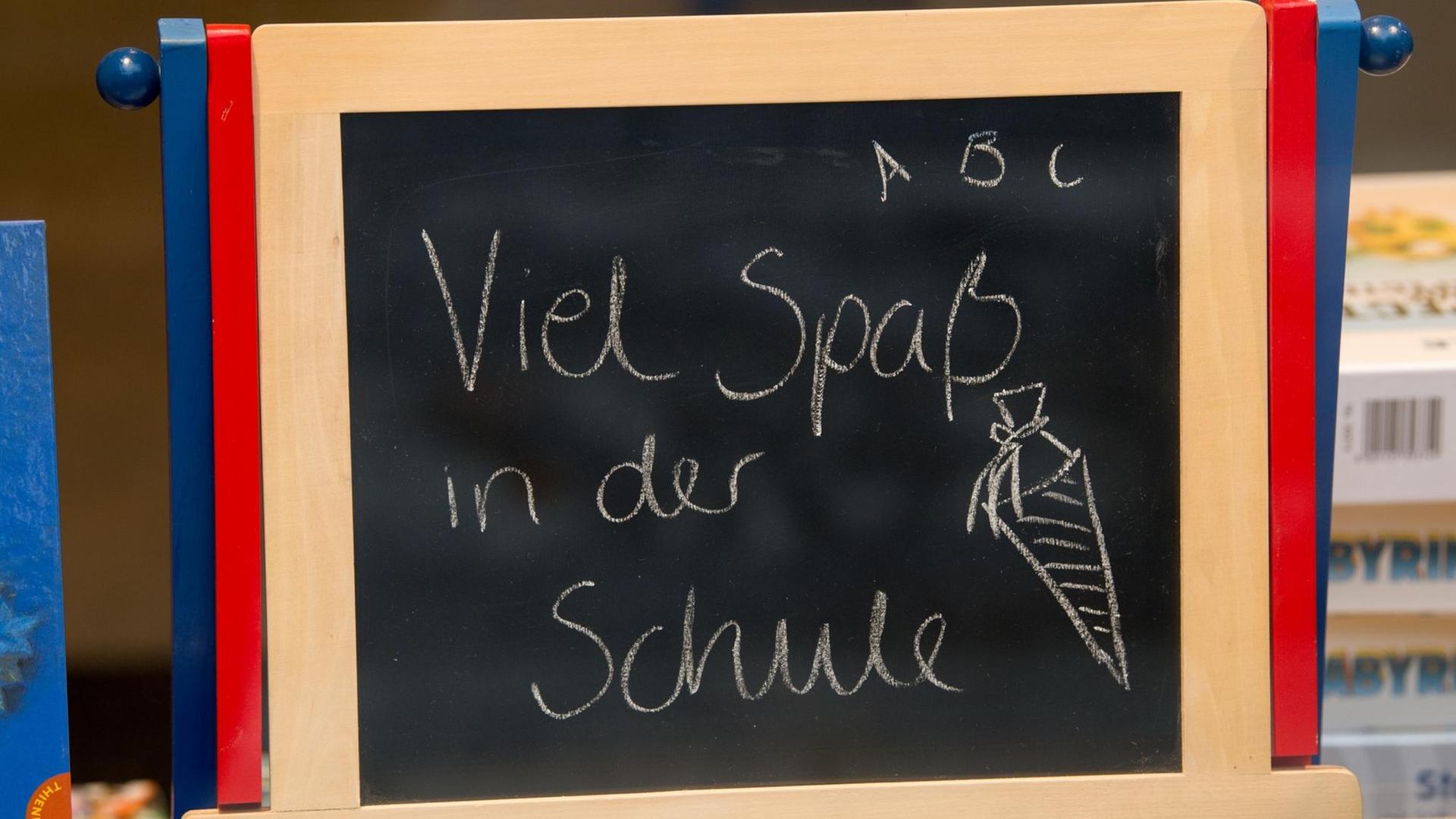Kate Maleike: Heute schauen wir hier in "Campus & Karriere" in den Rückspiegel sozusagen. 20 Jahre ist die Sendung alt, und thematisch ist viel passiert. So einige Bildungssäue sind durchs Land getrieben worden. Mit in den Rückspiegel bei uns schaut jetzt Professor Elmar Tenorth, renommierter Bildungshistoriker von der Humboldt-Uni in Berlin. Guten Tag, Herr Tenorth!
Elmar Tenorth: Guten Tag, Frau Maleike!
1998 - eine Zeit der Kürzungen
Maleike: 1998, was war das für ein Jahr? Das wollen wir uns jetzt erst mal anhören, und zwar mit einem Originalton aus dieser Zeit. Damals nämlich gab es den sogenannten Lucky Streik der Studierenden. Wir hören da mal rein.
Studentin: "Wir gehen auf die Straße, weil es überhaupt kein Geld mehr für die Bildung gibt. Es ist irgendwie das Ziel der Bildungspolitik, Bildung nicht mehr für alle offen zu halten. Die Strategie, dass die Unis so stark gekürzt werden finanziell, bis es nicht mehr weitergeht, läuft meiner Ansicht nach darauf hinaus, dass Studiengebühren eingeführt werden, dass Studentenzahlen verringert werden sollen, und da sind wir dagegen."
Maleike: "Wir sind dagegen." Die Studierenden waren auf der Straße. Angefangen hat alles in Gießen, hat sich dann ausgeweitet zu einem bundesweiten Protest. Herr Tenorth, wir gucken erst mal sozusagen in das Jahr 1998 zurück, also in dieses Wintersemester des Streiks. Was war das für eine Zeit damals? In welcher Lage befanden sich die Hochschulen?
Tenorth: Es war tatsächlich eine Zeit, in der Kürzungen nicht nur unmittelbar vor der Tür standen, sondern auch umgesetzt wurden. Ich erinnere mich deswegen besonders gut, weil ich Dekan einer Fakultät der Humboldt-Universität war. Und meine erste Botschaft, die ich vom Präsidenten bei meinem Anstellungsbesuch bekam, war: Sie müssen 25 Prozent Ihres Etats einsparen. Und 25 Prozent für eine Universität im Aufbau bedeutet, dass sie noch nicht mal komplett ist und schon wieder ein Viertel abgeben muss. Die Situation war wirklich dramatisch, in Berlin vielleicht noch dramatischer als andernorts. Aber ganz manifest war, es ist zu wenig Geld da, die Universität ist tatsächlich im Aufruhr, die Proteste der Studenten waren massenhaft und sichtbar. Ein wildes Jahr in meiner Erinnerung, mit dramatischen Konsequenzen, die dann bis weit nach 2000 anhielten.
Maleike: Das war aber ja ein anderer Protest. Die Studierenden hatten sich extra das Motto "Lucky Streik", also glücklicher, fröhlicher Streik genommen, weil sie eigentlich nicht die große Protestbewegung von '68 wiederholen wollten, oder?
Tenorth: Die Studenten waren realistischer geworden. Sie haben nicht mehr mit ihrem Protest wie wir damals - ich erinnere mich an meine eigene Studentenzeit -, die Gesellschaft insgesamt ändern wollen, sondern sie wussten realistisch, man muss auf das Bildungssystem bezogen konkret argumentieren. Man muss mit detaillierten Forderungen antreten. Man muss nicht die Bündnispartner verschrecken, sondern Bündnispartner suchen. Und die Bündnispartner, die sie gesucht und ja auch gefunden haben, waren die Universitäten selbst, waren die Professoren, waren die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Von daher war das eine andere Strategie, leider nicht so erfolgreich gleich im Ursprung, wie gedacht.
Forderungen der Studierenden bis heute nicht richtig in der Politik angekommen
Maleike: Das heißt, die Proteste sind zwar dagewesen, Sie haben ja auch gesagt, die hatte man lange so nicht mehr erlebt. Aber bei der Politik sind sie nicht so angekommen?
Tenorth: Nein. Sie sind meines Erachtens bei der Politik bis heute substanziell nicht richtig angekommen. Denn die Forderung, die die Studierenden erhoben haben, "mehr Geld" bezog sich ja nicht nur auf ihr eigenes Geld - die haben auch für mehr BAföG zu Recht demonstriert -, sondern bezogen sich ja systembezogen auf mehr Geld für die Universität, für eine bessere Ausbildung, für eine qualifiziertere Betreuung. Und da scheinen mir Strukturdefekte zu sein, die seither immer noch nicht behoben worden sind. Zu den konstanten Schwächen des deutschen Hochschulsystems zählen die Programmpunkte, die damals schon, 1998, kritisch angemerkt wurden.
Maleike: Es gab ja damals auch dann im November und Dezember Märsche auf Bonn. Damals war ja der Bundesbildungsminister Jürgen Rüttgers von der CDU, und man wollte ihm die Rote Karte zeigen. Über 100.000 Studierende waren dabei aus dem gesamten Bundesgebiet, und rausgekommen ist unterm Strich zumindest ein kleines Bibliothekenprogramm, denn die Bibliotheken hatten damals ein ernstes Problem.
Tenorth: Ja, die Bibliotheken haben heute noch ein ernstes Problem. Wenn man nur den Indikator nimmt, Anstieg der Zeitschriftenabonnements in ihren Kosten, die wenigen monopolartigen internationalen Verlage verlangen inzwischen Preise für Zeitschriften, dass sich da, man muss sich das vorstellen, nahezu alle deutschen Universitätsbibliotheken und die großen wissenschaftlichen Gesellschaften zusammengeschlossen haben und das Spiel nicht mehr mitmachen. Und insofern war das Bibliotheksprogramm eine richtige Sicht, aber keine Lösung.
"Man darf die Vergangenheit nicht idyllisieren"
Maleike: Aber das war die Zeit vor Bologna, sprich vor der Umstellung der Studiengänge auf die internationalen Abschlüsse Bachelor und Master - man studierte noch auf Magister und Diplom und Staatsexamen. Das tun wir ja heute auch noch, aber was war das noch für eine Zeit? War das Studium da intensiver, war es nicht so durchstrukturiert, wie es das heute ist, oder wie es ja auch kritisiert wird?
Tenorth: Ich will die Zeit nicht idyllisieren, denn das ist eine sehr ambivalente Zeit gewesen in meiner Wahrnehmung damals als Dekan und dann hinterher in der Verantwortung für die Lehrer an der Universität war das im Grunde eine Zeit organisierter Verantwortungslosigkeit, die ganz viele als Freiheit kodiert hatten. Und es war in einigen Studiengängen tatsächlich die Freiheit. Strukturiert war dieses Studium auch schon. Gegenüber den Studienverhältnissen der 50er- und 60er-Jahre gab es Studienpläne, es gab Studienordnungen, es gab Zwischenprüfungen, es gab Abschlussprüfungen. Es gab allerdings Wahlmöglichkeiten, ein geringeres Zeitbudget. Es gab nicht so sehr wie heute eine Prüfungsinflationierung am Ende einer jeden Veranstaltung.
Also, man darf die Vergangenheit nicht idyllisieren. Die Zeit, die wie eine Idylle der Freiheit aussah, war für ganz viele Leute eine Zeit, in der sie alleingelassen waren in ihren Studiengängen, in der sich niemand verantwortlich fühlte, in der wir Abbruchquoten von weit über 30 Prozent hatten, Studienfachwechsler. Es gab Fächer, die begannen im ersten Semester mit 100 Studenten und hatten im dritten nur noch 20. Also bitte keine Idylle zeichnen der Vergangenheit vorher. Es gab Anlässe und Gründe für Bologna. Wenn man Bologna interpretiert hätte, was man leider nicht getan hat, als den Anspruch einer umfassenden und qualitativ hochwertigen Studienreform.
Maleike: Genau in diese Zeit fiel dann auch die Entstehungsminute von "Campus & Karriere". Wir haben die Grundstimmung in Hochschuldeutschland zum Sendestart im Januar 1998 kurz beschrieben.
Bildungswünsche 1998 und heute
20 Jahre bundesweite Bildungsereignisse zusammenzufassen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, und wir versuchen das gar nicht erst, sondern konzentrieren uns auf wichtige Meilensteine. Herr Tenorth, als Hilfsmittel für unsere Analyse würde ich jetzt gern mal in zwei Umfragen hineinhören, die genau 20 Jahre auseinanderliegen. Es sind Bildungswünsche, die wir auf dem Campus eingesammelt haben. Und hier kommen die für das Jahr 1998:
- "Also ich wünsche mir, dass die Studiengebühren verboten werden und dass Ausländer auch mit gefördert werden, auf jeden Fall."
- "Dass weiterhin die Übungen in den Fächern erhalten bleiben."
- "Dass die Novellierung des Hochschulrahmengesetzes noch mal überdacht werden sollte und generell ein Umdenken stattfinden sollte, dass Bildung einfach einen höheren Stellenwert bekommt."
- "Also ich wünsche mir, dass bei uns alles so bleibt, wie es jetzt ist, dass eben nichts gekürzt wird und wir auch gut weiter studieren können."
- "Dass jeder die Möglichkeit hat, einen Studienplatz zu bekommen, dass die Hörsäle nicht mehr so proppenvoll."
- "Ich wünsche mir fürs Jahr 1998 eine gerechtere BAföG-Lösung."
- "Viel Studienlust und -zeit, und kleine Seminare, und Professoren, die sich engagieren, und Themen, die sich lohnen."
- "Dass der NC vom Referendariat entfällt."
- "Ich bin Bauingenieur, also ich studiere Bauingenieurwesen in München an der TU, und uns geht es verdammt gut. Ich habe keinen Wunsch, mir geht's saugut."
Maleike: Da geht es einem auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir hören gleich mal hinterher, was sich die Studierenden für 2018 so wünschen:
- "In der Hochschulpolitik, denke ich, da wäre es vor allem wichtig, den Übergang von der Schule zur Hochschule besser zu gestalten."
- "Gerne mehr Möglichkeiten schaffen, auch mal über den Tellerrand zu schauen."
- "Stärkere Stellung von Studis und Mittelbau, die finde ich in Entscheidungsfindungsprozesse schon eingebunden, aber nicht weitgehend genug. Und gerade auch der Mittelbau stirbt und lebt prekär. Daran sollte sich auch einiges tun."
- "Ich würde sagen, dass mehr Praxisbezug ganz hilfreich wäre, dass man das Wissen, das man irgendwie erwirbt, das ja doch relativ abstrakt ist, dann auch direkt praktisch anwenden kann."
- "Mehr Förderung von Studenten in Form von BAföG, vielleicht mehr Wohnheime. Speziell bei Jura könnte man vielleicht mal über eine Reform nachdenken vom Staatsexamen."
- "Vor allem im Bereich Mathe gibt es eine ziemliche Diskrepanz zwischen Bereich Schule, was man an der Schule macht, und was man an der Uni machen muss, dass das vielleicht besser überbrückt werden könnte."
- "Grundsätzlich muss mehr investiert werden."
- "Ich wünsche mir, dass nicht so viele Leute Abi machen oder dass das Abi ein bisschen schwerer wird und dadurch die Qualifikationen auch in den gegebenen Studienfächern angepasst werden."
Maleike: Zwei Umfragen, Wünsche von Studierenden auf dem Campus, eingesammelt. Und dazwischen liegen genau 20 Jahre. Herr Tenorth, auffällig ist doch, dass die Wünsche sich in bestimmten Punkten ähneln.
Tenorth: Ja, das tun sie eindeutig, auch aus guten Gründen. Sie ähneln sich in der Wahrnehmung der problematischen Situation der Lehre, in der Wahrnehmung der eigenen sozialen Lage der Studierende, in den Schwierigkeiten, in die Universität überzugehen, in der Disparität von Schulkompetenz zu universitär geforderter Kompetenz, Beispiel Mathematik.
Sie ähneln sich auch darin, das ist mir jetzt an Ihrem Vergleich so deutlich geworden, wie ich das so in Erinnerung gar nicht hatte, dass die Studierenden doch auch ganz stark aus einer Studierendenperspektive - an sich wundert das ja gar nicht, aber sie sehen sehr stark aus einer Studierendenperspektive. Und die Perspektiven, die die Universitäten als Institution beschäftigt haben, kommen so gut wie nicht vor. Also die strukturelle Unterfinanzierung der Universitäten nennt im Grunde niemand. Sie kennen ihre BAföG-Finanzprobleme, aber nicht die Finanzprobleme der Universität. Die sehen sie eher indirekt an Gruppengrößen.
Sie sehen auch nicht, 20 Jahre später, dass es so etwas gab wie das Exzellenzprogramm, das die Universitäten überhaupt erst wieder als Forschungseinrichtungen handlungsfähig machen sollte. Ganz wenig kommt vor von der Erweiterung des Hochschulzugangs, den ich so gravierend finde, dass wir eine Hochschulzugangsquote von über 50 Prozent der Alterskohorte haben, und dass wir inzwischen eine strukturelle Veränderung des gesamten tertiären Bildungsbereichs kennen, zwischen den Universitäten klassischer Art, den Fachhochschulen und ihrer neuen Zuordnung. Also, da gibt es Konstanten, eindeutige Studierendenperspektive und Leerstellen.
Hochschulwelt hat sich dramatisch verändert
Maleike: Das heißt aber nicht, dass wir in der Hochschulwelt auf der Stelle getreten sind in den letzten 20 Jahren, weiß Gott nicht.
Tenorth: Überhaupt nicht. Ich glaube, wenn wir das mit den 200 Jahren der modernen Universität in Deutschland vergleichen, wenn man die Universitäten um 1800, Göttingen, Jena, Berlin als den Startpunkt der modernen Forschungsuniversitäten nimmt und dann die Situation heute, dann sind das gravierende Veränderungen, die man sich in ihrer Dramatik gar nicht vorstellen kann. Und wenn man genau hinschaut, haben diese gravierenden, dramatischen Veränderungen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ja erst angefangen. Die Explosion der Studierendenzahlen. Wenn Sie die Hochschulzugangsquote nehmen, bei 50 Prozent. Wenn Sie das jemandem 1965 erzählt hätten, der hätte Sie für komplett verrückt erklärt. Die Hälfte des Altersjahrgangs studieren lassen zu wollen.
"Absurde Zahl von mehr als 15.000 Studiengängen"
Wenn Sie die Anzahl der Hochschullehrer, der wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Studiengänge - wir haben nach der Bologna-Reform die absurde Zahl von mehr als 15.000 Studiengängen. Das alles ist völlig unverständlich und ist völlig und radikal neu. Also, Expansion, Differenzierung in einem ganz großen Umfang, und eine qualitative Veränderung des gesamten Hochschulsystems und einer ganz neuen Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft - ich finde, das ist so viel, wie wir in den 200 Jahren der Bildungsgeschichte, die man für die Moderne kennt, noch nie gehabt haben.
Maleike: Ich habe extra die Zahlen noch einmal nachgeguckt. 1998 hatten wir etwa 1.800.000 Studierende. Jetzt haben wir zum angelaufenen Wintersemester 2.800.000 Studierende ungefähr, das heißt, eine Million mehr. Ist doch eigentlich auch ein positives Zeichen, dass das Studium so attraktiv geworden ist und die Hochschulen sich für mehr Leute öffnen, oder nicht?
Tenorth: Auf jeden Fall. Das muss man ganz deutlich sehen. Und bei den Zahlen, die Sie nennen für die Zeit heute, wenn man die Rekrutierung der Studierenden mit ins Kalkül zieht, würde man sehen, dass mehr als 40 Prozent davon, um die 40 Prozent, plus/minus, je nachdem, wann man zählt, aus Bildungsgängen außerhalb des traditionellen, klassischen gymnasialen Weges kommen. Also das, was in der Weimarer Republik als zweiter Bildungsweg gefordert worden ist, und was damals ein bis vielleicht zwei Prozent der Studenten überhaupt hatten, haben heute 40 Prozent.
Die "falsche" Herkunft bedeutet immer noch Nachteile für die Bildungskarriere
Das heißt, wir haben eine ganz neue Form der Rekrutierung. Wir sind auf einmal bereit, Kompetenzen anzuerkennen, die man früher für unwesentlich gehalten hat, in technischen und in beruflichen Fächern. Wir lassen einen Meister ohne Abitur studieren. Wir rekrutieren ganz anders und ganz neu. Es gibt ganz viele Benachteiligungsformen, die wir im 20. Jahrhundert bis zum Ende noch kannten und viel diskutiert haben, zum Beispiel der jungen Frauen. Die gibt es überhaupt nicht mehr. Die jungen Frauen sind die Gewinner der Bildungsexpansion. Also, gravierende Veränderungen, auch Gleichheits- und Egalisierungsprozess in großem Maße.
Und man muss natürlich sehen, es gibt Konstanten der Benachteiligung, die auch in diesen Zahlen stecken. Die soziale Herkunft ist eine solche Konstante der Benachteiligung, nicht mehr so gravierend wie früher, aber immer noch deutlich. Und als neue Form der Benachteiligung sind Migrationsfolgen hinzugekommen. Wenn man den Migrationshintergrund ein bisschen analytisch zerlegt, dann sieht man, dass bestimmte Ethnizität strukturelle Benachteiligung bei Bildungskarrieren bedeutet.
Maleike: Ein großes Problem ist aber geblieben, die Grundfinanzierung, und die scheint wirklich chronisch schlecht zu sein. Was gibt es da aus Ihrer Sicht an Gegenmitteln?
Tenorth: Die Grundfinanzierung war nicht chronisch schlecht. Ich darf daran erinnern, dass der erste Bundeswissenschaftsminister, Herr Leussink, den niemand mehr kennt, ein Tunnelbauer -
Maleike: Wann war das denn?
Tenorth: In der Mitte, 1969 war der Bundeswissenschaftsminister, von Beruf Tunnelbauer, was mich immer so amüsiert hat, als Fach. Der hat in einer Situation die Hochschulen übernommen, als die Grundfinanzierung über 90 Prozent der Kosten der Universitäten gesichert hat. Über 90 Prozent. Inzwischen sind wir bei knapp 50 Prozent. Und das macht die Arbeit der Universitäten und der Hochschulen so schwierig. Es gibt Gegenmittel, strukturelle und temporäre. Die zeitlichen wären die, dass die vielen Sondermittel, die die Kultusminister sich jährlich einfallen lassen, um den hohen Andrang zu bewältigen, wären befristete Maßnahmen, Kapazitätsprogramme und so weiter aufgelegt. Wenn man die Sondermittel nur in Dauermittel umwandeln würde, hätte man schon eine erste strukturelle Verbesserung.
Strukturelle Etatsteigerungen nötig
Aber notwendig ist ganz eindeutig, dass man den Etat für Wissenschaft und den Etat für die Hochschulen strukturell einfach erhöht und auf ein Niveau bringt, das den Anforderungen und den erwarteten Leistungen einfach entspricht. Das geht nicht ohne strukturelle Erhöhung, und man muss die Ausrede der Bildungsminister, die man häufig hört - "Aber wir haben doch unsere Etats erhöht" - vergleichen mit dem, was Sie gerade genannt haben. Wer eine Million mehr Studenten aufnimmt, aber nicht mal die hohen Betreuungskosten, die dafür notwendig waren, richtig ausgeglichen hat, kann gar nicht sagen, er hätte strukturelle Qualitätsverbesserungen eingeführt, denn die Qualität ist immer noch schlecht.
Die Defizite, die vor 20 Jahren benannt wurden in der Betreuungsrelation, in den Gruppengrößen der Seminare, in den Beratungsinstitutionen, in den Praktika, in der Organisation, und, und, und. Alles das beim Mittelbau und bei den Lehrkörpern. Dass wir immer noch in ganz großen Teilen durch die Ausbeutung von Lehrbeauftragten, die wir beschämend schlecht bezahlen, die Lehre sichern können ...
Maleike: Genau, der Mittelbau ist ja vorhin auch angesprochen worden.
Tenorth: Ja, und das fand ich sehr gut, dass die Studenten das gesehen haben. Das alles ist nicht geklärt. Wir haben wirklich die größte Not beseitigt, aber wir haben nichts strukturell verbessert und die Universitäten qualitativ richtig erhöht. Und man muss es hinzufügen: Die Exzellenzinitiative, mit den Summen, die wir pro Jahr kennen: Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Bologna-Prozess: ein missglückter Meilenstein
Maleike: Wir sollten noch ein Wort verlieren über eine Reform, die vieles durcheinandergebracht hat, nämlich den sogenannten Bologna-Prozess, der 1999 dann von den europäischen Bildungsministern beschlossen wurde. Ist diese Reform eigentlich ein Meilenstein gewesen, oder ist es was, was Hochschuldeutschland ertragen musste?
Tenorth: Leider gibt es ja auch Meilensteine, an die man sich ungern erinnert, und Bologna zähl für mich zu den missglücktesten guten Intentionen, die man in der Bildungsgeschichte kennenlernen kann. Gute Intention insofern, weil die Grundideen, zwei, drei basale Grundideen, eine richtige Studienreform zu machen, eine bessere Betreuungsrelation in den Universitäten, verbesserte Curricula, verbesserter Austausch, bessere Wechselmöglichkeiten über die Grenzen hinweg. Die sind ja alle immer noch nicht falsch, sondern gut. Was hat man stattdessen aber erreicht? Man hat einen Flickenteppich klein strukturierter, partikularer Quisquilien eingerichtet und sie Studiengänge genannt.
Maleike: Was sind das, Quisquilien?
Tenorth: Quisquilien sind vernachlässigbare Kleinigkeiten, über die man sich nur ärgert, aber die tatsächlich keine Substanz haben. Wenn Sie 17.000 Studiengänge haben in Deutschland ungefähr, zwischen 15.500 und 17.000 Studiengänge, und Sie können inzwischen für jede kleine Spezialität in jedem beliebigen Fach irgendwo einen Bachelorstudiengang finden, dann sind das Quisquilien. Die Diskussion nicht wert, aber es belastet uns.
Wir haben also zu viele nicht gut strukturierte Studiengänge bekommen, wir haben die internationale Vernetzung nicht erreicht, die erreicht werden sollte. Wir haben die Lehrstruktur insgesamt verkompliziert, statt sie zu vereinfachen. Wir haben ein Akkreditierungs-, also Beglaubigungs- und Prüfungssystem erfunden, das das Geld nicht wert ist, das wir dafür rauswerfen. Und zu Recht hat das Bundesverfassungsgericht gemahnt, dass man daran arbeiten muss.
Also, Bologna hat Belastungen erzeugt, Folgeprobleme, aber keine der Schwierigkeiten, die wir hatten, als Bologna zu Recht mal eine Chance war für die Universitäten, ist wirklich gelöst worden. Und es zählt zu meinen größten Niederlagen, dass ich daran leider auch mitgewirkt habe, dass wir nichts von den Grundideen haben realisieren können.
PISA-Schock: "Da haben wir die Illusionen verloren"
Maleike: Und außerhalb der Hochschulen? Was hat sich da für Sie maßgeblich getan in den 20 Jahren.
Tenorth: Da ist ja die Zäsur, die markiert das Vorher und Nachher, das Erscheinen der ersten PISA-Studie 2001. Da haben wir die Illusionen verloren über die hohe Qualität unseres vermeintlich weltbesten Bildungssystems und sind auf die Tatsache gestoßen worden, wie different die Ergebnisse sind, die wir erbringen.
Das für mich Dramatischste daran war, dass wir zum ersten Mal statistisch präzise und seit der Zeit nicht verschwindend sehen, dass es eine konstante Gruppe von sogenannten Risiko-Lernenden gibt, die die Ziele der Pflichtschulbildung nicht erreichen, denen man die Grundbildung verweigert, die keine kulturellen Basiskompetenzen haben. Und im Grunde war die ganze Bildungspolitik seit 2001 der Versuch, auf diese PISA-Befunde kompetent, geschlossen und angemessen zu reagieren, und das sind tastende Suchbewegungen gewesen, aber noch keine gute Strategie. Bildungsstandards gehörte dazu, Implementation von bestimmten Programmen, von der Vorschule bis in die Sekundarstufe zwei. Aber man arbeitet eher noch an den PISA-Folgen, als dass man eine vernünftige Strategie hätte. Sehr viel Suchbewegung und noch kein klares Programm.
"Ohne Sicherung der Grundbildung ist alles andere nichts"
Maleike: 20 Jahre "Campus & Karriere". Wir sind im Gespräch mit Professor Elmar Tenorth, dem Bildungshistoriker von der Humboldt-Uni in Berlin. Nachdem wir jetzt viel zurückgeguckt haben, gucken wir doch jetzt noch mal schnell nach vorn zum Schluss. Was ist für Sie die größte Herausforderung für das deutsche Bildungssystem? Auf was steuern wir zu?
Tenorth: Im Bereich der Pflichtschulbildung ist für mich die größte Herausforderung, die Grundbildung für alle wirklich zu garantieren, und zwar qualitativ so, dass alle Absolventen der Schule anschließend kompetent eine Berufsausbildung aufnehmen können und fähig und willens sind, für ihren eigenen Lebensunterhalt auch über Berufsbildung zu sorgen. Ohne Sicherung der Grundbildung ist alles andere nichts. Dann regelt sich auch alles leicht.
Das Zweite betrifft den gesamten Bildungsbereich, ist die Frage der Sicherung der Finanzen. Ohne eine Finanzierung sowohl des Pflichtschulbereichs angesichts der neuen Aufgaben, die wir haben, von Inklusion bis neuer Heterogenität, das geht ohne Finanzen und neues Personal, das man damit bezahlen kann, nicht. Aber auch das tertiäre Bildungssystem wird ohne neue Finanzierung überhaupt nichts werden.
Und das Dritte, über alle Bereiche hinweg, ist neben der Öffnung, die ich ganz wichtig finde, der Zugang muss, abhängig von der Qualität und Kompetenz, gleichzeitig aber auch ein Zugang in ein System sein, das für die Absolventen und für die Studierenden und für die Lehrenden und für die nachfolgenden Einrichtungen im Bildungssystem und außerhalb die Qualität wirklich sichert.
Maleike: Qualitätssicherung, eine Grundbildung für alle, und eine neue, bessere Finanzierung des gesamten Bildungsbereiches. Klare Worte waren das jetzt zum Schluss von Professor Elmar Tenorth, Bildungshistoriker der HU in Berlin. Mit ihm zusammen haben wir auf die wichtigsten Meilensteine geschaut auf der Wegstrecke von 1998 bis heute. Vielen Dank dafür!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.