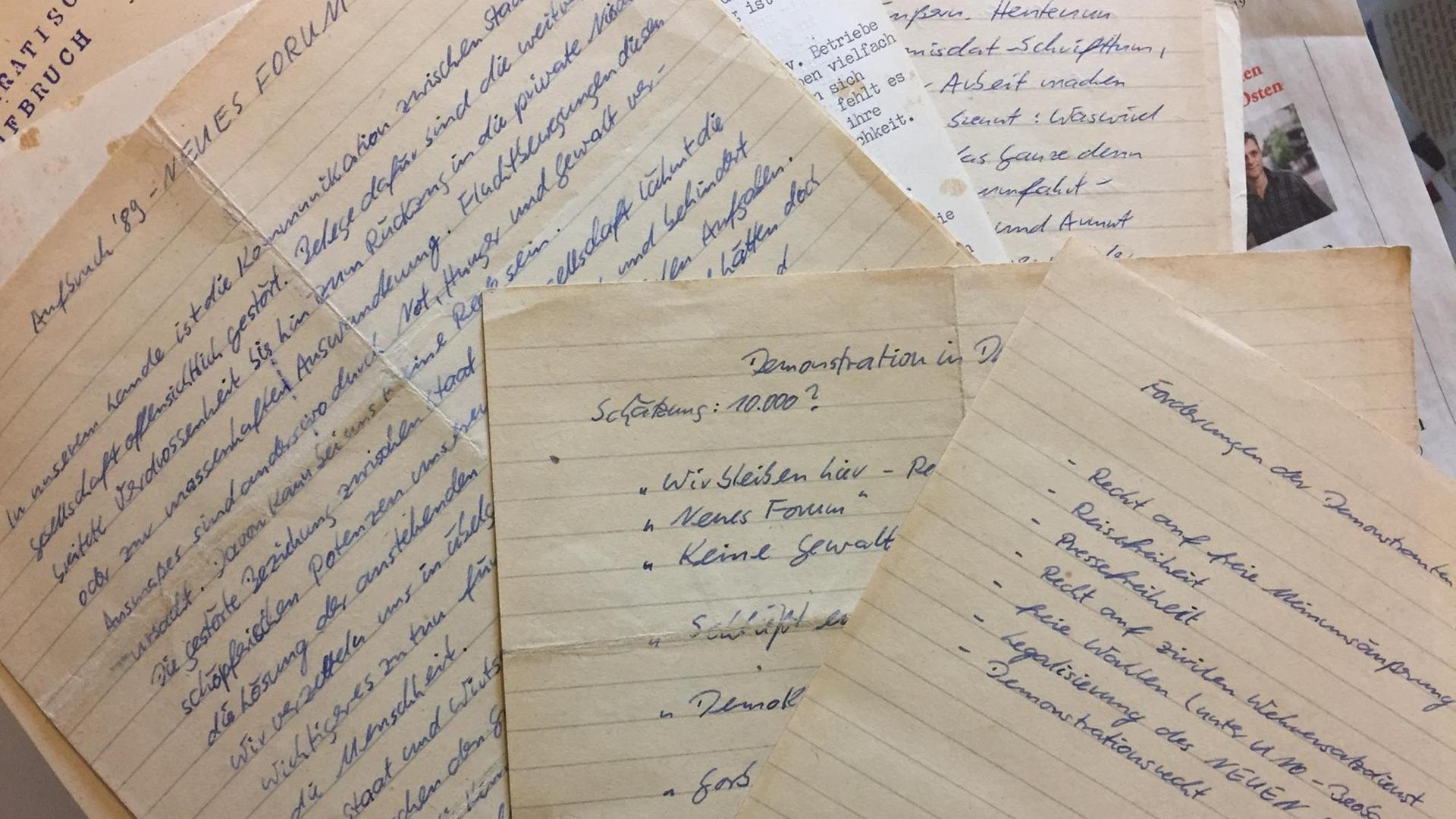Kaum war Konrad Wilhelm wenige Wochen vor dem Mauerfall zum Leiter eines großen Braunkohlekombinats im brandenburgischen Lauchhammer aufgestiegen, musste er den Betrieb mit acht Brikettfabriken, Kokerei und Kraftwerken wieder abwickeln.
"Es ist letztendlich eine Entscheidung der Treuhandanstalt gewesen, aber über uns sind ja im Grunde genommen Rheinbraun und ähnliche wie die Heuschrecken reingefallen und haben das aus Konkurrenzsicht auch gesehen."
Innerhalb weniger Jahre musste Wilhelm über das Schicksal von rund 6.500 Mitarbeitern und ihren Familien entscheiden. Vielen habe er damals keine sinnvolle Perspektive bieten können.
"Grüne Landschaften, nicht blühende"
"Letztendlich haben die Leute in dieser Zeit ihre eigenen Produktionsanlagen abgerissen, Hals über Kopf alles Mögliche abgerissen. Und dann waren da nur noch grüne Landschaften – nicht blühende. Und das hat dann dazu beigetragen, dass da ein tiefer Umbruch, ein tiefer Wandel stattgefunden hat."
"Übrigens hat die ehemalige Chefin der Treuhand, Birgit Breuel, inzwischen eingestanden, dass Fehler gemacht worden sind."
Dagmar Enkelmann, ehemals PDS- und Linken-Politikerin, heute Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, eröffnete im August 2019 die Wanderausstellung "Schicksal Treuhand – Treuhand-Schicksale" in Erfurt. Menschen wie Konrad Wilhelm erzählen auf großen Tafeln mit Fotos, wie sich die Arbeit der Behörde auf ihr Leben auswirkte.
Bis 1994 habe die Treuhand rund 9.000 volkseigene Betriebe mit vier Millionen Mitarbeitern privatisiert oder geschlossen.
Treuhandanstalt: Umverteilung von Ost nach West
"Der zentrale Fehler der Treuhand war tatsächlich, dass es einen Vorrang von Privatisierung gegeben hat, anstatt darüber nachzudenken wie man die Unternehmen tatsächlich wettbewerbsfähig machen kann, wie man sie sanieren kann, modernisieren kann. Die Treuhand wurde von der bundesdeutschen Politik benutzt zur Marktbereinigung, zur Umverteilung von Maschinen, von Anlagen, von Konstruktionen, von Patenten, von Aufträgen – eine Umverteilung von Ost nach West."
30 Jahre nach dem Mauerfall scheinen die starken Kontroversen der 1990er Jahre wieder aufgebrochen. Von Unwuchten und Frustrationen, von Distanz zu den etablierten politischen Parteien vor allem in Ostdeutschland ist in den öffentlichen Debatten und in einer Vielzahl neuer Bücher die Rede.
Kontroversen 30 Jahre nach Mauerfall wieder aufgebrochen
Und das, obwohl die 29jährige Einheitsgeschichte eine absolute Erfolgsgeschichte sei, sagt Ines Geipel, Schriftstellerin und Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch".
"Nicht nur sind die Zahlen mittlerweile im Osten besser als im Westen. Von der Rente angefangen bis zu den Lebenshaltungskosten, bis zu dem Lebensstandard im Verhältnis zu dem was du verdienst. Also das irre ist doch, dass die Zahlen bestens sind, aber die Stimmung so obermies. Und dies braucht eine Auflösung. Und dass auf diesem Weg viele Ostdeutsche sehr ruppigen Verhältnissen ausgesetzt waren, dass auch Idiotismen passiert sind, dass Menschen schlecht behandelt wurden."
"Das Regime hat fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt, ihre Erziehung, ihre Ausbildung verhunzt. Viele Menschen sind wegen ihrer fehlenden Fachkenntnisse nicht weiter verwendbar."
Schreibt der Jurist und Publizist Arnulf Baring 1991 in seinem Buch "Deutschland, was nun?".
Vor fünf Jahren noch eine glückliche Einheitserzählung
"Ostdeutschland ist laut, Ostdeutschland ist wütend, ist zornig. Der Westen hat sich den Schmerz des Ostens sehr fremd halten können, und das bricht jetzt auf. Vor fünf Jahren war es eher die glückliche Einheitserzählung, die glückliche Revolution, haben viele in den Medien angefangen, ihre Geschichten zu erzählen. Das hatte etwas sehr sehr Schönes und Berührendes."
Symbolisch dafür steht die 15 Kilometer lange Licht-Installation, die am 9. November 2014 den ehemaligen Mauerverlauf in Berlin markierte.
Heute sei das ganz anders, sagt Ines Geipel, Jahrgang 1960. Die frühere DDR-Leichtathletin, die noch im Sommer '89 aus der DDR geflohen ist, analysiert in ihrem neuen Buch "Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass" den Rechtsruck in Ostdeutschland. Sie spricht von einem neu aufgelegten Spaltungssyndrom:
"Der Westen, der völlig ratlos davor steht und sagt: Meine Güte, jetzt haben wir 2,5 Billionen rüber geschoben und am Ende kommen in Sachsen 30 Prozent AfD raus, das kann doch nicht wahr sein. Im Grunde steht ja wie ein gesellschaftlicher Konsens auf dem Spiel. Und das glaube ich spürt jetzt der Westen, und Ostdeutschland merkt, dass er damit ein politischer Player wird."
Ostdeutsche, die in den 1960er Jahren geboren wurden, führen die Debatte
Heute melden sich ganz andere Protagonisten zu Wort als vor fünf Jahren, stellt der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk fest. Die Debatte werde überwiegend von Ostdeutschen geführt, die in den 1960er Jahren geboren wurden.
"Wenn wir immer sagen, es fehlen überall ostdeutsche Stimmen in allen Elitepositionen, in vielen wichtigen Positionen, dann ist es irgendwie vielleicht das Natürlichste, das Naheliegendste, dass man sagt: Okay, dann müssen wir halt in dieser Ostdeutschland-Debatte vielleicht doch mehr Ostdeutschen, die was zu sagen haben, auch mal zuhören. Und ich glaube, das können wir gegenwärtig auch gerade beobachten."
Die Zeit seit dem Mauerfall am 9. November 1989 steht auf dem Prüfstand: die so genannte Transformationszeit, in der die DDR Teil der Bundesrepublik wurde. Wie das ablief, beschreibt Kowalczuk in seinem neuen Buch, dem persönlich gehaltenen Essay "Die Übernahme". Er habe diesen Begriff nicht politisch aufladen wollen, sagt der Historiker. "Die Übernahme" beschreibe zunächst den technokratischen Prozess, dass die DDR-Bürger nach der Revolution die Wiedervereinigung herbei wählten – die dann in Verträgen ausgehandelt wurde. Diese hätten die Verhältnisse der Bundesrepublik allerdings mehr oder weniger im 1:1-Verfahren auf Ostdeutschland übertragen, kritisiert Kowalczuk dann doch:
"Wenn man dann nochmal genauer hinschaut wie die Versicherungsbranche, die Bankenbranche, der Energiesektor, all diese großen Struktureinheiten einer jeden Gesellschaft, wie die tatsächlich relativ unkompliziert für einen Appel und ein Ei von großen bundesdeutschen Konzernen übernommen worden sind, was für gewaltige Gewinne sie gemacht haben in den 90er Jahren, kann man schon relativ unvoreingenommen von einer Übernahme sprechen."
Ost und West waren an "Übernahme" beteiligt
Der Osten habe allerdings wesentlich dazu beigetragen, stellt der Historiker klar. Viel von dem, was die bundesdeutsche Gesellschaft und Kultur ausmachte, sei von den Ostdeutschen bewusst übernommen worden:
"Nicht nur der Osten sollte endlich so werden wie der Westen, sondern viele Ostdeutsche wollten auch in den 90er Jahren endlich so werden wie die Westdeutschen. Ich schreibe ja in meinem Buch auch das böse Wort: Wer so mit seiner eigenen Würde umgeht, darf sich über eine zertrampelte Würde nicht wundern. Gerade die frühen 90er Jahre waren davon geprägt, dass alles im Osten auch so werden sollte, niemand kaufte mehr Anfang der 90er Jahre für gute D-Mark Nudossi, sondern alle wollten Nutella haben."
Mit der wissenschaftlichen Untersuchung der Transformationszeit beschäftigt sich Raj Kollmorgen, Professor für das Management sozialen Wandels an der Hochschule Zittau/Görlitz. Die gesellschaftliche Umwälzung in der DDR sei zuerst weder vorausgesehen noch später richtig eingeschätzt worden. Zunächst wurde sie als nachholende Modernisierung wahrgenommen.
Das hängt nach Ansicht des Soziologen, Jahrgang 1963, auch damit zusammen, dass viele Wissenschaftler aus dem Westen kamen und sich mit der DDR nicht auskannten. Zugleich seien viele ostdeutsche Kollegen nach der Abwicklung ihrer wissenschaftlichen Einrichtungen auf den unteren Hierarchiestufen gelandet.
Transformationsprozess dauert länger als angenommen
"Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass man von Kurzzeitperspektiven, die davon ausgegangen sind – im Übrigen wie die Politik – dass dieser Transformations- und Vereinigungsprozess nur wenige Jahre anhalten wird, und dann wird das eigentlich erledigt sein, dass sich die offenkundig nicht bewahrheitet haben. Sondern dass unter dem Dach einer formell vereinigten Gesellschaft es lange Zeit Unterschiede geben wird, diese Prozesse auch der Kulturalisierung dieses Umbruchs, dass die lange Zeit brauchen. Und dass auch relativ spät sich noch eigene ungewohnte Pfade der Entwicklung – und möglicherweise auch nicht nur im Osten – noch zeigen können."
Zum Beispiel die Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern. Sylka Scholz hat untersucht, dass etliche aus der DDR-Zeit stammende Muster sich gehalten haben. Die Frauen hätten sich nicht von der Erwerbsarbeit abgewendet, im Gegenteil, sagt die Professorin für Soziologie an der Uni Jena. Sie tragen die Hauptverantwortung für die Familie, aber auch die Männer beteiligen sich nach wie vor stark an der Kinderbetreuung.
Rollenverteilung weiterhin nach ostdeutschen Mustern
"Beide Geschlechter haben auf jeden Fall daran festgehalten, dass sie eine Doppelverdiener-Beziehung oder -Ehe führen wollen. Und insofern hat so eine Transformation an das westdeutsche Muster nicht stattgefunden. Es hat einen demographischen Bruch gegeben, so wird es ja in der Literatur beschrieben, durch die Unsicherheiten. Also dadurch dass ja die gesamte westdeutsche Gesetzgebung übertragen worden ist auf den Osten, hat sich das Scheidungsrecht verändert. Paragraph 218 war mehrere Jahre in der Debatte, in welche Richtung er sich entwickeln wird."
Der gesellschaftliche Umbruch der 90er Jahre spiegelt sich stark in der Statistik jener Zeit wider, so Sylka Scholz:
"Man sieht einen Stopp. Einen Stopp von Geburten. Also natürlich werden die Kinder, die 1989 gezeugt worden sind, noch geboren. Aber dann wird das gesamte reproduktive Verhalten in gewisser Weise eingestellt. Und man lässt sich auch nicht scheiden. Und man heiratet auch nicht. Also alles kommt in so eine Erstarrung. Man könnte sagen: Dadurch, dass das Erwerbssystem sich so stark bewegt, dass die gesamte politische Ordnung umschlägt, will man auf keinen Fall, dass die Familiensituation sich verändert."
"Der Vorplatz vor der Frauenkirche, wo der Bundeskanzler in wenigen Minuten erwartet wird, ist gesäumt von tausenden von Menschen. - Wir wollen und wir werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes."
Der Aufbruch 1989 – war das eine Stunde Null, in der die Transformation begann? Ilko Kowalczuk widerspricht: Seine eigene, in den 60er Jahren geborene Generation habe schon in den 70er und 80er Jahren mit einem Bein im Westen gelebt.
Transformation hat lange vor 1989 begonnen
"Und da gab es auch immer, ganz unabhängig übrigens von der eigenen politischen Position in der DDR, also wie man zum System stand, das trifft nämlich auch sogar auch auf viele Systemgänger und auf viele Systemstützen zu, gab es doch eine große Sehnsucht nach vielem, was mit dem Westen verbunden worden ist. Und zumindest in kultureller Hinsicht und in mentaler Hinsicht müsste man in dieser Perspektive sagen, also dieser Transformationsprozess, der hat schon lange vor 1989 begonnen. Er ist sogar in meiner Interpretation eine Vorbedingung für den Erfolg der Revolution von 1989 – nicht nur in der DDR sondern im gesamten Ostblock."
Über die Brüche oder Frakturen der spätsozialistischen DDR denkt Steffen Mau nach. Der Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität ist 1968 geboren und in einem Rostocker Neubauviertel in der Zeit vor dem Mauerfall groß geworden. Mit "Lütten Klein – Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft" legt auch er – wie Kowalczuk - ein teils analytisches, teils persönliches Buch vor.
"Klar, natürlich weiß man, dass in einem totalitären Staat oder in einer sehr kontrollierten Gesellschaft bestimmte Entwicklungen nicht stattfinden können, also zum Beispiel Formen der Differenzierung oder auch der Entfaltung von Subjektivität und auch der Individualisierung. Das ist weggedrückt worden. Und zum zweiten sozialstrukturell natürlich, dass man sehr starke Eingriffe hatte, zum Beispiel darauf, ob Positionen politisch besetzt werden, dass es eben eine Entbürgerlichung der DDR gab, eine nach unten gedrückte Sozialstruktur und eine Hofierung der Arbeiterklasse letzten Endes – jedenfalls so die offizielle Rhetorik."
Im wiedervereinigten Deutschland explodierten im Osten Konsum und Wohlstand, zur selben Zeit aber fand eine Unter- und Überschichtung statt, sagt Mau. Die Ostdeutschen rutschten auf die unteren Ränge der gesamtdeutschen Sozialstruktur, während zugezogene Westdeutsche in den neuen Bundesländern die oberen Posten besetzten.
Mobilitätsblockaden ließen Ost und West schief zusammenwachsen
Ein schiefes Zusammenwachsen, so der Soziologe. Die Annahme, man könne den Osten einfach in die westliche Modellgesellschaft hineinkaufen, habe sich als irrig erwiesen:
"Man kann die ganzen Mobilitätsstudien angucken, dann sieht man, dass Ende der DDR eine Mobilitätsblockade da war und immer weniger Menschen aufgestiegen sind, weil die vorhergehenden Generationen wie eine Grabplatte drauf lagerten. Und in den 90er Jahren hat das auch nicht stattgefunden, weil im Osten zusammenbrechende Arbeitsmärkte waren. Und gleichzeitig wir eine Situation hatten, wo eben die Eliten ganz einfach aus dem Westen importiert werden konnten."
Ungefähr 60 Prozent der ostdeutschen Eliten wurden nach der ersten freien Volkskammerwahl im März 1990, also noch zur DDR-Zeit, ausgetauscht, berichtet Raj Kollmorgen – in den ersten Monaten der neuen Regierung unter Lothar de Maizière.
"Zum Teil begann das ja bereits unter der Reformregierung von Hans Modrow, das heißt mit dem Abtritt von zunächst Erich Honecker und dann ja auch Egon Krenz. Worauf ich Wert legen möchte, ist, dass der Elitenaustausch – und zwar auch ein radikaler Austausch – bereits im Herbst 1989 begann. Das war also nicht erst die Folge des eigentlichen Vereinigungsprozesses und des Beitritts am 3. Oktober 1990."
Das Besondere am ostdeutschen Transformationsprozess liegt auf der Hand: Anders als in den ostmitteleuropäischen Ländern lag in der DDR das Beitrittsmodell auf dem Tisch. Es sah den radikalen Bruch mit alten Institutionen vor – ein Bruch, der sich nicht ohne Elitentransfer realisieren ließ, betont der Soziologe. Aber:
Transformation durch westdeutsches Machtkalkül mitbestimmt
"Das war nicht nur ein institutioneller Zwang, sondern es gab auch klare Machtkalküle auf Seiten der westdeutschen Eliten, dass man ostdeutsche Bewerber nicht so zum Zuge kommen lässt, nicht zuletzt deswegen weil man nicht so richtig wusste, wie die politisch eingestellt sind. Also ich darf an die kritischen Angehörigen der Bürgerbewegung denken, die ja durchaus auch gegenüber nicht nur dem Grundgesetz, sondern auch gegenüber der Verfassungswirklichkeit der alten Bundesrepublik, in jedenfalls Teilen, kritisch eingestellt waren. Es gab ja auch eine Verfasssungsdiskussion, daran werden sich einige noch erinnern."
Das wiedervereinigte Land hätte sich 1990 mehr Zeit nehmen müssen, sagen Historiker und Soziologen. Eine verfassunggebende Vollversammlung hätte beispielsweise zehn Jahre später einberufen werden können, um die gemeinsamen Erfahrungen einzuarbeiten – ein Schritt, der das Grundgesetz wohl kaum umgekrempelt hätte, ein positives Zeichen aber an den Osten, beteiligt zu werden.
"Menschen verzwergt...Erziehung verhunzt...nicht weiter verwendbar."
Der Soziologe Steffen Mau spricht von soziokultureller Entwertung und Identitätsverlusten:
"Im Prinzip auch dass die gesamte Lebenswelt, der Erfahrungsraum, in dem die Ostdeutschen gelebt haben, dass der häufig gleichgesetzt wurde mit dem politischen System. Also alles, was aus der DDR kam, galt eigentlich als kontaminiert und war für die neue wiedervereinigte Gesellschaft nicht mehr satisfaktionsfähig, also sollte nicht mehr stattfinden. Und bestimmte Sachen, da haben sich die Ostdeutschen gewundert, dass man irgendwie nicht bereit ist, über Polikliniken nachzudenken oder im Bildungssystem Veränderungen einzuführen."
Ein doppelter Transformationsprozess
Der Blick auf die DDR, auf die neuen Bundesländer und Ostdeutschland ändert sich im Zuge der aktuellen Debatte. In seinem Essay versucht Ilko Kowalczuk, die 90er Jahre in einen größeren Kontext zu stellen. Er spricht von einem doppelten Transformationsprozess, weil der Übergang von der Plan- in die freie Marktwirtschaft schon früh von Prozessen der Globalisierung überlagert wurde.
Außerdem sei lange unterschätzt worden, dass die ostdeutsche Gesellschaft sich aufgrund langer demokratieferner Erfahrungen bis heute an einem starken Staat orientiere.
"Und diese Kontinuität ist gewissermaßen durch den Wahlkampf im Frühjahr 1990 verstärkt worden. Da stand der bundesdeutsche Staat mit der D-Mark in der Hand und hat gesagt: Mit dieser D-Mark garantiere ich Euch Stabilität, Sicherheit, Wohlstand, der Westen kommt zu euch in den Osten und hier wird es in absehbarer Zeit, in sehr schneller Zeit – damals ging man von fünf bis sieben Jahren aus – genauso aussehen wie bei uns. Und wenn wir heute sehen das Wahlverhalten vieler Ostdeutscher: in den 90er und Nuller-Jahren stand die PDS dafür, seit Mitte unseres jetzigen Jahrzehnts steht die AfD für einen starken Staat, der es schon richten wird."
Der Osten wurde nicht vom Westen kolonialisiert
Ines Geipel will sich der "großen Demütigungserzählung", wie sie es nennt, nicht anschließen. Die Behauptung, der Osten sei vom Westen kolonialisiert worden, beherrsche die öffentliche Debatte seit einigen Jahren.
Geipel plädiert – ähnlich wie Kowalcuk - dafür, sowohl die lange, doppelte Diktaturerfahrung in Ostdeutschland als auch die Brucherfahrung nach 1989/90 historisch auszuwerten.
"Das hat ja im Mentalen und im Leben der Ostdeutschen unwahrscheinlich viel gemacht. Und was wir jetzt sehen in diesem Jahr, dass wir ja wie so zwei doppelte Mentalitäten oder man könnte auch sagen, emotionale Gedächtnisse haben, die kollidieren, die nicht zusammenfinden. Und das hat mit tiefen Frustrationen zu tun, Enttäuschungen, Erwartungen, Hoffnungen, aber es hat eben auch mit diesem Kollektivsyndrom, also wenn es den Einzelnen, das Ich, in so einer langen Diktaturzeit nicht gegeben hat, und dann bricht das auf und dann kommt viel harscher Wind rein in diese Einschlussgesellschaft, dann gibt es harte Frakturen."
Fehler der Wiedervereinigung nicht länger wegdrücken
Für Steffen Mau steht fest: Dass im Laufe der Wiedervereinigung einiges falsch gelaufen ist, sollten die politischen Eliten nicht länger wegdrücken, sondern offener diskutieren.
Doch nicht nur die Erfahrungen aus der DDR- und unmittelbaren Wende-Zeit seien einschneidend. Die Transformationszeit selbst präge bereits die Menschen.
"Und ich glaub das wird immer unterschätzt: Also die letzten 30 Jahre sind auch voll mit Geschehnissen. Da haben sich regionale Netzwerke gebildet, da hat sich ein bestimmtes alltagskulturelles Verständnis gebildet, da haben sich sozialmoralische Repertoires ausgebildet, die wiederum ihre eigenen Traditionsbestände schaffen. Und jetzt die Verankerung zum Beispiel von rechten Netzwerken oder rechtspopulistischen Gruppierungen in bestimmten Ortschaften, Regionen und Kreisen, die führen ja gerade dazu, dass so etwas einwurzelt und dann nicht so einfach wieder verschwindet."