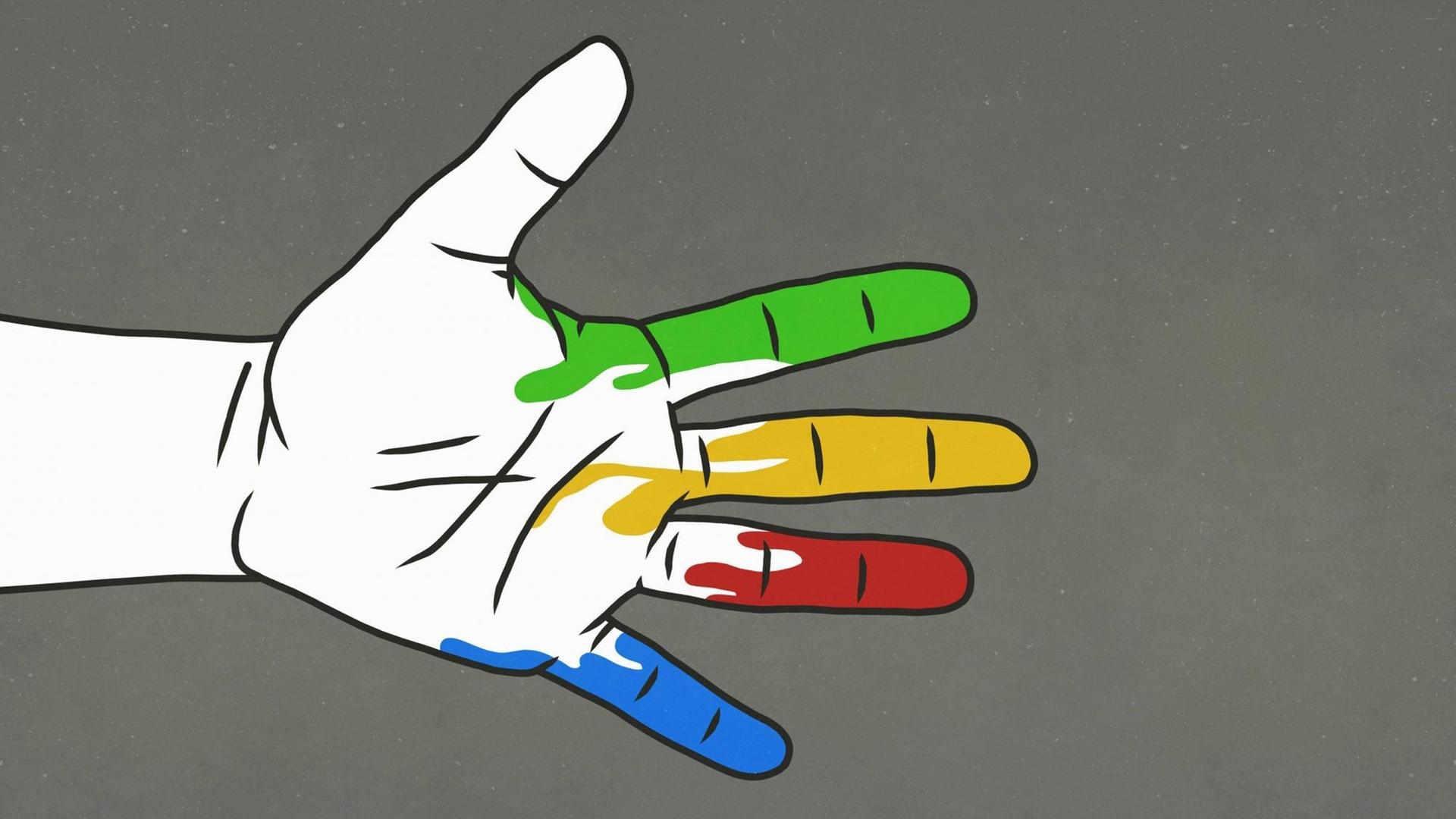Vor 50 Jahren erschien "A Theory of Justice" des Harvard-Philosophen John Rawls. Dieses Buch hat die politische Philosophie damals neu geboren. Rawls schlägt darin ein Gedankenexperiment vor: Lasst uns eine Gesellschaft so gestalten, dass wir über ihren Aufbau entscheiden, ohne zu wissen, was für eine Position wir später in dieser Gesellschaft haben werden.
Rawls stellte sich eine Ordnung vor, in der selbst die Ärmsten und Untalentiertesten noch würdig leben können und in der alle vom Reichtum und von den Talenten der Leistungsstärksten profitieren – womöglich durch eine Umverteilung.
Wie steht John Rawls zum Sozialstaat, zu den Beziehungen der Staaten untereinander, zur Weltwirtschaftsordnung und zum Liberalismus? Das analysiert Tamara Jugov, Philosophieprofessorin an der TU Dresden, im "Essay und Diskurs"-Gespräch mit Pascal Fischer.
50 Jahre Theorie der Gerechtigkeit
Eine Reihe in drei Teilen
- Die Zukunft der Politischen Philosophie (05.09.2021)
- Verlorener Begriff und feministische Kritik (12.09.2021)
- Wie Rawls über Umverteilung, Sozialstaat und Weltordnungen dachte (19.09.2021)
Pascal Fischer: John Rawls, was ist das für ein Mann? Ist das ein Theoretiker des Sozialstaats, ist das ein Liberaler, ein Feld-Wald-und-Wiesen-Liberaler, gar ein Neoliberaler, der nicht ganz bedenkt, was für Folgen sein Konzept hat? Was ist das für ein Liberalismus, den dieser Herr Rawls ab den '50ern und dann in den '70ern verfolgt?
Tamara Jugov: Ja, John Rawls ist, glaube ich, nicht einfach ein Liberaler und auch kein Feld‑Wald‑und‑Wiesen-Liberaler, denn er hat sich auf eine Art und Weise philosophisch bemüht, den Liberalismus zu begründen, die sehr umfassend ist, die sich aus ganz verschiedenen Theorierichtungen speist und die sich in ihrer Begründung auch an viele verschiedene Menschen.
Das heißt, zu einem historischen Zeitpunkt, wo der Liberalismus ja sehr stark schon mal unter Druck war, also Mitte des letzten Jahrhunderts, versucht Rawls zu erklären, warum wir eine liberale Ordnung brauchen, und zu sagen: Wenn wir ausgehen von den totalitären Verheerungen des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel, dann scheint doch etwas dran zu sein an Vertragstheorien, die den Wert der Einzelnen auf eine besondere Art und Weise begründen. Das ist das erste Wichtige, dass er in dieser Hinsicht ein Liberaler ist und die Freiheit und den Wert der einzelnen Person sehr stark betont.
Das Zweite ist: Das wird ja immer so dargestellt, Rawls versucht irgendwie, so eine Art skandinavischen Wohlfahrtsstaat zu skizzieren und zu begründen, das ist komplex – meiner Meinung nach geht Rawls über den skandinavischen Wohlfahrtsstaat eigentlich noch hinaus. Aber was Rawls Mitte des letzten Jahrhunderts auch macht oder dann halt '71, wo die Theorie das erste Mal erscheint, ist, uns Argumente an die Hand zu geben, warum es nicht einfach nur um Umverteilung geht, sondern wie Gerechtigkeit als Fairness in der Gesellschaft auszusehen hat.
Also das heißt, wenn wir fair miteinander kooperieren wollen in einer Gesellschaft, nach welchen Prinzipien, nach welchen Gerechtigkeitsprinzipien wir dann die institutionelle Grundstruktur unserer Gesellschaft ordnen sollten.
Zwei Gerechtigkeitsprinzipien
Fischer: Was sind das für Prinzipien, wie denkt er da vorwärts?
Jugov: Insgesamt begründet Rawls in dem Denkexperiment des Urzustands – das hatten Sie ja schon kurz erwähnt – zwei Gerechtigkeitsprinzipien. Er sagt: Stellt euch vor, ihr wisst nicht, welche Position in einer sozialen Gesellschaft ihr einnehmen werdet, ihr wisst nicht, welches Geschlecht ihr haben werdet, ihr wisst nicht, welche soziale Klasse ihr haben werdet, was euer Elternhaus ist – ist eure Mutter Kassiererin oder Professorin –, das wisst ihr alles nicht, und ihr wisst aber allgemeine Sachen. Ihr kennt die Umstände einer Gesellschaft, allgemeine Fakten, zum Beispiel über menschliche Psychologie. Und er sagt, das exempliert diese Idee des "Schleiers des Nichtwissens", dass wir das alles nicht wissen, welche konkrete soziale Position wir haben werden, und er geht davon aus, dass unter diesen Bedingungen zwei Gerechtigkeitsprinzipien gewählt würden.
Das erste Gerechtigkeitsprinzip verlangt ein umfassendes Set an gleichen Grundfreiheiten für alle, das heißt, wir haben so was wie politische Freiheiten, Wahlrecht, freie Meinungsäußerung und so weiter. Und das zweite Gerechtigkeitsprinzip hat zwei Teile: Das verlangt erst mal Chancengleichheit und zweitens, das sogenannte Differenzprinzip fordert, dass Ungleichheiten zum Wohle der am schlechtesten gestellten Gruppe ausbalanciert werden und austariert werden.
Fischer: Das ist ja jetzt eine Philosophie, die davon ausgeht, dass wir alle sehr unterschiedlich sein können. Wir haben unterschiedliche Auffassungen davon, was ein glückliches Leben ist, wie wir leben wollen, wie ein guter Staat aufgebaut wäre, aber dieser ganze Dissens wird genutzt, um am Ende dazu zu kommen, dass alle zustimmen könnten.
Jugov: Genau, Rawls geht von dem Faktum des Pluralismus aus. Er geht eben davon aus, dass wir uns fundamental uneinig sind in Bezug auf letzte Fragen, also so was wie religiöse Fragen. Sie sind vielleicht überzeugter Katholik, ich bin vielleicht überzeugte Muslima, wir sind uns beide ganz sicher, dass wir recht haben in unserem Glauben, aber wir stehen jetzt vor dem Problem, eine gemeinsame politische Ordnung irgendwie etablieren zu müssen, die uns beiden gegenüber gleich gut rechtfertigbar ist. Das heißt, dieser Pluralismus ist fundamental bei Rawls.
Er sagt natürlich, die Leute müssen irgendwie noch vernünftig sein, aber er geht davon aus, dass wir in der öffentlichen politischen Kultur bereits Ideen haben – wie zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Fairness –, die wir auf eine Art und Weise ausbuchstabieren können, dass sie im Set verschiedener Leute gegenüber gleich gut gerechtfertigt werden können, unabhängig von deren letzten Konzeption des Guten, ob die jetzt ihr ganzes Leben mit Tennis verbringen wollen oder mit In-die-Kirche-gehen, sich dort sehr stark engagieren. Er sagt, es gibt einen übergreifenden Konsens, der die Wurzeln in verschiedenen letzten Überzeugungen hat, aber das, worin wir uns alle einig sind, das sind eben Normen und Werte für den öffentlichen, für den politischen Gebrauch.
Beeinflusst von Widerstandsbewegungen
Fischer: Das ist ja etwas, was sehr zeitgemäß klingt, wenn wir an all die Spaltungen unserer Gesellschaften denken, sowohl in den USA als auch in Westeuropa, und trotzdem wurde Rawls vorgeworfen bisweilen, dass er den Dissens und das Konfliktpotenzial eigentlich immer noch unterschätzt. Es kann ja Leute geben, die wollen gar nicht diskutieren, die lehnen den Liberalismus ab. Die sagen, Liberalismus, das ist einfach nur eine Partei unter vielen, die diskutieren. Kann Rawls das fassen?
Jugov: Das finde ich auch eine interessante Frage. Gerade Rawls wird ja aktuell auch vorgeworfen, dass er das Agonistische, das Politische der politischen Philosophie ein bisschen verkennt, in den Hintergrund rückt, und ich finde das eigentlich nicht ganz richtig, wenn man sich auch die historische Situation überlegt, von der er schreibt, er ist da ganz stark zum Beispiel auch von Widerstandsbewegungen gegen den Vietnamkrieg in den USA beeinflusst und so weiter. Da herrschen ja auch schon wilde Kämpfe zu der Zeit, das stimmt ja nicht, dass das eine ganz apolitische Zeit ist. Rawls hat auch sehr viele Vorbehalte gegen Machtkonzentration, gegen Kapitalakkumulation und so weiter.
Ich glaube, Rawls hat Argumente darüber, wann wir mit Personen nicht mehr sehr gut reden können, aber es ist keine Theorie deliberativer Demokratie wie bei Jürgen Habermas. Er will eigentlich Gerechtigkeitsprinzipien entwerfen, das heißt, das sind schon abstrakte Prinzipien, wo wir sagen können, dann wäre die Gesellschaft gerecht, wenn wir diese Prinzipien tatsächlich irgendwie realisieren können, danach kommen aber noch vier Schritte, wie die dann umgesetzt werden müssen.
Das heißt, er erhebt auch nicht für sich den Anspruch, mit diesen Prinzipien schon den ganzen politischen Prozess beschrieben zu haben, das sind eher so was wie Argumente, die man im politischen Prozess bringen kann, wenn man zum Beispiel sagen kann: Okay, du willst Besteuerung progressiver Art abschaffen, dann gib mir doch mal deine Argumente dafür! Aber die Leute müssen natürlich immer schon konsenswillig sein, sonst bräuchte ich Gerechtigkeitsprinzipien auch nicht auspacken, wenn sie mir schon mit Gewalt gegenüberstehen.
Aber ich glaube, dieser Zeitpunkt ist wirklich sehr spät, und davor reichen Argumente sehr weit, und das ist die Grundidee, dass wir erst mal Argumente benötigen, um politische Ordnung zu rechtfertigen.
Fischer: Und trotzdem gibt es den Vorwurf, dass da eigentlich ein Zirkelschluss vorliegt, dass er eigentlich nur expliziert, was sowieso schon da ist – ein Staat, der relativ gut gefestigt dasteht mit einer Rechtsordnung, der liberal gesinnte Bürger hat, der ökonomisch vielleicht auch ganz gut dasteht. Was ist dran an diesem Vorwurf?
Jugov: Ich glaube, in gewisser Hinsicht ist es richtig, weil Rawls gar nicht so ein Universalist ist, wie ihm das immer vorgeworfen wird. Ich finde, er hat im Laufe seines Werkes eine eher hegelianische Bewegung gemacht und immer deutlich gemacht, dass die Fundierung seiner Theorie eigentlich auf Ideen aufbaut, die latent in der öffentlichen Kultur schon vorhanden sein müssen.
Das heißt, in gewisser Hinsicht richtet er sich tatsächlich an Gesellschaften, die sich selber schon als egalitär und liberal verfasste begreifen, und sagt dann: Ja, okay, wenn das die Werte sind, die ihr akzeptiert, wie genau können wir das denn ausgestalten? Das ist ein Punkt, den Habermas ihm zum Beispiel schon früh vorgeworfen hat: Was macht man denn mit Gesellschaften, die das nicht für sich in Anspruch nehmen, so schon zu sein? Da, finde ich, stimmt der Vorwurf des Zirkelschlusses ein bisschen.
Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Rawls einfach was beschreibt, was wir schon haben – eben den skandinavischen Wohlfahrtsstaat. Das geht in den Umverteilungsforderungen, in der Forderung nach wirklicher Chancengleichheit weit über das Bestehende hinaus, was, glaube ich, irgendwo auf der Welt sozusagen schon erreicht wäre, und da ist Rawls, finde ich, nach wie vor eigentlich ein sehr radikaler Denker.
Zwei Stufen seiner Theoriebildung
Fischer: Es gibt eine Kritik, die ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, aber ich bringe sie mal auf: dass dieser Herr einfach ein wenig blind ist gegenüber dem, was heute in der Identitätspolitik kritisiert wird, zum Beispiel, er sei rassismusblind gewesen. Er stellt sich eigentlich so einen White Anglo-Saxon Protestant vor als den, der da diskutiert. Man muss vielleicht sagen, trotzdem, er hat ja die Bürgerrechtsbewegung miterlebt und gesehen. Kann man jemandem so etwas vorwerfen?
Jugov: Ja, das ist so ein bisschen, würde ich auch sagen, ein unfairer Vorschlag, und ich finde, die Leute, die das in der Debatte wirklich machen wie Charles Mills zum Beispiel, die Rawls für eine gewisse Abstraktion oder Idealisierung kritisieren, die sind da vorsichtiger. Die wissen genau und sagen das auch, dass Rawls zum Beispiel eben sehr stark bewegt von der Rassenfrage in den USA war, und dass das genau eines der Probleme war, die er gesehen hat und die er überwinden wollte mit seiner Theorie. Ich glaube, es gibt einen Vorwurf, der in der Tat wichtig ist.
Und das ist: Rawls hat zwei Stufen in seiner Theoriebildung, eine ideale Theorie und eine nicht-ideale Theorie, und er geht erst mal davon aus, dass wir diese Gerechtigkeitsprinzipien in der idealen Theorie für so eine ideale Ebene der Theoriebildung formulieren. Ich meine, auf der einen Seite adressiert das natürlich gerade gut so rassistische Probleme. Wenn Sie sagen, Sie müssen sich jetzt Gerechtigkeitsprinzipien aussuchen für eine Gesellschaft, wo Sie eben nicht wissen, ob Sie weiß oder schwarz sein werden, dann denken Sie vielleicht zweimal nach.
Also bis zu einem gewissen Grad adressiert das natürlich Probleme des Rassismus, aber ein Vorwurf, der gerade aktuell oft genannt wird, ist, er abstrahiert eben von partikularen historischen Fakten über eine bestimmte Gesellschaft. Zum Beispiel die spezielle Geschichte der Sklaverei in den USA. Und dass das sozusagen zu einer so tief verwurzelten Art von strukturellem Rassismus geführt hat, dass diese Gerechtigkeitsprinzipien, die Rawls dann designt, das Differenzprinzip, das irgendwie nicht mehr fassen können. Also Reparationszahlungen zum Beispiel können auf idealer Ebene so nicht begründet werden.
Auf der anderen Seite muss man Rawls dann auch immer verteidigen und sagen, aber es gibt ja auch noch die nicht-ideale Ebene der Theoriebildung, von der er zugibt, dass es die drängendere ist, dass hier sozusagen die wirklich drängenden politischen Fragen liegen und wo er auch sagt, auf dieser nicht-idealen Ebene müssen wir jetzt gucken, wie wir die Prinzipien anwenden. Und das könnte dann meiner Lesart nach durchaus so was wie Reparationszahlungen auch umfassen.
Zur Identitätspolitik, wenn ich noch darf, weil Sie danach eigentlich gefragt hatten: Rawls ist im Herzen schon ein Liberaler, ich glaube, er hat natürlich eine Schwierigkeit, Politiken zu begründen, die sich jetzt auf einer idealen Ebene nur an bestimmte soziale Gruppen richten. Aber wiederum hier könnte man sagen: Wenn ich jetzt das Gerechtigkeitsprinzip der Chancengleichheit habe, und ich sehe, das ist in einem Land wie Deutschland überhaupt nicht verwirklicht, denn welche Kinder kommen bei uns an der Universität an, dann heißt das natürlich nicht, dass ich auf nicht-idealer Ebene nicht sehr viel machen kann, um dieses Gerechtigkeitsprinzip zu erreichen. Das sind natürlich Maßnahmen, die sich dann auch an spezielle Gruppen richten. Und ich glaube, hier ist natürlich auch Raum für identitätspolitische Erwägungen.
Politische Institutionen als wichtige Einheit
Fischer: Ist es ein Modell, das am Ende den Menschen viel zu atomistisch denkt? Es kommen immer nur Einzelne zusammen und diskutieren. Man könnte sich auch schon bei dieser Diskussion, wie man die Gesellschaft aufsetzt, denken, auch da könnten sich doch Grüppchen zusammentun. Menschen empfinden sich als Angehörige von Wertesystemen, von Religionen.
Jugov: Ja, das war eine wichtige Kritik, die erste Welle der Kritik an Rawls. Die kommunitaristischen Einwände gingen genau in so eine Richtung, dass die gesagt haben – die haben auch allerdings immer den Urzustand wirklich nur als zentralen Bestandteil der Theorie behandelt, da gibt es ja noch andere Bestandteile –, und die haben aber gesagt: Wir haben kommunitäre Werte, die werden nicht richtig abgebildet in diesem Denkexperiment des Urzustands, weil sich hier eben die einzelne ja immer nur vorstellt, sie kennt ihre soziale Position und so nicht, was ist denn jetzt mit Bindungen nationaler oder kommunitärer Art, die wir nun mal haben. Und ich glaube, Rawls ist da schon liberal, er erlaubt natürlich diese Bindungen. Also die sind nicht schlecht, die sind nur keine gute Quelle, um Gerechtigkeitsprinzipien zu begründen in Rawls Sicht.
Das heißt aber natürlich nicht, dass Menschen sich nicht sehr stark gebunden fühlen können, zum Beispiel an eine soziale Gruppe oder Kultur. Ich glaube, die Einheit, die bei Rawls wirklich einen normativen Eigenwert hat und sehr wichtig ist, sind politische Institutionen. Also da ist er eigentlich auch wieder nah an Habermas, weil politische Institutionen einen Eigenwert haben, der fundamental ist und meiner Lesart nach auch über ein individuelles Muss deutlich hinausgeht. Rawls geht ganz stark davon aus, dass wir alle, auch der Millionär, immer schon geprägt sind von den sozialen Kooperationsbedingungen, die unsere politischen Institutionen bereitstellen. Das heißt, die Institutionen kommen in gewisser Hinsicht immer zuerst, und die einzelne kommt danach, und dieses Wechselverhältnis zu theoretisieren, ist ihm, glaube ich, sehr wichtig.
Fischer: Frau Jugov, lassen Sie uns schauen, was Rawls für Folgen für die Theorie des Sozialstaats gehabt hat. Es ist jetzt immer schon ein paar Mal angeklungen. Er ist ja zu Grundsätzen gelangt, die dann helfen auszubuchstabieren, wie ein Sozialstaat ausgestaltet werden sollte. Was heißt das denn jetzt? Wie linksliberal ist so ein Sozialstaat nach John Rawls?
Jugov: Ja, witzigerweise sagt Rawls in seinem vierten Buch, finde ich, auch relativ eindeutig noch mal in Gerechtigkeit als Fairness, dass er eigentlich einen kapitalistischen Wohlfahrtsstaat ablehnt, und zwar weil die Armen da auf so eine Art behandelt werden, so eine alimentierende, großzügige "Hier, wir geben euch was, obwohl ihr es euch eigentlich nicht verdient habt"-Art und Weise. Ich glaube, Rawls begründet eigentlich einen anderen Staat, der fundamental davon ausgeht, dass wir eben immer schon in reziproken gesellschaftlichen Zusammenhängen leben: Also auch der Millionär ist irgendwo zur Schule gegangen, dann gab’s Eigentumsrechte, die sein Erbe erlaubt haben, dann war seine Lehrerin auf eine bestimmte Art und Weise ausgebildet.
Also wir leben immer schon vor dem Hintergrund sozialer Kooperationsverhältnisse. Und deswegen geht es nicht darum, umzuverteilen in einem großzügigen Modus, sondern es geht darum, uns zu verstehen als Mitglieder einer Gesellschaft, in der wir immer schon reziprok kooperieren müssen, und dass Gesetze das auf eine bestimmte Art und Weise ermöglichen oder eben auch nicht ermöglichen. Und diese Gesetze, die institutionelle Grundstruktur, gilt es eben gerecht auszugestalten. Das ist eigentlich Rawls' Hauptanliegen. Und was heißt das jetzt für den Wohlfahrtsstaat?
Er sagt, fundamentale Chancengleichheit heißt einfach, wenn Sie sich verschiedene Berufsgruppen angucken, zum Beispiel Mediziner, Professoren und Supermarktkassiererinnen, dann muss eigentlich die Verteilung gleich sein zwischen Kindern aus verschiedenen Einkommensschichten, die diese Berufe ergreifen. Ich glaube, das ist was, das ist klarerweise nicht erreicht, weder in unserer Gesellschaft noch in skandinavischen Gesellschaften noch in irgendwelchen anderen Gesellschaften. Das ist eigentlich auch schon eine sehr harte Forderung, wenn Sie wirklich Chancengleichheit so ausbuchstabieren, wie Rawls das tut. Aber das, wofür er eigentlich bekannt ist, ist das Differenzprinzip, und das besagt eben, Unterschiede in Einkommensverteilungen, also sowohl Arbeit als auch Vermögen, müssen der am schlechtesten gestellten Gruppe gegenüber gerechtfertigt werden können.
Das heißt, nehmen Sie jetzt die Einkommensunterschiede zum Beispiel zwischen einer Pflegekraft im Krankenhaus und dem Manager des Krankenhauses, da ist ja ein großer Einkommensunterschied. Jetzt können wir anhand des Differenzprinzips fragen: Ist dieser Unterschied gerecht? Rawls möchte schon marktwirtschaftlichen Erwägungen Raum geben, indem er sagt, ja, es kann Gründe geben, dass wir für Arbeit ungleich bezahlen, zum Beispiel, weil die Gesamtproduktivität auf eine Art und Weise erhöht wird, dass dann auch die Pflegekraft noch davon profitiert.
Aber der Unterschied darf eben nur so groß sein, dass die Pflegekraft noch von diesem Unterschied profitiert. Und ich glaube auch, mit diesem Differenzprinzip könnte man gerade Vermögensverteilung, aber auch Einkommensverteilung weit über das skandinavische Wohlfahrtsstaatsmodell hinaus kritisieren. Rawls selber übrigens vertritt eben nicht ein kapitalistisches Wohlfahrtsstaatsmodell, sondern zwei Eigentumsmodelle, die er demokratische Eigentümer-Demokratie, Property‑Owning Democracy, oder auch einen demokratischen Sozialismus nennt – das sind die zwei Eigentumsordnungen. Ihm ist eben auch sehr wichtig, dass Eigentum und Produktionsmittel sehr plural verteilt sind und dass es eben keine Kapitalakkumulation gibt. Also an der Stelle trifft er sich eigentlich sehr wohl fast ein bisschen mit marxistischen Kritiken an Kapitalakkumulation.
Fischer: Ihm wurde ja schon relativ früh vorgeworfen, dass er eine Theorie des Sozialstaats beschreibt, wie auch immer man das jetzt nach Ihren Ausführungen versteht, in dem Moment, in dem eigentlich der Sozialstaat im westeuropäischen oder auch amerikanischen Raum eigentlich abgebaut wird. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Theorie des Sozialstaats - so wie eine Eule - sowieso schon zu spät kommt?
Jugov: Ja, auch wieder da kann man natürlich fragen, ist das Argument an sich schon diskreditiert, weil empirisch die Welt sich dann anders bewegt hat. Ich glaube, natürlich kam der Thatcherismus, der Reaganismus, der Neoliberalismus später, kam nach Rawls, und hat sich jetzt nicht Rawls' Theorie der Gerechtigkeit scheinbar durchgelesen und sich daran gehalten. Und es ist vielleicht auch was dran an der Kritik, dass dann die Diskussion innerhalb der politischen Philosophie so technisch um Kleinigkeiten drehte – also es waren sich alle einig, liberaler Egalitarismus it is, also wir einigen uns sozusagen darauf, dass wir den liberalen Wohlfahrtsstaat eigentlich alle wollen, und reden dann darüber, ob für natürliche Talente wirklich noch umverteilt werden muss oder nicht.
Das ist ja die Kritik, da hätte man eigentlich schon andere Feinde angehen müssen zu dem Zeitpunkt, eben Kapital und Akkumulation oder so. Ich finde, das ist so ein bisschen schwierig, das der politischen Theorie vorzuwerfen. In gewisser Hinsicht stimmt das vielleicht, aber ich finde, es gibt in Rawls auch viele verschiedene Argumente, deswegen ist er ja auch so wahnsinnig dominant geworden, die man auch auf den Neoliberalismus anwenden kann und die uns eigentlich ein verheerendes Urteil über neoliberalistische Strömungen an die Hand geben. Das hätte man vielleicht noch besser übersetzen und in die Welt hinaustragen müssen, aber da ist ja immer die alte Frage, wie viel wir Philosophen dann tatsächlich bewirken können.
"Rawls ist im Grunde seines Herzens ein Liberaler"
Fischer: Lassen Sie uns einen Schlenker machen ein wenig weg von der Ökonomie, die da im Hintergrund wirkt, hin zum Recht und hin zu einer globalen Ebene. Wenn wir jetzt die Beziehung der Staaten zueinander denken beziehungsweise wenn wir Rawls’ Modell auf die gesamte Welt ausdehnen, dann ist ein Weltstaat denkbar, aber das ist nicht das, was Rawls vorschwebt. Er kommt nicht zu dem Gedanken, dass er sagt: In diesem imaginären Urzustand könnten sich auch alle Leute dieses Planeten zusammensetzen, und ich müsste dann sozusagen einen Weltstaat entwerfen, in dem ich auch immer die Ärmsten auf dieser Welt mitbedenke und womöglich etwas umverteile. Seine Ebene ist dann doch am Ende die der Staaten und der Zwischenstaatlichkeit. Warum?
Jugov: Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist, weil Rawls im Grunde seines Herzens eben ein Liberaler ist und auch international verschiedene Ordnungen politischer Art, nicht religiöser oder so letzter moralischer Überzeugung, aber verschiedene Ordnungen respektieren möchte.
Ich glaube, deswegen hat Rawls ein Völkerstaatenrecht entworfen, das viele seiner Anhänger sehr enttäuscht hat. Als Rawls die Theorie der Gerechtigkeit schreibt, gibt es Schüler dann in den '80er-, '90er-Jahren, die sich eben mit dieser Frage beschäftigen: Was heißt das denn jetzt für die globale Welt? Das ist jetzt eine Gerechtigkeitstheorie für den nationalen Raum, aber die Unterschiede global sind ja noch viel, viel drängender. Wir haben eine Hungersnot in Bengalen zum Beispiel '72, als Peter Singer seinen bekannten Aufsatz über Hilfspflichten schreibt – und was machen wir jetzt damit?
Rawls hatte eine Reihe von Schülern, die ihn in diese kosmopolitische Weltstaatsecke, wie Sie sie jetzt genannt haben, drängen, und sagen, wir müssen das vom Individuum her denken und wir müssen eine kosmopolitische Ordnung entwerfen, in der wir jetzt auch Gerechtigkeitsprinzipien zum Anschlag bringen. Und Rawls schreibt dann sein drittes Buch über Völkerrecht spät, und dieses Buch ist eine große Enttäuschung eben für diese kosmopolitischen Schüler, weil er jetzt Staaten, er nennt sie Völker, verteidigt und eigentlich so eine Art internationale Völkerrechtsarchitektur entwirft, wie wir sie auch schon haben. So manche sagen, das ist ja die Charta der Vereinten Nationen, was wir hier normativ noch mal unterfüttert haben.
Ich glaube, Rawls hat aus seiner Sicht gute normative Gründe, das so zu machen, und der erste ist eben, er ist liberal, er möchte verschiedene Ordnungen, auch nicht liberale Ordnungen jetzt achten, und um das zu tun, entwirft er so eine Kunstfigur der achtbaren Völker. Er sagt, liberale Völker und achtbare Völker würden sich jetzt wiederum in einem internationalen Urzustand – also das ganze Denkexperiment wird auf zweiter Ebene jetzt noch mal durchgeführt – einigen auf eine Völkerrechtsordnung, und die bezieht sich aber eben auch auf idealer Ebene schon auf achtbare Gesellschaften.
Belastete Gesellschaften in Rawls' Theorie
Fischer: Das heißt was?
Jugov: Ja, der hat da so eine Kunstfigur eines Volkes, die er Kazanistan nennt, das sind im Grunde Gesellschaften, die durch eine Gerechtigkeitsvorstellung, wie er das sagt, wirksam geleitet werden, aber die muss nicht so stark individualistisch sein und sie muss nicht so stark egalitär sein, wie jetzt Rawls’ eigene Gerechtigkeitsvorstellung das vorschreibt. Also es müssen zum Beispiel keine Demokratien sein. Diese achtbaren Gesellschaften müssen ihre Bürger noch konsultieren, aber was das genau heißt, ist so ein bisschen unklar. Sie müssen Menschenrechte achten, sie müssen nach außen hin friedlich sein, also keine Aggressionskriege führen, aber sie sind eben keine liberalen Völker, das ist sozusagen der Clou der Sache.
Fischer: Wo liegt denn da jetzt die Schmerzgrenze? Was ja für uns heutzutage auch sehr interessant wäre, gerade vor dem Beispiel Afghanistan. Da könnte man schon sagen: Ob das noch ein achtbarer Staat ist, wenn es überhaupt ein Staat ist? Also wo ist da die Schmerzgrenze bei Rawls, denn er ist ja erst mal sehr zögerlich, was Interventionen angeht.
Jugov: Ich glaube, Afghanistan wäre wahrscheinlich in Rawls’ Typologie, die jetzt auch wieder sehr theoretisch ist und eine Typologie eben, um am Ende wieder einen normativen Punkt zu machen, - Afghanistan wäre klarerweise keine achtbare Gesellschaft mehr, denn auch international hat Rawls zwei Teile in seiner Theorie: einmal die ideale Ebene und einmal die nicht-ideale Ebene.
Und da geht’s um Gesellschaftsformen, die eben noch nicht achtbar sind. Die nennt er witzigerweise auch nicht Völker, weil sie eben keine moralischen Kapazitäten haben, und das sind belastete Gesellschaften, wie er sie nennt, Schurkenstaaten. Belastete Gesellschaften sind Staaten, die sehr stark belastet sind durch Umstände, zum Beispiel einfach durch fehlende ökonomische Ressourcen, fehlende politische Kultur aber auch, und das sind eben alles Staaten, die diese "common good conception of justice", also diese gemeinsame Gerechtigkeitsvorstellung, die Institutionen wirksam leitet, unterlaufen.
Ich meine, so minimal oder so stark Rawls versucht das abzuschwächen, - dieses Konsultationshierarchie nicht ganz demokratisch und es ist noch gerecht, aber nicht individualistisch und so, - so eindeutig ist doch, dass eben Staaten wie Afghanistan jetzt bei Rawls nicht mehr als wohlgeordnet gelten würden, weil sie eben belastet sind und weil sie nicht mehr durch eine kollektive Gerechtigkeitsvorstellung wirksam geleitet werden.
Pluralismus global als Ausgangspunkt nehmen
Fischer: Wir haben schon ein wenig angesprochen, dass die Bedingungen, unter denen Völker leben oder Staaten existieren, problematisch sein können. Wenn wir jetzt auf die globale Wirtschaftsordnung blicken, dann kann man sich da auch fragen, was heißt das jetzt eigentlich, wenn man Rawls auf diese Ebene überträgt? Müssen zum Beispiel die reicheren Staaten ihre Güter verteilen an ärmere, kommt es dann zuVorwürfen wie dem, dass bestimmte Staaten zu Zahlmeistern gemacht werden? Wie denkt er sich am Ende diese Güterverteilung?
Jugov: Genau, also das, was seine kosmopolitischen Schüler kritisiert haben, dass Rawls nicht weit genug geht, ist immer noch ziemlich radikal, wenn man es auf die reale Welt überträgt, denn Rawls sagt, wir haben eine Hilfspflicht gegenüber belasteten Gesellschaften, also eben Gesellschaften, die noch nicht wohlgeordnet, wie er das nennt, sind. Und das heißt, wir haben eine Hilfspflicht, Ressourcen umzuverteilen, aber zum Beispiel auch dabei zu helfen, politische Kultur zu etablieren und so weiter. Er ist ganz eindeutig darin, dass es keine Interventionspflicht ist, also er ist sehr, sehr zurückhaltend gegenüber einem liberalen Interventionismus.
An der Stelle ist ihm eben dieses Toleranzprinzip sehr wichtig, und er sagt, auch wenn wir es lieber anders hätten, müssen wir Pluralismus auch global als Ausgangspunkt nehmen, also wir dürfen nicht intervenieren, aber wir haben eine Pflicht umzuverteilen. Also Zahlmeister, ich weiß nicht... Er schlägt auch Institutionen vor, wie wir sie schon haben, Vereinte Nationen, ein Äquivalent zur Weltbank und so weiter, und ich glaube, auch da wären die Effekte dessen, was er vorschlägt, radikal, auch wenn die Kritik aus philosophischer Ecke eben eher lautete: Aber das Differenzprinzip, was eine viel stärkere Umverteilung noch fordern würde, wurde hier gar nicht angewandt international! Es wurde ihm vorgeworfen, das sei aber jetzt sehr realistisch, sehr Status-quo-lastig, das sei gar nicht utopisch genug. Und ich glaube, wenn man die Hilfspflicht, die er etabliert, trotzdem ernst nimmt, wäre das trotzdem schon radikal und würde zu einer sehr starken Umverteilungspflicht führen.
Fischer: Eine Umverteilungspflicht hat ja auf der einen Seite ein utopisches Potenzial: Wir können anderen helfen, die in Not sind. Auf der anderen Seite hätte es auch etwas Lähmendes, denn jeder Staat müsste sich überlegen: Was mache ich für eine Politik und wie betrifft die eigentlich jeden Einzelnen, vor allem die Ärmsten in der Welt. Das kann lähmen, natürlich kann das auch zu einem globalen Bewusstsein führen.
Jugov: Ja, ich würde sagen, das müssen wir machen. In gewisser Hinsicht müssen wir uns ja eh überlegen, wie unsere Außenpolitik andere Länder betrifft. Ich finde es nur an der Stelle auch philosophisch falsch, was Rawls sagt, weil das eben so den Gestus einer großzügigen Umverteilungsleistung hat.
Die Kritik, wie sie von Charles Mills und anderen an der innerstaatlichen Theorie geübt wurde, kann man hier auch für die internationale Ebene, glaube ich, noch besser üben, dass man sagt; Rawls geht mit diesem zweistufigen Verfahren, mit der idealen und nicht-idealen Theorie, ja halt immer davon aus, dass Völker, die intern gerecht oder achtbar sind, sich ja Völkerrecht geben. Aber was wirklich keinen Raum mehr hat in der Theorie, sind bestehende Hintergrundungerechtigkeiten, zum Beispiel Folgen von Kolonialismus, von Ausbeutung, von Kapitalismus. Also das, was die letzten 300 Jahre passiert ist, hat ja extreme Folgen für die Verteilung von Reichtum zwischen Ländern. Da geht es sozusagen nicht nur darum, das Glück umzuverteilen, dass der eine auf reichen natürlichen Ressourcen sitzt und das andere Volk nicht. Das lehnt übrigens auch Rawls ab als nicht ganz wichtig.
Aber ich glaube, diese Kritik ist dann wichtig zu sagen, die Hintergrundstrukturen, die die Globalisierung heute regeln, die sind in diesem Modell nicht ausreichend mitgedacht, und deswegen darf es gar nicht nur darum gehen, zu bedenken, wem müssen wir jetzt helfen, weil wir so nett sind, sondern es geht darum, einfach auch wiedergutzumachen für globale Strukturen, die geschaffen worden sind durch Kolonialismus und Ausbeutung zum Beispiel. Und das ist etwas, wo Rawls wahrscheinlich tatsächlich Fakten hätte mitberücksichtigen müssen, schon auf idealer Ebene, um international zu anderen Gerechtigkeitsprinzipien zu kommen.
Rawls und die Flüchtlingsbewegungen
Fischer: Wenn wir jetzt von Staaten reden oder auch von Völkern, wie es bei Rawls der Fall ist, dann ist da ein wenig die Prämisse, dass wir da Regionen haben, in denen Menschen leben, und die leben da relativ statisch. Unsere Gegenwart ist davon gekennzeichnet, dass Menschen flüchten – vor Krieg, vor Hunger, vor möglicherweise immer mehr Naturkatastrophen. Kann Rawls diese Flüchtenden irgendwie fassen?
Jugov: Ja, das ist ein wichtiger Einwand auch. Er kann das erst fassen auf der nicht-idealen Ebene, wo es darum geht, dass leider eben nicht alle Staaten wohlgeordnet sind, und da kommt eben diese Hilfspflicht ins Spiel. Also erst mal müssten wir, glaube ich, Rawls zufolge Staaten weitestgehend vor Ort helfen, also Krieg überwinden, Hungersnot überwinden, die Folgen der Klimakatastrophe überwinden, sozusagen vor Ort, damit Menschen gar nicht erst flüchten müssen. Das ist bei Rawls immer das Ziel, gerechte Institutionen vor Ort schon zu schaffen und da die Energie reinzugeben. In der Tat spielen deswegen Flüchtlinge keine allzu große Rolle in seiner Theorie.
Andere Philosophen haben dann zum Beispiel versucht, das Rawls’sche Modell auf die Frage von Bewegungsfreiheit und Migration anzuwenden, und haben versucht zu zeigen, inwiefern eigentlich Rawls keine guten Argumente hätte oder man in so einem kontraktualistischen Rahmen nach Rawls keine guten Argumente hätte, um Bewegungsfreiheit stark einzuschränken. Ich glaube, das Asylrecht, da sind sich Philosophen ja sowieso weitgehend einig, das muss natürlich Geltung haben. Also wenn jemand gerade in seinem Heimatland stirbt oder verfolgt wird, dann gibt es natürlich eine Nothilfepflicht, die ist sozusagen theoretisch relativ unumstritten. Das, worüber der große Streit geht, ist eigentlich jetzt Migration und Bewegungsfreiheit.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.