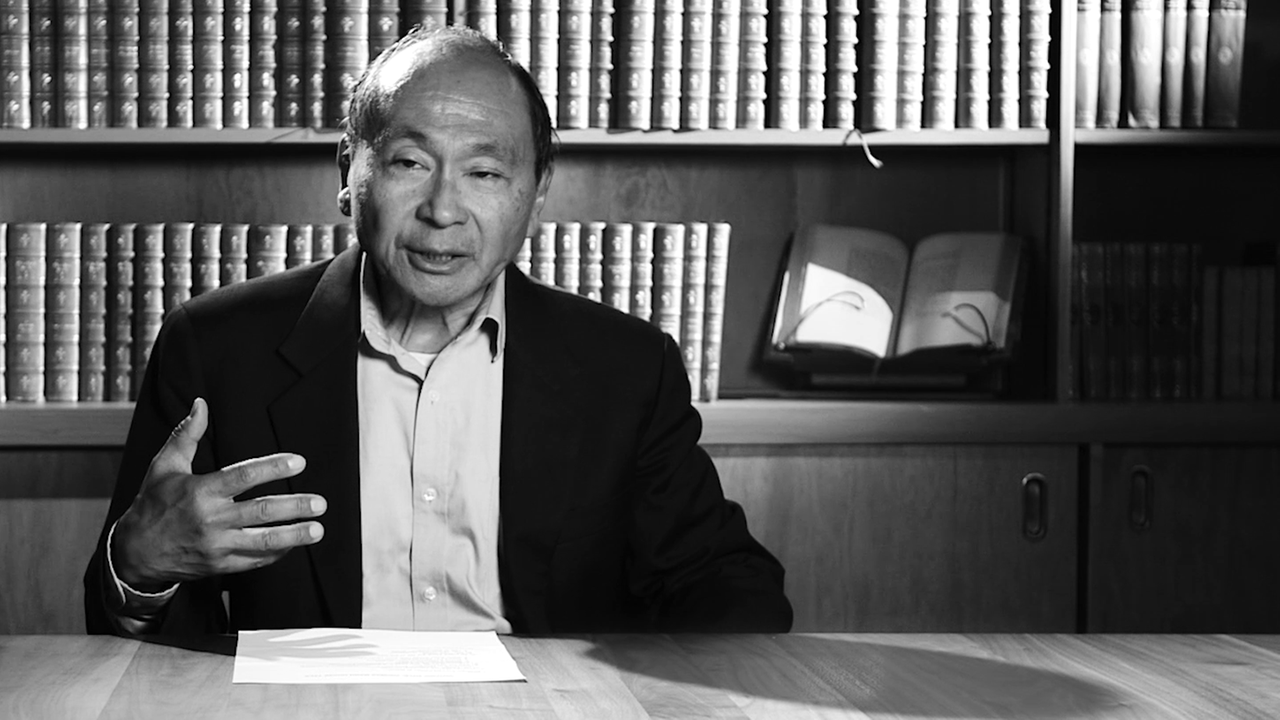Im Thomas Mann House in Pacific Palisades, Los Angeles, finden seit Oktober 2019 Vorträge mit Ideen zur Erneuerung der Demokratie statt. Unter den Vortragenden befinden sich die Politikwissenschaftler Francis Fukuyama und Jan Werner Müller, die Philosophinnen Seyla Benhabib und Judith Butler, die Schriftsteller Orhan Pamuk und Ngũgĩ wa Thiong’o, die Soziologin Ananya Roy, der Germanist Jan Philipp Reemtsma, die Historiker Martha S. Jones und Timothy Snyder.

Die Reihe wird präsentiert vom Thomas Mann House in Kooperation mit Deutschlandfunk, "Los Angeles Review of Books" und "Süddeutscher Zeitung".
Zweiter Essay zum Projekt "55 Voices for Democracy" von Stephanie Metzger
Ich sehe ihn nicht, den jungen Mann, der hinter der Wand sitzt und mir über Kopfhörer von seiner Flucht erzählt. Aber ich spüre ihn. Sanft und behutsam tupft er Farbe auf meinen Unterarm, den ich durch ein Loch in der Wand gesteckt habe. Zeichnet auf meine Haut eine Linie, ein Boot und kleine Figuren, die auf eine zweite Linie – die Grenze – zusteuern. Dazu höre ich andere Männer und Frauen von ihrer Flucht singen. Und von dem, was wir uns alle wünschen: Sicherheit, Normalität, Respekt.
In der Performance "As Far as my Fingertips take me" von Tania El Khoury aus Beirut und dem syrischen Künstler Basel Zaraa beim Spielart Festival in München geht es um Flucht und neue Heimat, um Berührung und Empathie. Und um Menschenwürde – auf den Prüfstand gestellt vor den Toren der Demokratien in Europa und in Amerika. Denn es geht um Werte, die Flüchtende so oft im Blau-Grau des Mittelmeers ertrinken sehen. Oder an den Mauern der Festung Europa abprallen sehen. An Grenzen also. Landschaften des Todes, geboren aus Rassismus, nennt die Soziologin Ananya Roy sie. Und bringt sie mit einer anderen Linie in Verbindung: der "color line". Als "color line" bezeichnete der amerikanische Soziologe William E. B. Du Bois um 1900 die Spaltung zwischen schwarzen und weißen Menschen im Amerika des 20. Jahrhunderts. Bis heute fallen ihr Menschen zum Opfer – in Todeszonen. Diese sind das genaue Gegenteil von dem Europa, das sich der deutsche Schriftsteller Thomas Mann einst erträumte. Im Januar 1943 wandte er sich mit seiner europäischen Vision nicht nur an "Deutsche Hörer!", so der Titel der Radioansprachen damals, sondern an die europäischen Hörer:
"Das wahre Europa wird von euch selbst mit Hilfe der Macht der Freiheit geschaffen werden. Es wird eine Föderation gleichberechtigter freier Staaten sein, die in der Lage sein werden, ihre geistige Unabhängigkeit und Selbstverständlichkeit, ihre traditionellen Kulturen zu pflegen, während sie zugleich einem gemeinsamen, allgemein gültigen Gesetz der Vernunft und Moralität unterstehen, einer europäischen Föderation im größeren Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der zivilisierten Völker der Welt."
Sowohl als kulturelle Idee, wie auch als Konzept für eine Staatenföderation stellte Europa für Thomas Mann die Vorstufe zu einer "Weltdemokratie" dar. In einer umfassenden Neuordnung der Welt könnte die gesamte Menschheit Freiheit und Frieden erlangen, so die Hoffnung des Autors. Die Nationalstaaten hätten in dieser Neuordnung ihr Gewicht verloren. Der Humanismus würde notfalls militant verteidigt. Bindend wäre für die gesamte Weltbevölkerung eine Art "Magna Charta" des Menschenrechts. Thomas Mann dachte groß. Er glaubte an die globale Durchsetzung demokratischer Werte. Ein Vertrauen, das der Blick auf unsere Gegenwart Lügen strafen könnte. Was nichts daran ändert, dass bei aller Konfrontation mit den Todeszonen und -landschaften unserer Tage Demokratien vielerorts relativ stabil sind. Und selbst wenn Demokratien mancherorts gefährdet sind, dort eine konstruktive Perspektive möglich ist. Genau in diesem Sinne erweisen sich sowohl Ananya Roy als auch Jan Philipp Reemtsma als Erben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Ihre Reden aus dem Projekt "55 Voices for Democracy" werden im Rahmen dieses Essays auszugsweise zu hören sein.
Ananya Roy: Ökonomische Netzwerke sind Netzwerke des Rassismus
Ananya Roy beginnt ihren Vortrag mit dem Hinweis auf eine Landkarte. Darauf sehr dünne, fast zarte schwarze Linien, die die beiden Hemisphären auf dem gelblichen Papier verbinden. Diese Linien zwischen Afrika, Amerika und Europa stellen die historischen Routen des transatlantischen Sklavenhandels dar. Der amerikanische Soziologe William E.B. Du Bois hat sie im Jahr 1900 in diese Landkarte für die Pariser Weltausstellung eingetragen. Die Darstellung war nur ein Ausstellungsobjekt in der "Exhibition of American Negroes", die Du Bois in Paris zeigte: Statistiken, Bücher und Fotografien über die Geschichte, Gegenwart und Kultur der Schwarzen. Der Mitbegründer der Bürgerrechtsbewegung Du Bois erforschte das Leben der Schwarzen in Amerika sowie ihre Unterdrückung, gegen die er ankämpfte. In seiner Abbildung des Sklavenhandels visualisierte er so nüchtern wie eindringlich, dass ökonomische Netzwerke nichts weniger waren als Netzwerke des Rassismus. Und dies gilt bis heute, sagt Ananya Roy. Sie ist Professorin für Städteplanung, Sozialfürsorge und Geografie sowie Leiterin des Institutes für Ungleichheit und Demokratie an der University of California, Los Angeles. In ihrer Arbeit behandelt sie Fragen zu Armut und Ungleichheit. Dabei analysiert Roy weniger die soziale Realität von Armut als ebenfalls Netzwerke. All die staatlichen und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten also, mit denen Armut verwaltet und als Problem gelöst werden soll. Diese Aktivitäten sind laut Roy zutiefst von Marktmechanismen und rassistischen Strukturen geprägt; auch aktuelle liberale Demokratien gründeten auf ihnen. Von diesem desillusionierenden Befund geht Roy auch in ihrer Rede für das Projekt "55 Voices for Democracy" aus – um dann dennoch zu träumen:
"All dem zum Trotz möchte ich anlässlich des Gedenkens an Manns Radioansprachen ein Plädoyer für radikale Demokratie halten. Während einer Vortragsreise durch die USA sprach Mann 1938 nicht nur vom Faschismus, sondern auch vom 'zukünftigen Sieg der Demokratie'. In jenen dunklen Zeiten schwebte Mann 'die soziale Erneuerung der Demokratie' vor. Er glaubte, dass 'Europa, die Welt reif für den Gedanken einer umfassenden Reform der Besitzordnung und der Güterverteilung' seien. In ebenjenem historischen Moment imaginierte auch Du Bois die Rekonstruktion der amerikanischen Demokratie, indem er 1935 den langen Kampf gegen die Sklaverei nachzeichnete und den Traum von emanzipierten Arbeitsverhältnissen und der Umverteilung von Eigentum und Einkommen in den Vordergrund rückte. Diese Träume waren, wie der Historiker Robin Davis Gibran Kelley schreibt, 'Freiheitsträume'.
Die Gegenwart: eine Zeit der Ausbeutung und der Freiheitsträume
Ich behaupte, dass unsere Zeit nicht nur eine der Ausbeutung und Exklusion ist, sondern auch eine der Freiheitsträume. In den USA hat das Trump-Regime die Idee der weißen Vorherrschaft gefüttert und institutionalisiert, wodurch gleichzeitig eine landesweite Grundsatz-Diskussion über Reparationszahlungen an Schwarze entstanden ist. Wie Kelley in seinem Buch 'Freedom Dreams' schreibt, geht es bei der Frage um Reparationen grundlegend um schwarze Selbstbestimmung, wozu auch autonome Institutionen und Räume gehören. Während in den USA die neoliberale Umstrukturierung des Hochschulsystems zu einer gigantischen studentischen Verschuldung von 1,5 Billionen Dollar geführt hat, ist gleichzeitig das politische Interesse gestiegen, studentische Schulden zu annullieren und die Hochschulbildung allen zugänglich zu machen. Und während in wachsendem Maße Menschen systematisch entmietet werden, wird auch der Ruf nach einem ambitionierten Plan für den sozialen Wohnungsbau innerhalb des Green New Deal laut, ebenso wie der Ruf nach der Einführung einer nationalen Mietpreisbremse.
(…) Es geht um nichts weniger, als die Infrastruktur unserer Lebenswelt wieder zurück in öffentlichen Besitz zu bringen, zum Beispiel die Bereiche Wohnen und Bildung. Gerade in Europa ist das derzeit zu sehen, wenn Bewegungen von Barcelona bis Berlin für Mieterrechte streiten und die Enteignung und Verstaatlichung des Eigentums globaler Banken und Immobilien-Konglomerate fordern. Thomas Mann war seinerzeit daran interessiert, dem Demokratiebegriff eine allgemeine Bedeutung zu geben, eine viel allgemeinere als jene, die der politische Aspekt des Wortes suggeriere. Ich bezeichne diese allgemeinere Bedeutung als radikale Demokratie – und der Schlüssel zu ihr sind die Prozesse der erneuten Vergesellschaftung von Eigentum."
Die schonungslose Konfrontation mit der Realität liberaler Demokratien erzeugt Freiheitsträume, sagt die Urbanistin und Armutsforscherin Ananya Roy. So massiv ihre Kritik an den heutigen liberalen Demokratien ist, so deutlich zeigt sie damit, wie innerhalb dieser doch Widerstände und Proteste möglich sind. Die Demokratie im Sinne der politischen Aushandlung lebt. Trotzdem stellt Roy das Institutionengefüge der gegenwärtigen Demokratien massiv in Frage. Und erinnert mit dem Schlagwort der "radikalen Demokratie", deren Vorstellung sie im Folgenden ausführt, an einen Kern des Begriffes "Demokratie": "Die Herrschaft des Volkes". Im Idealfall besteht dieses "Volk" aus vielen unterschiedlichen Individuen und Gruppen. Deren unterschiedliche Interessen finden im Gemeinwillen zusammen und wirken über diesen direkt auf politische Entscheidungen. Im schlechtesten Falle konstruieren Populisten und Autokraten ein Kollektivsubjekt "Volk", stellen sich vor dieses "Volk" und beanspruchen, dessen eine kräftige Stimme angeblich zu vertreten. Wer nun aber ist das Volk bei Ananya Roy? Es sind die Marginalisierten und Vergessenen. Auch hier nicht die Gesamtheit aller. Aber ein "Demos", der für Rechte eintritt, die er für alle gelten lassen will: Gerechtigkeit, Freiheit und Humanität. Ein universeller und globaler Anspruch, der zu Gehör gebracht werden sollte. Gerade wenn er von dort ertönt, wo solche Rechte noch nicht gelten.
Demokratie entsteht bei den Marginalisierten und Vergessenen
"Meine Theorie der radikalen Demokratie beruht auf zwei miteinander verwandten Ideen. Die erste besagt, dass die Freiheitsträume, die die Rekonstruktion der Demokratie beseelen, nicht von elitären Institutionen oder von staatlicher Macht ausgehen. Sie entstehen vielmehr aus Graswurzel-Bewegungen und Bewegungen, die sich gegen Armut engagieren. Sie entstehen in Kollektivhandlungen, die aus dem Umstand gemeinsamer Prekarität hervorgehen – und zwar in Stätten 'organisierter Verlassenheit', einer Formulierung, die ich mir von der abolitionistischen Forscherin Ruth Wilson Gilmore leihe, um auf 'verlassene Orte' hinzuweisen. Der Demos der radikalen Demokratie besteht aus Mietervereinen, Schuldnerverbänden, schwarzen Zukunftsbewegungen, Bündnissen für Tagelöhner und Hausangestellte, Organisationen für die Rechte von Immigranten und Asylsuchenden, Koalitionen aus Ausquartierten und Landlosen, Netzwerken des indigenen Widerstands. Demokratie ist keine Garantie. Freiheit ist kein Geschenk. Gerechtigkeit ist keine Erbschaft. Radikale Demokratie muss in jedem historischen Moment, inklusive dem unseren, aufs Neue gefordert und geschaffen werden.
Die zweite Idee lässt sich auf die aristokratische Eigenschaft der Demokratie zurückführen, mit der Thomas Mann in seinem Essay 'Vom zukünftigen Sieg der Demokratie' rang, als er schrieb, dass in einer Demokratie, die das intellektuelle Leben nicht respektiert und sich nicht von ihm leiten lässt, die Demagogie freies Spiel habe. Lange haben wir angenommen, dass dieses intellektuelle Leben etablierten und elitären Institutionen entspringt. Die radikale Demokratie, von der ich träume und deren Entstehen ich gerade überall beobachte, wird angetrieben von rigorosen intellektuellen Visionen und globalen Theorien. Oft entstehen sie an vergessenen Orten. Anspruchsvolle Konzeptionen von Eigentum und Miete, von Schulden und Spekulation, von Anlagegütern und Sozialhilfe, von Einkommen und Profit wachsen heute innerhalb von gesellschaftlichen Bewegungen. Robuste Denkgerüste für Themen wie Zugehörigkeit, Recht und Zuflucht stammen heute von Hip-Hop-Musikern, inhaftierten Künstlern und Grenzaktivistinnen. Radikale Demokratie, das bedeutet nicht nur, dass wir die Infrastrukturen unserer Lebenswelten erneut vergesellschaften müssen. Es bedeutet auch, dass wir subalternes und unterdrücktes Wissen neu wertschätzen.
Die liberale Demokratie hat einen rassistischen Kapitalismus aufrecht erhalten
In der Geschichte der Moderne bestand die liberale Demokratie lange aus dem Bestreben, einen rassistischen Kapitalismus aufrecht zu erhalten, indem nur seine gröbsten räuberischen Eigenheiten abgemildert wurden. Die radikale Demokratie findet ihre Inspiration hingegen in einer Frage des Philosophen Walter Mignolo: 'Warum sollten wir den Kapitalismus retten wollen – und nicht die Menschen?'"
Es ist weniger eine Frage als ein Appell, den Ananya Roy an den Schluss ihrer Rede für das Projekt "55 Voices for Democracy" setzt: Nicht den Kapitalismus retten, sondern die Menschen! Und das klingt auch ein wenig nach Kampfansage. Denn die Demokratie lebt in der Konfrontation, sagen heute zumindest nicht unbedeutende Vertreter der Politischen Theorie und radikalen Demokratie. Chantal Mouffe etwa mit ihrem Konzept des "Agonismus", den es durch demokratische Institutionen einzuhegen gilt. Oder Jacques Rancière mit seiner Theorie vom Aufbegehren der Unvernommenen. Die Torpedierung des Bestehenden durch die Ausgeschlossenen – das Sichtbarwerden der Unsichtbaren – die Konfrontation als Inbegriff des Politischen und der Demokratie: In so einem revolutionären Sinne bilden die Befürworter einer radikalen Demokratie auch ein Echo auf den Redner Thomas Mann im April 1942:
"Die Demokratie blickt nicht zurück, sie blickt vorwärts. Sie ist im Begriffe, sich sozial zu verjüngen. Für sie ist die Revolution ( kein Vorwand für Eroberung, Plünderung und Unterjochung, sondern die Sache selbst,) die Menschheitssache, um die es geht."
Jan Philipp Reemtsma: Statt Konflikt und Krise den Konsens im Blick
Der Germanist und Publizist Jan Philipp Reemtsma zeigt sich im Gegensatz zu solchem Kampfesgeist weniger emphatisch. In seiner Rede zum Projekt "55 Voices for Democracy" fragt sich der Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung vielmehr, ob solche Emphase überhaupt nottut. Statt Konflikt, Krise und Kampf nimmt er eher den Konsens in den Blick. Darüber nämlich, was wir, wenn wir von Demokratie reden, als nicht verhandelbar annehmen sollten: den Schutz vor Grausamkeit und vor Machtmissbrauch. Dass der Autor auf diese Zurückhaltung und auf einer Minimaldefinition von Demokratie besteht, ist nicht überraschend. Hat er doch in Büchern wie "Gewalt als Lebensform" oder "Vertrauen und Gewalt" ergründet, wie Gewaltexzesse in modernen Gesellschaften möglich sind, die sich Gewalt doch eigentlich verboten haben. Hört man im Folgenden seiner Rede zu, merkt man aber auch, dass bei allem Understatement Demokratie auch für Reemtsma nicht wenig impliziert:
"Worum sollte es einem gehen, wenn man sich für Demokratie rhetorisch ins Zeug legen möchte? Handelt es sich um ein 'Projekt', wenn ja, um was für eins? Eines, für das es sich lohnt zu kämpfen? Bei Worten, hat ein kluger Mann einmal gesagt, tut man gut, alle Übergrößen zu vermeiden, und man sollte rhetorisch keine Krisen heraufbeschwören, nur um wie ein Kämpfer dazustehen. Nun sind Demokratien immer gefährdet, sie haben offene Feinde, oft bieten schlecht konstruierte Verfassungen Möglichkeiten, sie zu ruinieren. Man hört allerdings oft, die gefährlichsten Feinde der Demokratie seien lethargische und indolente Demokraten. Das mag sein, aber was ist denn sowas wie der oft beschworene 'kämpferische Demokrat'? Bin ich so einer? Sind Sie es? Sollten wir sowas sein? Was wäre denn ein Demokrat, der sich nicht bloß so nennt, weil Demokratie die 'am wenigsten schlechte Regierungsform' ist, von der man gehört hat, sondern der mit mehr Enthusiasmus aufzuwarten hat?
Die engagierten Demokraten des 18. Jahrhunderts, ob nun auf den Straßen vor den Mauern irgendeiner Bastille oder am Schreibtisch vor einem Blatt Papier, sagten, schrieben oder schrien, sie repräsentierten den 'Willen des Volkes'. Nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts zögern wenigstens die Nachdenklicheren, diese Formulierung zu gebrauchen. Karl Popper schrieb, dass Demokratie gar nichts mit irgendeinem 'Willen des Volkes' zu tun habe, sondern uns die Möglichkeit verschaffe, eine Regierung ohne Blutvergießen loszuwerden. Eine sanftere Version dieses Gedankens stammt von Adam Przeworski: Demokratie sei ein System, in dem Parteien Wahlen verlieren können. Mir gefallen diese Definitionen, und ich denke, man sollte mit ihnen weitermachen.
Der Liberalismus der Furcht als Minimum der Demokratie
Die große Philosophin Judith Shklar bestimmte die Idee der Demokratie andersherum. Entscheidend sei nicht allein, was Demokratie uns erlaubt, nicht tun zu müssen (wenn wir eine Regierung loswerden wollen), sondern wovor wir in einer Demokratie keine Angst zu haben brauchen. Sie sprach von einem 'Liberalismus der Furcht'. Die Idee der Demokratie, die von diesem Blick auf die Welt herstammt, besteht in dem einfachen Gedanken, dass wir unendlich viel gewonnen haben, wenn wir uns und einander erfolgreich vor dem Schlimmsten schützen können. Und 'Grausamkeit', sagte Shklar, 'ist das Schlimmste, was wir einander antun können' – und das Schlimmste, was uns widerfahren kann. Sie hat recht. Um uns vor diesem Schlimmsten zu schützen, müssen wir uns vor der Möglichkeit unumschränkter Machtausübung schützen und davor, dass Menschen eine Position in der Gesellschaft einnehmen können, in der sie unumschränkte Macht gewinnen können.
Demokratie in diesem Sinne ist ein Mittel zum Selbstschutz. Zunächst geht es um den Schutz von Minderheiten und zweitens um eine Art, wie die politischen Vorlieben von Mehrheiten durch Wahlen in politisches Handeln überführt werden können. Demokratie in diesem Sinne bedeutet: eine Verfassung mit garantierten Grundrechten für jeden und jede (ohne jede Ausnahme); ein transparentes Rechtssystem, das allen Schutz gewährt; Gewaltenteilung; ein unabhängiges System der Rechtsprechung; Redefreiheit, was heißt: freie und pluralistische Medien, die nur durch das Gesetz und nicht durch den Staat oder durch private Monopole kontrolliert werden. Politische Institutionen schließlich, die sich durch, wie man sagt, 'checks and balances' einigermaßen selbst regulieren. (…) Wenn wir davon sprechen, dass wir 'die Demokratie verteidigen' wollen, müssen wir dieses Minimum meinen.
(…) Wenn wir das tun, diskutieren wir auch nicht über einen bestimmten kulturellen Hintergrund, nennen wir ihn 'abendländisch' , 'afrikanisch', 'asiatisch' – wie auch immer wir ihn nennen, darum geht es nicht. Wenn mich jetzt jemand unterbricht und sagt, dieser Gedanke sei nur eine Art weichgespülter abendländischer Herrschaftsanspruch, antworte ich, dass ich diesen Verdacht verstehe und auch meine, dass dieser Verdacht zu Recht besteht und geäußert wird. Aber ich möchte darauf bestehen, dass der beste Weg, miteinander zu leben, nicht darin besteht, kulturelle Hintergründe für etwas zu halten, dem wir nicht entkommen können, sondern dass wir an Gesellschaften arbeiten sollten, in denen wir jeden kulturellen Hintergrund so ansehen können, als wäre er ein Stück weit unser eigener. Das ist anstrengend und braucht Zeit; aber Lernen ist doch eigentlich etwas, das Spaß macht."
Demokratie als Selbstschutz
Festhalten an einem Minimalverständnis von Demokratie als Selbstschutz: In diesem Beharren von Jan Philipp Reemtsma steckt mehr Konfrontationsbereitschaft, als der Redner offenlegt. Die Basisdefinition von Demokratie steht für ihn nicht in Frage. Weder kulturell, noch national oder individuell. Erst auf ihr kann der produktive Streit, dieser Treibstoff demokratischer Ordnungen, stattfinden. Muss es sogar. Und obwohl Reemtsma es so gar nicht zugeben würde, auch hinter diesem Anspruch steckt ein Traum von Freiheit. Freilich ist es mehr ein Traum über die Freiheit von etwas – von Gewalt, Furcht, Angst – als über die Freiheit zu etwas. Aber letztere, sagt Reemtsma, kann eben ohne jene andere Art von Freiheit nicht blühen. Wobei er ein Wort wie "blühen" sicher nicht verwenden würde. Darin unterscheidet sich Reemtsma vielleicht am allermeisten vom Redner Thomas Mann. Mit dem Verzicht auf Pathos und Emphase setzt er sich ab von der emotionsgeladenen Rhetorik des deutschen Exilanten während des Zweiten Weltkriegs. Nicht zuletzt weil solche Sprachformen inzwischen die Reden aus anderen, ganz undemokratischen politischen Lagern prägen. Und mit denen ist sicher kein Traum von Freiheit zu machen:
"Tatsächlich ist die Idee von Demokratie, die ich hier vortrage, eine defensive. Nicht, weil sie irgendwie schwach oder soll man sagen: kleinlaut wäre. Für alle, die eine Gesellschaft, in der die Stärksten, Brutalsten und Flegelhaftesten dominieren, fürchten – man überschaue die Geschichte, man sehe sich in unserer Welt um und braucht nicht zu suchen –, ist eine solche Idee nichts als selbstverständlich. Ja, es ist irgendwie unbefriedigend, das Selbstverständliche zu betonen. Aber wer das enttäuschend findet und möchte, dass ich jenseits dieses Selbstverständlichen noch dies und das und was immer ihr oder ihm am Herzen liegen mag, hervorkehre, bedenke, dass wir nur dann eine Chance haben, uns darüber zu verständigen, wenn wir es auf diesem sicheren Boden tun können. Für solche Debatten leben wir. (…)
Aber ist die Idee politischer Gleichheit (und darauf beruht ja die Idee der Demokratie) nicht witzlos ohne wirtschaftliche Gleichheit und wird sie nicht durch jede Form sozialer und wirtschaftlicher Privilegien oder Diskriminierungen beschädigt oder zerstört? Seien wir ehrlich: Sie wird nicht nur tangiert oder beschädigt, sondern oft zerstört durch Ungleichheiten und Unterprivilegierungen. Seien wir vorsichtig: Man erkläre die Idee der Demokratie, wie ich sie skizziert habe, deswegen nicht für bloßes Gerede. Der einzige Weg, den wir kennen, Ungleichheiten und Diskriminierungen zu bekämpfen oder wenigstens ihre Auswirkungen zu minimieren, ist, das in demokratischem Rahmen zu tun. Das kann man wahrscheinlich doch aus der Geschichte lernen. (…)
Ein karges Konzept ohne tönendes Pathos
Sie möchten eine glänzendere Rhetorik? Wenn Sie verstehen, dass – Demokratie betreffend – das Beste, was Sie bekommen können, dieses karge Konzept eines Schutzes der Bürgerinnen und Bürger vor Grausamkeit und unumschränkter Macht ist, dann verstehen Sie vielleicht auch, dass sie auf dieser Zurückhaltung von tönendem Pathos ruht."
"Wir wünschen uns nur, was alle sich wünschen" – singen die Frauen und Männer im Song des syrischen Künstlers Basel Zaraa. Auch eine karge Botschaft. Oder sollte man sie besser "einfach" nennen? Nicht verhandelbar? Universell? Hört man sie in der Performance "As far as my fingertips take me", berührt sie einen fast so wie die Finderspitzen des Künstlers auf dem Unterarm. Vielleicht ist das Pathos, vielleicht nicht. Aber vermutlich braucht der Kampf für die Grundwerte der Demokratie und das Beharren auf ihnen viele Tonlagen. Für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit können und müssen viele sprechen, singen, manchmal auch schreien. Und auf die Antworten des Gegenübers horchen. Das Projekt "55 Voices for Democracy" bietet einige Stimmen im Gesang für die Demokratie. Hoffentlich tritt es in seiner Pluralität in Resonanz mit der ganzen Welt. So viel Thomas-Mannsches Pathos soll am Ende dieser Sendung dan n doch erlaubt sein! (Stephanie Metzger)