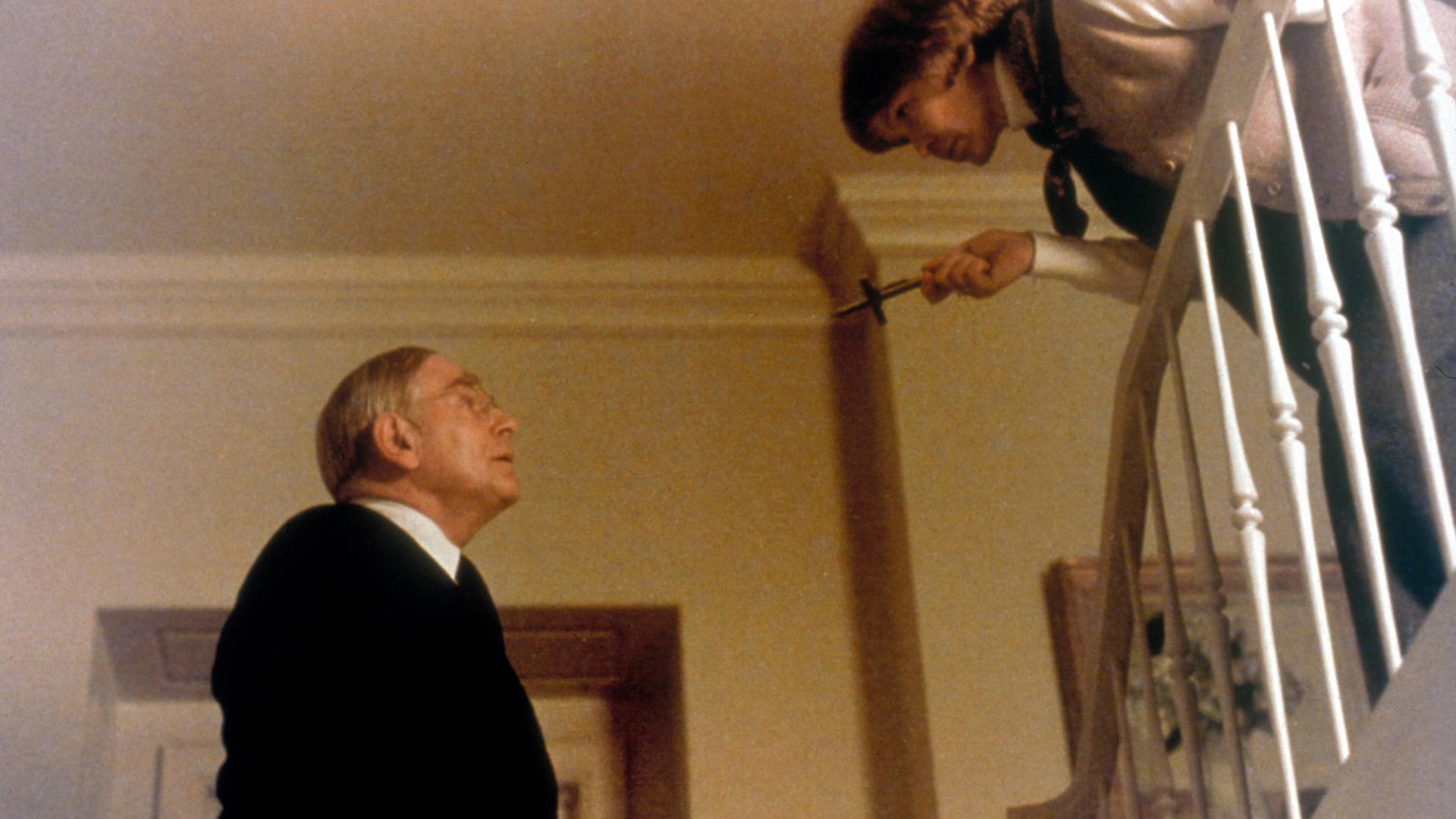„Es war ein außerordentlich junges, hochengagiertes, und politisch engagiertes Forschungsteam, mit dem wir es da zu tun haben. Das eine war ein sozialmoralisches Engagement, das waren weitgehend Leute aus der sozialdemokratischen Jugend, die die Vorstellung hatten: Nun müssen wir in einer kollektiven Erfahrungssituation der Arbeitslosigkeit irgendetwas tun. Wir müssen das nicht nur beobachten. Für die gute Sache, für die Sozialutopie müssen wir uns engagieren.“
Sagt Tilman Allert, Soziologe an der Frankfurter Goethe-Uni. Er schildert hier die Motivation des Forschungsteams, das 1931 nach Marienthal in Niederösterreich an den Ort des sozialen Elends aufbrach.
Eine Textilfabrik bringt zunächst Arbeitsplätze...
Thomas Schwab, Bürgermeister von Gramatneusiedl, einer Marktgemeinde mit 3.700 Einwohnerinnen und Einwohnern, etwa 15 Kilometer von der Stadtgrenze Wiens entfernt: „Marienthal ist nie eine eigene Ortschaft gewesen, nie eine eigene Gemeinde, sondern war immer nur der Name dieser berühmten Textilfabrik und der dazu gehörenden Arbeiterkolonie. Marienthal ist im Wesentlichen am südlichen Ortsende von Gramatneusiedl positioniert worden.“
Im Ortsteil Marienthal war seit 1830 eine Textilfabrik entstanden, die eine Spinnerei, Weberei, Druckerei und eine Bleiche umfasste und während des Ersten Weltkriegs vor allem mit der Produktion von Uniformen, aber auch mit Heereslieferungen prosperierte. Doch Anfang der 1930er Jahre wurde auch Marienthal mit seinen 1.200 Arbeiterinnen und Arbeitern von der Weltwirtschaftskrise heimgesucht.

...und bei der Schließung dann Massenarbeitslosigkeit
Bürgermeister Thomas Schwab: „Bereits ab Juli 1929 wurde mit der Schließung des textilen Werkes begonnen. Und die Schließung des Werkes war im Januar 1930 abgeschlossen. Kann man sich vorstellen -die Mobilität war damals noch nicht so gegeben. Im Ort eine Katastrophe, für die Menschen eine Katastrophe. Und man hatte keine Alternative.“
1931 waren in der Gemeinde dreiviertel von nahezu fünfhundert ortsansässigen Familien arbeitslos. Auf einen Hinweis des SPÖ-Vorsitzenden Otto Bauer und unter der Leitung des Wiener Sozialpsychologen Paul Felix Lazarsfeld machte sich das Team von fünfzehn jungen, hochmotivierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach Marienthal auf. Es wollte drei Monate lang das Elend vor Ort en detail erkunden.
Beobachtung und Engagement in einer „müden Gemeinde“
Um die „müde Gemeinde“, wie sie in der Studie charakterisiert wird, zu motivieren, entwickelte das umtriebige Team etliche Aktivitäten. Es organisierte ärztliche Sprechstunden, eine Erziehungsberatung, eine private Kleideraktion, Schnittzeichen- oder Mädchenturnkurse und ließ Kinder Aufsätze über ihre Lieblingswünsche schreiben. Die Forscher und Forscherinnen versuchten sich in den Alltag der Gemeinde einzubinden.
Denn sie wollten nicht nur offen als Reporter oder Beobachterin auftreten. Tilman Allert: „Die haben eben einfach nicht nur Statistiken erstellt, sondern die haben Handlungsbeobachtungen gemacht. Also die Studie zeichnet sich aus durch eine moderne, könnte man sagen, Methodenvielfalt.“
Per teilnehmender und verdeckter Beobachtung wurden nicht nur statistische Daten über Haushaltsbudgets oder einzelne Mahlzeiten erfasst, sondern auch Zeitverwendungsbögen verteilt, Gaststättenprotokolle erstellt oder Gehgeschwindigkeiten gestoppt.

Einflussnahme und "Feldeffekt" war erwünscht
Der empirische Sozialwissenschaftler Konrad Schacht war einst Adorno-Schüler, später Kanzleramtsmitarbeiter in Bonn und Leiter der Landeszentrale für Politische Bildung in Hessen. Er sieht in diesem sogenannten „Methoden-Mix“ das Neue und Fortschrittliche der Studie. Vor Marienthal hätten die häufig allzu naturwissenschaftlich fixierten Sozialwissenschaften eher zu quantitativen Forschungen geneigt - unter Vermeidung von Feldforschungseffekten und ohne Einflussnahme auf das soziale Geschehen.
„Die Marienthal-Forscher haben das Gegenteil intendiert. Bei ihnen war ein großer Feldeffekt erwünscht. Das heißt, sie wollten sich immer beteiligen. Und es war auch eine Voraussetzung für die Teilnahme der Untersuchung, dass man sich in dem Dorf engagiert, dass man sich um die Familien kümmerte. Es gab also eine richtige Aktionsforschung, um über diese intensivierten Beziehungen zu den Menschen mehr Informationen über sie zu bekommen.“
Im Zentrum der Forschung: Das arbeitslose Dorf
Wichtig dabei – als Untersuchungsgegenstand wurde das arbeitslose Dorf und nicht der einzelne Arbeitslose in den Vordergrund gerückt. Konrad Schacht: „Die Marienthal-Studie war auch intendiert als Gemeindestudie. Die sagen zum Beispiel auch, wie der Wegfall der Fabrik das Aktivitätsniveau der gesamten Gemeinde abgesenkt hat, weniger Ausleihen in der Bibliothek und auch weniger politische Beteiligungen in den diversen Organisationen. Die Arbeitslosigkeit führt nicht zu einer politischen Radikalisierung und Mobilisierung in Marienthal, sondern zu Apathie und einer großen Resignation.“
Dazu hält die Studie vier Typen des Verhaltens nach Eintritt der Arbeitslosigkeit fest, die auf den physischen wie psychischen Zustand der Betroffenen zielen. Nur ein kleiner Teil der Beobachteten galt noch als „ungebrochen“, die meisten hatten „resigniert“. 11 Prozent wurden als „verzweifelt“ wahrgenommen, und 25 Prozent sogar als „apathisch“ registriert.
Die Grundaussage, dass im Falle von Arbeitslosigkeit eher mit Apathie als Radikalität zu rechnen sei, scheint ihre Gültigkeit bis heute nicht eingebüßt zu haben. Noch im Jahr seines Todes 2009 bezog sich der Soziologe Ralf Dahrendorf ausdrücklich auf die Marienthal-Studie, um das Ausbleiben sozialer Unruhen in Zeiten der damaligen Bankenkrise zu erklären.
„Wenn es wirklich schlimm kommt, werden die Leute apathisch. Was Arbeitslose nicht tun, ist, revolutionär tätig werden, sich organisieren. Das tun sie gerade nicht, sondern sie verfallen in eine anhaltende Apathie und tun gar nichts mehr. Da weiß man, dass es gar keinen Sinn macht, so zu wählen oder so zu wählen und zu meinen, dass das die Lage verbessert.“

Marie Jahodas lebensnahes Forschen
Hauptautorin der Studie damals war Marie Jahoda. Für sie stand die Apathie für mehr als ein Weggetreten- oder aus der Bahn-Geworfensein. Das betont Ilse Lenz, die lange zu sozialer Ungleichheit an der Ruhr-Universität Bochum lehrte:
"Marie Jahoda sah die Menschen als die, die ihre eigene Geschichte und ihr Leben schaffen. Das heißt: sie werden apathisch, indem sie sich mit dieser ungeheuren Erfahrung auseinandersetzen. Und in diesem Sinn hat sie sie nicht als Opfer gesehen, sondern als die, die Bedeutung schaffen, um mit diesen Bedeutungen ihr Leben in dieser Krise der Arbeitslosigkeit zu bewältigen."
Marie Jahoda war damals Mitte zwanzig und im „Roten Wien“ stark sozialdemokratisch engagiert. Dank ihr war das Marienthal-Projekt noch auf eine andere Weise besonders: Durch die herausragende Stellung der Forscherinnen im Team, auf die auch der Historiker Reinhard Müller aus Graz hinweist, der seit Jahren mit der Erinnerung an Marienthal beschäftigt ist:
„Da stehen immerhin neun Forscherinnen sechs Forschern gegenüber. Und die Frauen hatten auch wichtige Positionen inne, vor allem Gertrude Wagner, die wesentlich an der statistischen Auswertung beteiligt war, Lotte Schenk-Danzinger, die die Hauptarbeit der Feldforschung betrieben hat, und Marie Jahoda, die auch den Text der Marienthal-Studie allein verfasst hat.“
Männer und Frauen reagieren unterschiedlich auf Arbeitslosigkeit
Dreißig Kilogramm Untersuchungsmaterial türmten sich vor Marie Jahoda auf, als sie sich die Zusammenfassung vornahm: Familienprotokolle, Budgetanalysen, Aufzeichnungen aus Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten, Lehrerinnen und Lehrern und vieles mehr. Herausragend dabei der narrative Stil, mit dem Jahoda als lebensnah forschende Sozialpsychologin die umfangreichen Daten aufbereitete. Ilse Lenz:
„Wie die Menschen in den Parks sitzen oder wie sie keine Zeit mehr strukturieren können. Also der Zerfall der Zeit, das bedeutet: Menschen sind gewohnt zur Arbeit zu gehen, und sie bleiben im Bett liegen, weil sie die Zeit nicht mehr selber in die Hand nehmen können. Das sind, denke ich, Beispiele für lebensnahes Forschen."
Die starke Teampräsenz von Frauen hat in der Studie deutliche Spuren hinterlassen. Nicht nur, was die paritätische Berücksichtigung von arbeitslosen Frauen und Männern in den Erhebungen betrifft. Auch die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Wirkung von Arbeitslosigkeit wurde detailliert herausgearbeitet, zum Beispiel mit der Beobachtung und Messung des jeweiligen Gehverhaltens.
Der Historiker Reinhard Müller bilanziert: „Männer gehen langsamer und unterbrechen ihre Gehweise durch Zwischenaufenthalte. Frauen gehen schneller, ohne stehen zu bleiben. Und die Erklärung, die in der Marienthal-Studie geboten wird: Frauen sind zwar arbeitslos, aber nicht beschäftigungslos.“
Tilman Allert: „Das hat mit der asymmetrischen Verteilung um die Sorge um die Angehörigen zu tun. Die Frauen in dieser Situation einer dramatischen Krise des Lebens haben minimal nun mal die Sorge um die Liebsten. In dieser Sorge sind sie in einer Weise aktivistisch, wie es den Männern nicht möglich war.“
Marie-Jahoda-Gastprofessur in Bochum
Doch das Besondere der Studie war zunächst auch ihr Schicksal. Sie verschwand kurz nach ihrem Erscheinen im März 1933 aus dem Blickfeld. Erst Anfang der 1960er Jahre wurde Marienthal wieder entdeckt und erfuhr hernach durch Neuauflagen in der Bundesrepublik eine sozialwissenschaftliche Renaissance.
Bis dahin hatte Marie Jahoda nach ihrer Emigration in die USA und der anschließenden Niederlassung in England eine imponierende wissenschaftliche Karriere hingelegt als Professorin in einer männlich dominierten akademischen Welt. Die Ruhruniversität Bochum würdigte das. 1994 wurde auf Initiative der Frauenforscherin Ilse Lenz eine Gastprofessur für internationale Geschlechterforschung zu Ehren von Marie Jahoda eingerichtet.
"Sie war ja mit ihrer weitertreibenden Theoriearbeit, ihrem Zukunftsdenken, das sie beispielsweise mit einer unheimlich interessanten qualitativen Forschung kombinierte, eine Pionierin für Theorie und Methoden, die auch für die Geschlechterforschung bis heute sehr, sehr relevant sind. Und sie hat sich ja nun sehr angenommen der Frage, wie wichtig Arbeit für Menschen ist und wie sich das auf ihre Psyche auswirkt. Und sie hat Menschen durchaus auch im Sinne von Geschlecht gedacht."
Dies unterstreicht auch Brigitte Hasenjürgen, frühere Mitarbeiterin am Marie-Jahoda-Center Bochum und danach Professorin an der Katholischen Hochschule Köln. Zusammen mit Steffani Engler hat sie Jahodas 1997 erschienene Autobiografie angeregt und darin ein ausführliches biografisches Gespräch veröffentlicht: „Die Genderforschung fand ihren Gefallen, weil Geschlechterverhältnisse die Menschen prägen, und Geschlechterungleichheiten zu Ungerechtigkeiten führen. Deshalb war das auch ihr Ding. Aber ich würde sie deswegen nicht als Wegbereiterin der Genderforschung hochstilisieren.“

Lebensnahes soziologisches Forschen heute
Dass es auch heute noch Arbeitslosenstudien vor Ort gibt, die zu ähnlichen Resultaten gelangen, verdeutlichen die Untersuchungen des Soziologen Steffen Mau über die Transformations-Gesellschaft am Beispiel einer kleinen Siedlung in der ehemaligen DDR. Dazu Tilman Allert: „Und da haben wir von den Befunden her ein ganz ähnliches Phänomen, nämlich die Bereitschaft, die Blockade, in der man gelebt hat, einerseits dem System zuzurechnen, andererseits aber mitnichten irgendwie groß politisch aktiv zu werden. Also insofern kann man sagen, solche Befunde finden wir heute auch.“
So liegt die Bedeutung der Marienthal-Studie noch heute darin, dass sie es geschafft hat, mit ihrem Methoden-Mix den Binnenraum der Disziplin zu überschreiten und damit - sogar noch mit erheblicher zeitlicher Verzögerung - weltweit Aufmerksamkeit zu erfahren.
Was aber ist aus Marienthal selbst geworden, also Gramatneusiedl, der Marktgemeinde in Niederösterreich? Sie fristet ihr Dasein heute primär als Schlaf-PendlerInnengemeinde im Speckgürtel Wiens. Im Zentrum befinden sich als abstoßendes Wahrzeichen imposante 700 Kfz-Stellplätze. Den Initiativen des Grazer Historikers Reinhard Müller ist es zu danken, dass im Ort mittlerweile sieben Häuser der einstigen Arbeiterkolonie Marienthal wieder errichtet und teilweise neu bewohnt wurden.
Und eine Museumsstätte erinnert an das einstige, sozialwissenschaftlich berühmte gewordene Arbeitslosenschicksal der Gemeinde. Durchaus mit Publikumszuspruch, wie der Museumsobmann Tibor Schwab unterstreicht: „Wir haben in den letzten zehn Jahren, wo es das Museum gibt, rund zwischen 25 und 30 Tausend Besucher gehabt, wobei sehr viele Führungen hier sind. Und es kommt immer wieder vor, dass Leute hier nach Führungen anschlagen.“