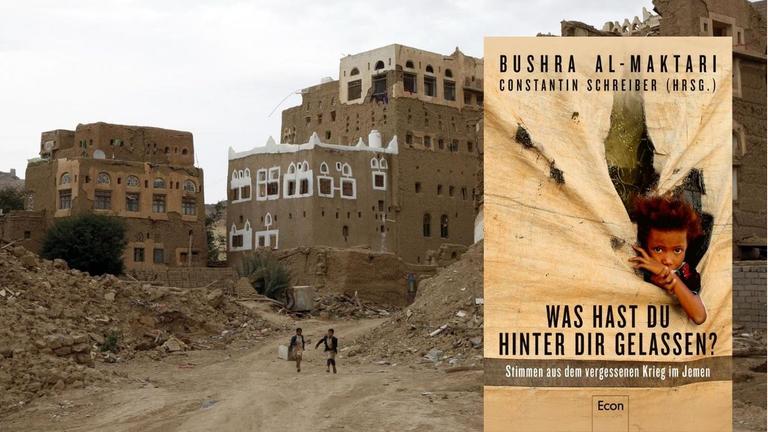Der Krieg im Jemen fordert seit Jahren Menschenleben – COVID-19 tut das zusätzlich. Nur durch die Hilfe des Welternährungsprogramms, das mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, können viele Menschen dort überleben.
Fünf Wochen hat Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen im Jemen Nothilfe geleistet. Die Organisation unterhält ein Krankenhaus in der im Süden gelegenen Stadt Aden.
„COVID-19 ist wirklich ungebremst in den Jemen eingefallen. Es gab keinerlei Schutzmaßnahmen, es gab nicht mal Aufklärung“, sagte der Notarzt im Dlf. Menschen, die Symptome zeigten, seien erst gar nicht in Krankenhäuser aufgenommen worden. „Viele Menschen sind zu Hause einsam erstickt“.
Unter den Bürgerkriegsbedingungen seien schon einfach hygienische Maßnahmen kaum durchzuführen – beispielsweise wegen akutem Wassermangel. „Solange der Bürgerkrieg weiter geht, gibt es wenig Hoffnung, dass sich die gesundheitliche Situation der Menschen im Jemen verbessern kann“.

Das Interview in voller Länge:
Jürgen Zurheide:Wenn ich Sie jetzt als Erstes frage, die Lage im Jemen, welche Bilder kommen Ihnen als Erstes jetzt in den Blick – ich glaube, Sie waren noch mal fünf Wochen da –, was ist so der Eindruck, der heute Morgen als Erstes kommt?
Tankred Stöbe: Ja, es sind tatsächlich diese zwei Elemente, die Sie gerade schon angesprochen haben. Es ist der Bürgerkrieg – ich war jetzt in Aden, in der südlichen Stadt, da betreiben wir seit Jahren ein Traumazentrum, wo wir die Kriegsverletzten behandeln können, und das ist sozusagen unser Alltag dort, da sehen wir Dutzende Verletzte jeden Tag. Und dann ist es tatsächlich COVID-19, und zwar sind die Zahlen jetzt ein bisschen runter, aber die Angst vor dem Virus und das, was dort gerade erlebt wurde, diese dramatischen Todeszahlen, die aber nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind, das ist das zweite Element.
Keinerlei Schutznahmen und keine Aufklärung
Zurheide: Was heißt das denn, eine Krankheit wie COVID-19 in einem solchen Land? Ich meine, wir haben ja hier in der Sendung mehr als einmal gesprochen, wir reden über Testen und alle möglichen Dinge, wie wir uns schützen können. Gibt es da so was wie Schutz?
Stöbe: Ja, das gibt es eben alles gar nicht. Wir hatten ja hier in Deutschland Wochen und Monate des Vorlaufs, wo wir das alles vorbereiten konnten, und COVID-19 ist wirklich ungebremst in den Jemen eingefallen, vor allem im Süden, da begann es auch. Es gab keinerlei Schutzmaßnahmen, es gab nicht mal Aufklärung. Die Menschen haben nicht erfahren, um was es sich da eigentlich handelt, deshalb die Angst, die Stigmatisierung vor dem Virus, die war von vornherein sehr groß.
Und dann war es so, die Menschen sind krank geworden, und wenn sie da aber ins Krankenhaus mussten, haben sie erfahren, nein, wir nehmen keine Kranken auf, die diese Symptome zeigen. Krankenhäuser wurden geschlossen, und dann war es tatsächlich das Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen, das wir Anfang Mai aufgemacht haben. Das war aber auch eine ganz schwierige Situation, weil im Grunde genommen mit dem Eröffnen dieses Krankenhauses sind Dutzende schwerstkranke Menschen dort eingetroffen, und viele von denen konnten wir nicht mehr retten – wir hatten nicht mal Sauerstoff genügend am Anfang, also eine ganz, ganz schwierige Situation.
Zurheide: Dann muss ja auch das eigene Personal, das Krankenhauspersonal muss selbst geschützt werden – wir wissen, das ist schon hierzulande ein Problem gewesen –, wie schafft man das unter solchen Bedingungen?
Stöbe: Es gab nicht genügend Schutzausrüstung, die Kittel, die Handschuhe, die Masken mussten wiederholt benutzt werden. Es war auch so, dass die Sauerstoffherbeiführung – also es gibt hier keine zentrale Sauerstoffversorgung, wir mussten das in Zylindern heranschaffen, in einer Stadt mit Bürgerkrieg dann Dutzende Sauerstoffzylinder jeden Tag in die Klinik zu bringen und sie dann mit diesen Sauerstoffbeatmungsmaschinen zu verbinden. Es gab eigentlich Probleme an allen Fronten. Die Mitarbeitenden sind selber auch krank geworden oder sie kamen aus Angst dann nicht mehr zur Arbeit. Wir mussten Mitarbeitende aus unserem Traumazentrum abstellen, dass sie dann in dieser Corona-Klinik gearbeitet haben.
Hohe Todeszahlen, eine große Angst weiterhin, eine ärztliche Kollegin, die mich jede Woche fragte, ob sie denn Corona hätte, obwohl sie es bereits durchgemacht hatte, also selbst unter Fachleuten auch ein großes Informationsdefizit weiter, also ein failed state, was natürlich nicht damit umgehen kann, wenn jetzt noch eine Epidemie über das Land zieht, wenn sie nicht mal mit der normalen Gesundheitsversorgung zurechtkommen können.
Angst vor der zweiten Welle
Zurheide: Sie haben gerade die Angst angesprochen, auch der Menschen, das heißt, auf der einen Seite über wahrscheinlich soziale Medien oder sonst was wissen die Menschen, dass da irgendetwas ist, aber gibt es denn irgendeine Form von, ich will das Wort Vorsorge jetzt gar nicht in den Mund nehmen, oder was könnte, was müsste man tun?
Stöbe: Tatsächlich müsste eine seriöse Aufklärung weiter passieren. Das Leben in der Stadt oder in ganz Jemen läuft unter diesen Kriegsbedingungen so weiter, für die Menschen natürlich die Bomben, die Schießereien sind natürlich sichtbarer, sind auch beängstigender, sind realer als jetzt ein unsichtbares Virus. Es müsste was ganz Banales geben wie Wasser, dass die Menschen sich die Hände waschen können, das Land leidet seit vielen Jahren unter einer massiven Wasserarmut.
Kleines Beispiel: Weil jetzt auch die Benzinpreise weiter ansteigen, können Autos nicht mehr fahren, das heißt, mit Eseln werden Wasserkanister durch die Stadt getragen, um dann die Wasserversorgung rudimentär zu gewährleisten, also es fehlt wirklich an allen Enden.
Schutzmechanismen sind nicht vorhanden, aber eben auch Behandlungsoptionen sind nicht da. Meine große Sorge ist, im Moment sind die Infektionszahlen für COVID-19 einigermaßen runter, aber sollte es zu einer zweiten Welle kommen im Jemen, dann ist das Land wahrscheinlich ähnlich schlecht vorbereitet wie beim ersten Mal.
COVID-19: die große unbekannte Katastrophe im Jemen
Zurheide: Jetzt haben Sie die Zahlen ein paar Mal angesprochen, wie sehr kann man denn diesen Zahlen, die da überhaupt bekannt sind, glauben, oder haben Sie da eine Einschätzung, wie realistisch ist das, was die Regierung im Zweifel sagt? Wobei, welche Regierung, muss man schon wieder fragen.
Stöbe: Genau. Die offiziellen Zahlen sind bei knapp über 2.000 Infizierten jetzt im ganzen Jemen und etwa 590 Tote. Interessant ist, der ganze Norden wird gar nicht mitgerechnet, weil dort darf offiziell das Virus nicht existieren. Die Parallelität zeigt sich auch daran, dass in den Kliniken, wo Ärzte ohne Grenzen COVID-19-Patienten behandelt, unsere Infektions- und Todeszahlen etwa gleich groß sind wie die offiziellen, aber sind in ganz anderen Landesteilen gemessen. Das zeigt schon, wie unverhältnismäßig die sind.
Die allermeisten Menschen wurden ja nie getestet, die allermeisten Menschen sind nie in ein Krankenhaus gekommen, sie sind – und so dramatisch muss man das sagen –, sie sind zu Hause einsam erstickt. Es gab praktisch keinen Mitarbeitenden von uns, mit dem ich gesprochen habe, der nicht entweder selbst oder nahe Familienangehörige an COVID erkrankt sind. Es ist vielleicht die große unbekannte Katastrophe im Jemen, aber eben, solange der Bürgerkrieg weitergeht, gibt es wenig Hoffnung, dass sich die gesundheitliche Situation der Menschen im Jemen verbessern kann.
„Hälfte aller Krankenhäuser ist zerstört“
Zurheide: Die Welternährungsorganisation, die ja den Friedensnobelpreis gewonnen hat, ist ja die Organisation, die in diesem Land überhaupt so etwas wie Versorgung von vielen, vielen Menschen aufrechterhält. Was haben Sie da erlebt?
Stöbe: Die Ernährungssituation ist ein weiteres großes Problem. Vor drei Jahren war ich bereits im Jemen, etwas weiter nördlich als dieses Mal, da hatten wir tatsächlich – damals war die Choleraepidemie ganz weit im Vordergrund, und natürlich hat die die Ernährungssituation noch mal verschlimmert. Im Süden, in Aden, war jetzt die Ernährungssituation einigermaßen stabil, aber eine Stadt ist dann vielleicht auch noch mal leichter, also der Süden hat es da vielleicht einen Tick leichter mit der Ernährung. Aber es ist eines der vielen Probleme. Die Wasserversorgung, die Ernährungssituation ist schwierig, aber eben auch über die Hälfte aller Krankenhäuser sind durch Luftbeschuss oder andere Kriegshandlungen zerstört, das heißt, die Menschen, die krank werden, haben im Jemen kaum eine Chance, eine Behandlung zu finden. Lehrer und Ärzte werden seit Jahren nicht mehr bezahlt und kommen deshalb auch nicht mehr zur Arbeit.
Selbst ein Krankenhaus, das noch physisch vorhanden ist, funktioniert kaum. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln, mit medizinischen Materialien wird immer wieder unterbrochen, weil die Zufuhr oder die Hilfsmittel, die in den Jemen kommen, nicht stattfinden können. Die Herausforderungen sind schon immens.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.