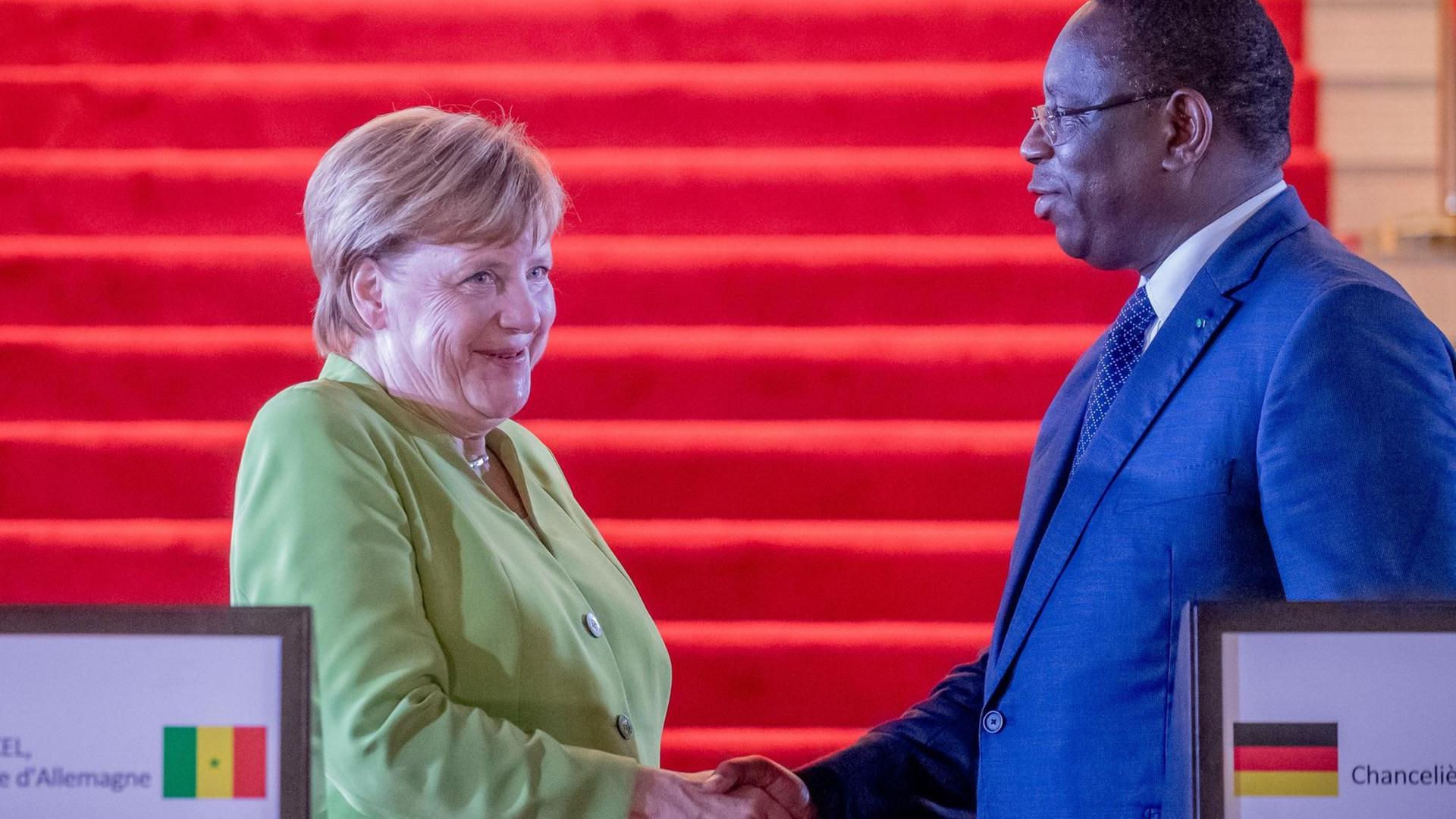Regenzeit in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Und trotzdem scheinen alle vier Millionen Einwohner unterwegs zu sein. Regenschirme überall, Autos rasen durch tiefe Pfützen, unter Plastikplanen stapelweise Avocados, Ladekabel, Särge. Ein Bild, wie ich es ähnlich auch in anderen Ländern Afrikas gesehen habe. Was auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist: Addis Abeba ist das Herz einer Revolution in Sachen Gesundheit, für Äthiopien und vielleicht für ganz Afrika. Temesgen Ayehu, Leiter des Health Extension Projekt:
"Es wird viel mehr geimpft, die HIV Rate ist deutlich gesunken. Es gibt viel weniger schwere Malariafälle. Äthiopien konnte die Kindersterblichkeit mehr als halbieren. Und das viel schneller als geplant."
Ich bin hier, um mehr zu erfahren. Wie schafft dieses bitterarme Land den großen Sprung nach vorn? Wie findet Äthiopien Anschluss an einen modernen medizinischen Standard?
Anwar Muru, Mitarbeiter des Health Extension Projekts:
"Wir haben über tausend Patienten mit multiresistenter Tuberkulose behandelt. Die Heilungsrate liegt bei 80 Prozent. Das ist ein Riesenerfolg für Äthiopien."
In Addis Abeba sitzen auch die Afrikanische Union und deren Gesundheitsbehörde, die Africa CDC.
Benjamin Djoudalbaye, Epidemiologe, Head of Policy and Health Diplomacy:
"Unsere Vision: die Gesundheit der Afrikaner zu schützen."
Gesundheit für alle - Strategien aus Afrika für Afrika
Der Regen lässt nach, schnell sind die Straßen wieder staubig. Ich bin unterwegs zum Gesundheitsministerium. Der Weg führt vorbei an ein paar Hochhäusern, an vielen Baustellen, vor allem aber an endlosen Wellblechsiedlungen. Überall putzen Jugendliche Schuhe. Unwillkürlich wandert mein Blick nach unten. Genügt das eigene Schuhwerk den hiesigen Ansprüchen?
Endlich erreiche ich ein nüchternes Verwaltungsgebäude. Vor dem Eingang Gedränge, die Taschen werden kontrolliert. Im dritten Stock in einem Glasverschlag treffe ich Temesgen Ayehu, Leiter des Health Extension Programs, des Programms zur Ausweitung der Gesundheitsvorsorge.
Vor 15 Jahren untersuchte die Regierung systematisch die medizinische Versorgung in Äthiopien, erzählt er. Es stellte sich heraus, dass es in der Fläche viel zu wenig Ärzte und Pfleger gab.
"Also startete das Gesundheitsministerium das Health Extension Program, um die medizinische Versorgung genau da bereitzustellen, wo die Menschen leben."
Viele denken beim Stichwort Äthiopien noch an die Bilder der Hungerkatastrophen der Achtzigerjahre, ausgelöst durch eine Kombination von Dürren, Misswirtschaft und Bürgerkrieg. Hunderttausende starben. Seit der Jahrtausendwende gilt die Gesundheit der Bevölkerung aber als Priorität der Regierung, auch um die wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. Eine Mammutaufgabe. Äthiopien ist etwa drei Mal so groß wie Deutschland und zählt über 100 Millionen Einwohner, die meisten leben weit verteilt in kleinen Dörfern.
"Alles wird auf der Ebene der Gemeinden, der Kebele organisiert. Die Health Extension Workers kommen aus den Gemeinden, sie werden ein Jahr lang geschult und kehren dann in ihre Gemeinde zurück. Sie kennen die Gesundheitsprobleme, sie werden vor Ort akzeptiert und können deshalb effektiv arbeiten."
Zwei Frauen betreiben den Gesundheitsposten
In jeder der 17.000 Gemeinden gibt es inzwischen einen Gesundheitsposten. Die sind für Vieles zuständig, was in anderen Ländern Medizinern vorbehalten ist, Impfungen beispielsweise. Überhaupt ist die wichtigste Aufgabe die Prävention, denn vorbeugen ist günstiger als heilen.
"Wir fahren in die Region Oromia, genauer in eine kleine Stadt in Siliulta. Dort treffen wir die Gesundheitshelferinnen und können sehen, wie sie arbeiten."
Anwar Muru lenkt den Jeep Richtung Norden, über die Berge, in denen die erfolgreichen Äthiopischen Langstreckenläufer trainieren. Auf den Ebenen dahinter grasen zwischen grünen Zwiebelfeldern Schafe, Ziegen, Rinder. In dieser Region wird die Milch für Addis erzeugt. Wir biegen ab in eine Nebenstraße, dann in einen schmalen Weg. Nach einigen Kilometern erreichen wir Eekkoo. Eine Ansammlung von Gehöften, umgeben von Wellblechzäunen. Auch das kleine Haus des Gesundheitspostens ist von der Straße aus kaum zu sehen.
Ein Gast aus Deutschland wird selbstverständlich vom Bürgermeister und dem Gesundheitsverwalter der Region begrüßt. Dabei geht es hier eigentlich um Kebene Edosa und Filehiwot Ebesa. Die beiden jungen Frauen betreiben den Gesundheitsposten. Gerade untersuchen sie Birke, 34 Jahre, Mutter von zwei Kindern und im fünften Monat schwanger.
Filehiwot stellt Fragen auf Amahrisch, der wichtigsten Sprache Äthiopiens. Sie misst den Blutdruck und zählt Pillen, während Kebene alles sorgfältig in der Akte notiert.
"Ich komme zur Schwangerschaftsvorsorge. Ich habe Eisentabletten bekommen und eine Überweisung in die Klink, weil mein Blutdruck niedrig ist."
Gespräche über Verhütung, Ernährung, HIV, Latrinenbau
Filehiwot und Kebene sind selbst Mütter, leben ganz in der Nähe, sie wissen genau, was die Frauen aus Eekko und den Nachbargemeinden Baaboo und Eeffoo umtreibt. In Gesprächskreisen informieren sie über Verhütung, über Ernährung, HIV, den Bau von Latrinen. Die Gesundheitshelferinnen registrieren, wenn jemand plötzlich zu husten beginnt, und sorgen für eine vernünftige Diagnose in der Klinik. Später achten sie auf die konsequente Einnahme der Medikamente. Kaum ist Birke aus der Tür, kommt Tadalu herein. Sie erhält die Dreimonatsspritze.
"Ich bin Bäuerin und habe vier Kinder, das reicht. Mein jüngster wird heute auch geimpft. Wenn die Kinder krank sind, gibt es hier Hilfe."
Die Ausstattung des Gesundheitspostens ist spartanisch: ein Schreibtisch mit einer Kühlbox für die Impfstoffe, ein Regal mit Akten über jeden einzelnen Haushalt in den drei umliegenden Dörfern. Die Wände sind mit Statistiken gespickt. Der Posten ist zuständig für 1.738 Menschen, davon gut 200 Kinder im ersten Lebensjahr. Eine Grafik zeigt die Impfraten, eine andere die Wachstumskurven. Hier wird viel Wert auf Dokumentation gelegt, vielleicht noch ein Überbleibsel aus sozialistischen Tagen. Aber sehr nützlich für die Erfolgskontrolle. Filehiwot arbeitet schon einige Jahre hier.
"Ich komme von hier und habe mich bei der Kebele beworben. Den Test habe ich bestanden und dann die Ausbildung im Health Extension Program gemacht. Ich habe die höchste Stufe erreicht, Level IV. Aber ich möchte noch weiter kommen. Für mich ist es wichtig, der Gemeinschaft zu helfen und für die Gesundheit der Familien zu sorgen. Jeden Tag kommen 20 bis 30 Frauen. Kinder unter fünf behandeln wir meist selbst. Die anderen schicken wir in die Klinik. Wir überwachen aber zum Beispiel die Tuberkulosebehandlung im Dorf. Fast alle haben eine Krankenversicherung."
40 Prozent der Äthiopier haben eine Krankenversicherung
Das ist eine neue Entwicklung. Im Regal des Gesundheitspostens liegt ein ganzer Stapel der grünen Versicherungshefte. Die Familien müssen rund einen Euro im Monat bezahlen, für hiesige Verhältnisse nicht wenig. In Eekkoo haben die meisten Haushalte eine Versicherung, im ganzen Land sind es etwa 40 Prozent. Äthiopien ist auf dem Weg, ein wichtiges Ziel der Weltgesundheitsorganisation umzusetzen: den universellen Zugang zu Gesundheitsleistungen. Gesundheit ist aber nicht nur eine Frage der Medizin.
"Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, zu erklären, dass Fäkalien Ursache von Krankheiten sind und Latrinen die Gesundheit schützen. 70 Prozent der Haushalte in Eekkoo und den anderen Dörfern haben Latrinen."
Eine direkte Folge des Fortschritts: Die meisten Kinder sind gesund und so ist das Thema Verhütung derzeit die wichtigste Aufgabe der beiden Health Extension Worker. Am Ende des Vormittags macht Filehiwot noch einen Hausbesuch.
Ein Kind macht die Blechtür auf. Es kennt Filehiwot und holt gleich seine Mutter. Die Gesundheitshelferin erkundigt sind nach der Familie, erinnert an anstehende Impfungen und lässt sich dann die Latrine zeigen. Sie steht hinten in der Ecke, ein Verschlag mit Betonboden und einem Loch. Regelmäßig wird abgepumpt. Die Gesundheitshelferin hat nichts auszusetzen, erinnert nur daran, das Wasser zum Händewaschen nachzufüllen.
Jeden Tag sind Kebene und Filehiwot einige Stunden unterwegs. Mich interessiert, ob sie mit ihrem Gehalt zufrieden sind. Es liegt bei etwa 80 Euro.
"Nein das Gehalt ist zu niedrig für die Arbeit, die wir hier leisten, wir haben viel zu tun, das wird nicht ausreichend gewürdigt."
Behandlung nahe bei den Menschen
Auf dem Weg zurück nach Addis Abeba sehen wir zwei ineinandergeschobenen Minibussen. Hier hat es Tote und viele Verletze gegeben. Der Verkehr ist ein großes Gesundheitsproblem in Äthiopien, aber dafür ist das Health Extension Programm nicht zuständig.
Die Impfraten bei den Kindern steigen, dagegen sinkt die Zahl der HIV-Infektionen. Viele Haushalte verfügen über eine eigene Latrine und nutzen imprägnierte Moskitonetze, sodass die Malaria-Fälle zurückgehen. Schwierige Geburten finden zunehmend in Kliniken statt, die Müttersterblichkeit sinkt. Sogar die Lebenserwartung ist gestiegen, von 43 Jahren in den Siebzigern auf aktuell fast 66 Jahre. Für Temesgen ist der größte Erfolg aber die Gesundheit der Kinder.
"Äthiopien konnte die Kindersterblichkeit mehr als halbieren und das drei Jahre vor dem Millenniumsentwicklungsziel. Das Hauptproblem ist Mangelernährung, die begünstigt bei den Kindern Durchfall, Malaria, Lungenentzündungen. Die Mütter haben jetzt ganz in ihrer Nähe Zugang zu Behandlungen. Das ist ein großer Erfolg des Health Extension Programs."
"Äthiopien ist nicht reich, wie finanzieren Sie das alles?"
"Das Health Extension Program hat Priorität für die Regierung. Es existiert ein klarer Plan und alle Ebenen arbeiten zusammen. Alle zwei Monate gibt es Treffen zwischen dem Gesundheitsministerium und den Regionen. Das alles hilft, internationale Partner zu gewinnen und Mittel bei Geberländern zu mobilisieren."
Helfen könnte in Zukunft auch eine liberalere Politik. Anfang 2018 leitete der neu gewählte Präsident Abiy Ahmed Reformen ein und beendete den Dauerkonflikt mit Eritrea. Doch der Streit zwischen verfeindeten Volksgruppen führt immer wieder zu Übergriffen und Zusammenstößen mit der Polizei.
Heilungsraten, die in Afrika als vorbildlich gelten
Morgenbesprechung in der Tuberkuloseabteilung am St. Peters Hospital in Addis Abeba. Bevor ich die etwas abgelegenen Bungalows betreten darf, muss ich eine dicht schließende Maske über Mund und Nase ziehen. Schweißtreibend aber Vorschrift, schließlich liegen hier Patienten mit einer MDR-TB einer Multiresistenten Tuberkulose, gegen die normale Medikamente nicht mehr wirken. Gewöhnliche TB-Fälle werden von den Gesundheitshelferinnen in der Kebele versorgt. Mit Erfolg, Äthiopien konnte die Zahl der TB-Neuinfektionen halbieren, die Sterblichkeit sogar um 70 Prozent reduzieren. Aber immer wieder schlagen die Medikamente nicht an, die Erreger sind resistent geworden.
"Ich begann zu husten, hatte Schmerzen in der Brust. Nachts brach mir der Schweiß aus und ich hatte gar keinen Appetit mehr. Da haben sie mich hierhergebracht, aus Borna in der Oromia Region, 1.000 Kilometer mit dem Krankenwagen."
Vier Monate ist das her, seitdem lebt Missfin Abo weit weg von Frau und Kindern in dem kleinen Zimmer mit Metallbett, Nachttisch, Sauerstoffflasche. Mehr gibt es nicht, mehr braucht es nicht.
"Als er ankam war sein Zustand kritisch, er war kaum bei Bewusstsein. Aber jetzt ist er wieder klar, er hustet kaum noch und fühlt sich wieder gut."
Chefarzt Bekele Fekade untersucht Missfin. Früher gab es keine Medikamente. Patienten mit MDR-Tuberkulose starben einfach. Das neue Programm hat die äthiopische Regierung gemeinsam mit der Hilfsorganisation Global Health Committee etabliert. Mit innovativen Ansätzen erreicht es Heilungsraten, die in Afrika als vorbildlich gelten.
Missfin wird über zwei Jahre konsequent einen ganzen Cocktail von Medikamenten einnehmen müssen. Nebenwirkungen sind der Normalfall, vor allem Gelenkschmerzen, Übelkeit und der Verlust des Hörvermögens. Hier kommt das erste neue Element ins Spiel, denn die Ärzte im St. Peters reagieren sofort auf Nebenwirkungen. Um das Gehör von Missfin zu retten, haben sie die Behandlung umgestellt.
Nebenwirkungen und langfristige Behandlung
Weiter geht es ins nächste Zimmer, auch hier der Blick aufs Röntgenbild, Abhören, die Frage nach den Nebenwirkungen. Fiseh `Chane ist schon länger hier.
Es geht ihm besser, er kann wieder essen und laufen. Er braucht aber Sauerstoff, deshalb ist er hier. Wenn seine Lunge wieder voll arbeitet, kann er die Medikamente im Gesundheitsposten bekommen. Er liest die ganze Zeit, Heldengeschichten aus dem Land.
Oder er spielt Tischtennis mit den anderen Patienten. Fiseh erhält schon das verkürzte Behandlungsschema. Es dauert nur neun statt 24 Monate und setzt auf besser verträgliche Medikamente. Seit diesem Jahr empfiehlt es die Weltgesundheitsorganisation. Die entscheidenden Studien für die verkürzte Behandlung wurden übrigens auch in Äthiopien am St. Peters Hospital durchgeführt.
Wir gehen in ein drittes Krankenzimmer. Hier liegt Bethlehem Shume, sechzehn Jahre alt. Sie ist vor zwei Jahren aus einem kleinen Dorf ans St. Peters Hospital gekommen, lebensgefährlich erkrankt an MDR-Tuberkulose. Ihre Mutter war immer an ihrer Seite.
"Ich muss bei meiner kranken Tochter bleiben. Das große Problem sind die anderen beiden Kinder, eines jünger, eines älter als Bethlehem. Sie leben bei ihrem Vater, er ist Tagelöhner. Aber sie haben uns hier besucht."
Die Infektion ist inzwischen geheilt, aber sie hat Schäden an der Lunge hinterlassen.
"Sie ist auf Sauerstoff angewiesen. Sie kommt aus einem kleinen Dorf, ihre Eltern können sich die Sauerstoffflaschen nicht leisten. Bei manchen Patienten reicht es nicht, die TB zu behandeln, wir müssen uns auch um die sozialen Probleme kümmern."
Soziale Betreuung, Mietunterstützung, Nahrungsmittelhilfe
Die soziale Betreuung ist die zweite Besonderheit des MDR-Tuberkulose Programms am St. Peters Hospital. Ohne sie schaffen es viele Patienten nicht, ihre Tabletten auch nach der Entlassung aus der Klinik über Monate konsequent weiter einzunehmen. Die Probleme fangen bei der Wohnung an. Viele Patienten haben keine feste Bleibe, die ambulanten Schwestern können sie nicht verlässlich erreichen. Deshalb organisiert Selamawit Hagos vom Global Health Committee Hilfe.
"Die Patienten leben oft mit mehreren Familien in einem einzigen Raum. Hier stecken sich leicht andere an. Deshalb geben wir Mietunterstützung, die Patienten können sich in der Nähe der Familie ein Zimmer nehmen, so können ihnen auch die Verwandten helfen. Die Patienten können meist noch nicht arbeiten, deshalb gibt es auch Nahrungsmittelhilfe."
Jeden Monat Öl, Mehl, aber auch Thunfisch und die in Äthiopien allgegenwärtige Mirinda Limonade.
Selamawit will mir Patienten vorstellen, die vom Global Health Committee unterstützt werden. Im Jeep geht es in arme Bezirke von Addis Abeba. Hier wohnt Shewanesh Bekele. Die fünfjährige Blen versteckt sich hinter ihrem Bein. Ihre ältere Schwester wird gerufen.
Lidiya ist schon sechzehn, sie holt ein paar Hocker von den Nachbarn und stellt sie vor die Tür. Das Zimmer der Familie misst höchstens drei Quadratmeter, der Platz reicht nur für eine kleine Matratze und einen Stapel Koffer als Schrankersatz. Mehr kann sich Shewanesh nicht leisten.
"Früher habe ich als Kellnerin gearbeitet, als Wäscherin, Tagesjobs. Dann fing der Husten an. Langsam fühle ich mich besser."
Dann fing auch Blen an zu husten. Sie hatte sich wohl schon vorher in dem engen Zimmer angesteckt. Erst dachten die Ärzte an eine Lungenentzündung, aber die Antibiotika halfen nicht. Also kam auch Blen ans St. Peters.
"Seit einem Monat wird ihre TB jetzt behandelt. Es ist schwer, sie kann die Pillen nicht schlucken. Ich löse sie in Wasser auf, aber das schmeckt sie und muss erbrechen."
"Unsere Heilungsrate liegt bei 80 Prozent"
Eine Krankenschwester des Global Health Committee kommt jeden Tag vorbei. Sie hat Schoanesh geraten, ihre ältere Tochter Lidiya nachts bei Nachbarn schlafen zu lassen, damit sie sie nicht auch noch ansteckt. Die kleine Familie hat nur wenig, aber auch das hätte sie aufgeben müssen, wenn es keine Lebensmittehilfe gäbe und das GHC die Miete nicht übernehmen würde. 800 Birr, 24 Euro, ein stolzer Preis für drei Quadratmeter.
"Ich habe viele Patienten gesehen, Patienten in kritischem Zustand, abhängig von Sauerstoff, wir haben mit ihrem Tod gerechnet. Und viele konnte man kaum wiedererkennen, als sie zur Nachuntersuchung kamen. Unsere Heilungsrate liegt bei 80 Prozent, das ist die Beste in ganz Afrika. Das Programm hat unserem Land sehr geholfen. Viele Menschen überlebten. Lehrer, Ingenieure, Krankenpfleger. Das sind wirklich gute Nachrichten."
Eine Heilungsrate von 80 Prozent ist für die multiresistente Tuberkulose spektakulär. Chefarzt Bekele erinnert sich. Als die Ergebnisse 2015 in der Fachzeitschrift Thorax veröffentlicht wurden, konnten viele Experten gar nicht glauben, dass so etwas in einem armen Land wie Äthiopien möglich ist. Inzwischen kommen Ärzte aus anderen afrikanischen Ländern, um von den Erfahrungen am St. Peters Hospital zu lernen.
Gang durch die Afrikanische Union
Addis Abeba ist Sitz der Afrikanischen Union. Der Zusammenschluss der afrikanischen Staaten hat 2017 die Africa CDC gegründet, benannt analog zu den US-amerikanischen Centers For Disease Control. Ich treffe Herilinda Temba, eine Epidemiologin aus Tansania im Lagezentrum der Behörde. Die meisten Deutschen haben noch nie von den Africa CDC gehört. Das kann Herilinda Temba kaum glauben.
Es ist auffällig ruhig, die rund zwanzig Computerbildschirme sind schwarz, genauso wie die Videokonferenzanlage und die große Monitorwand.
"Africa CDC ist eine junge Organisation mit nur zehn Epidemiologen. Und weil es gerade viele Ausbrüche gibt, sind sie in den Mitgliedstaaten. Zwei sind wegen der Cholera in Kamerun, andere beim Ebola-Ausbruch im Kongo oder wegen des Rift-Valley-Fiebers in Kenia. Außerdem findet noch ein Workshop statt, deshalb ist das Lagezentrum so ruhig."
Auch Herilinda Temba ist gerade erst aus Kenia zurück. Sie fährt ihren Computer hoch, hier laufen Krankheitsmeldungen aus ganz Afrika zusammen. Es braucht Zeit bis die Nachricht von ungewöhnlichen Symptomen von einem Krankenhaus über die Bezirksverwaltung und die Regierung endlich Addis erreicht. Deshalb durchforsten die Epidemiologen des Africa CDC auch das Internet.
Schnelle Risikoanalyse von Ebola-Ausbrüchen
Herilinda Temba öffnet als erstes Medisys, ein medizinisches Informationssystem. Obenauf eine Meldung aus Neuss.
"Yeah, there’s even Germany: Neusser Feuerwehr gibt schnell Entwarnung, weißes Pulver."
Sie klickt sich durch die Meldungen und bleibt an einer Nachricht zu Ebola hängen.
Die Studie wurde am 1. August veröffentlicht. Ebola-Überlebende sind möglicherweise vor einer zweiten Ansteckung geschützt.
Die Seite analysiert auch Tweets und Online-Artikel. So fiel Herilinda Temba der aktuelle Ausbruch des Rift-Valley-Fiebers in Kenia auf, noch bevor die Behörden ihn gemeldet hatten.
"Über das Rift-Valley-Fieber im Kongo kann ich aus erster Hand berichten, weil ich mit meinem Kollegen Wissam vor Ort war. Wir haben eine Risikoanalyse gemacht, um abzuschätzen, ob auch Somalia, Äthiopien, Uganda und Ruanda mit einem Ausbruch rechnen müssen. Danach haben wir nach Schwachstellen in der Reaktion von Kenia gesucht."
"Zwei Dinge sind uns aufgefallen. Erstens die Spezialisten sitzen alle in der Hauptstadt. Wir müssen mehr Leute vor Ort ausbilden, damit sie einen Ausbruch des Rift-Valley-Fiebers schnell entdecken und kontrollieren. Das andere Problem lag im Probenmanagement. In der Region gibt es kaum Laborkapazität, deshalb werden die Proben für die Diagnose verschickt. Das muss effektiv und sicher passieren. Auf lange Sicht wollen wir ein mobiles Labor bereitstellen, damit die Proben in den Gemeinden überprüft werden können."
Netzwerk von medizinisch ausgebildeten Freiwilligen
Hilfe vor Ort, die Behörden unterstützen, bei der Vorbeugung helfen. Das sind die Aufgaben des Africa CDC, der Gesundheitsabteilung der Afrikanischen Union. Benjamin Djoudalbaye gehört dem Führungsstab der jungen Organisation an. Auch er ist viel unterwegs, kommt gerade aus Asien und wird gleich in den Kongo weiterfliegen.
"Was haben wir erreicht? Letztes Jahr waren wir bei neun Ausbrüchen in Mozambique, in Nigeria, in der Demokratischen Republik Kongo, wegen der Lungenpest in Madagaskar zum Beispiel."
Seit Januar 2017 beschäftigt das Hauptquartier in Addis Abeba zehn Epidemiologen. Der Anfang ist gemacht. Inzwischen arbeiten auch die fünf regionalen Zentren in Gabun, Kenia, Ägypten, Sambia und Nigeria. Noch wichtiger aber ist das Netzwerk von vielen hundert medizinisch ausgebildeten Freiwilligen, die bei einem Ausbruch schnell mobilisiert werden können.
"Wir schicken unsere Experten ins Feld und die stärken dort die lokalen Gemeinden. Während des aktuellen Ebola Ausbruchs im Kongo mussten wir keine Leute von außerhalb holen. Es gibt dort schon erfahrene Leute. Das ist der Vorteil des Afrikanischen Freiwilligen-Corps. Viele, viele, viele Freiwillige aus dem Kongo haben schon beim Ebola-Ausbruch in Westafrika mitgearbeitet und jetzt helfen sie den eigenen Gemeinden."
Wieder klingelt das Telefon. Ein Mitarbeiter des Ebola-Teams in Kongo braucht Rat. Dort wurde jetzt erstmals systematisch ein Ebola-Impfstoff eingesetzt, um Kontaktpersonen von Patienten zu schützen.
"Wir lernen von jedem Ausbruch, man kann die Fortschritte sehen. Unsere Vision lautet, die Gesundheit der Afrikaner zu schützen. Nicht nur vor Ausbrüchen, auch vor Zivilisationskrankheiten. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir gehen Schritt für Schritt vor, übereilen nichts. Es kommt darauf an, stabile Institutionen zu schaffen. Die Gesundheit hat bei den Regierungen des Kontinents oberste Priorität."
Health Extension Workers - Vorbild für Afrika
Seit der AIDS-Krise treffen sich die Gesundheitsminister der Afrikanischen Union regelmäßig, auch wenn den Worten nicht überall Taten folgen. Besitzt Afrika überhaupt die nötigen Kapazitäten?
"Sie wollen mir eine Falle stellen. Also gut, ich will offen sein. Wir haben die Kapazitäten, das hat der Ebola-Ausbruch in West Afrika gezeigt. Bei den Finanzen gibt es noch viel zu tun. Wir empfehlen, 15 Prozent in Gesundheit zu investieren. Einige Länder erreichen das schon, andere sind auf dem Weg, aber dafür werben wir."
"Welche Hilfe erwarten Sie vom Westen?"
"Wir haben einen Plan und fünf klare Ziele. Wir arbeiten gerne mit allen zusammen, die uns bei der Umsetzung unterstützen wollen. Aber wir werden uns nicht ablenken lassen von Leuten, die ihre eigenen Prioritäten durchsetzen wollen."
Die Ziele lauten: Krankheiten schnell erkennen, auf Ausbrüche vorbereitet sein und reagieren, Labornetzwerke organisieren, den Datenaustausch erleichtern und das Gesundheitswesen vor Ort stärken. Wegen dieses letzten Ziels studiert die Epidemiologin Herilinda Temba Äthiopien, das Gastland der Africa CDC, sehr genau.
"Tatsächlich sind die Health Extension Worker ein Vorbild für Afrika. Mit ihrer Hilfe können wir schnell reagieren. Sie leben da, wo sich Ausbrüche abspielen. Wenn etwas passiert, können sie es direkt melden, damit dann gehandelt wird. Das ist eines der besten Modelle für ganz Afrika."
Plan eines landesweiten Gesundheitssystems
Vor zwei Monaten erst war eine Delegation aus Burkina Faso zu Besuch, um sich bei Temesgen über das Health Extension Program zu erkundigen. Dabei denkt Äthiopien selbst schon weiter.
"Wir arbeiten gerade an der Vision, an einem Plan für die nächsten zehn, 15 Jahre. Noch ist es ein Entwurf, aber es soll in jeder Kebele ein ganzes Gesundheitsteam geben, zu dem auch Ärzte gehören werden."
Gerade weil das Programm erfolgreich ist, verlieren in Äthiopien die Infektionskrankheiten langsam an Bedeutung. Parallel werden die sogenannten Zivilisationskrankheiten zum Problem. Herz-Kreislauf-Leiden, Diabetes, Krebs. In Addis Abeba existieren spezialisierte Kliniken: Am St. Paul Hospital gibt es ein Transplantationsprogramm, das Black Lion Hospital etabliert gerade ein Tumorzentrum. Das aufs ganze Land auszuweiten, ist nicht finanzierbar. Der neue Plan setzt deshalb wieder auf Vorbeugung und Früherkennung. Und auf die Stärke Äthiopiens, auf sein menschliches Kapital.
"Wir wollen die Gesundheitshelferinnen weiterbilden, manche werden sogar einen Doktorgrad erreichen und das ganze Health Extension Program organisieren."
Das dürfte dann auch ein höheres Gehalt bedeuten. Gute Nachrichten für Kebene und Filehiwot. Kurz vor der Mittagspause drängt eine ganze Gruppe Frauen herein. Eine Großmutter hat ihre Tochter und die beiden erwachsenen Enkel gedrängt, sich über Verhütung beraten zu lassen. Kebene holt ein Brett hervor. Darauf sind Kondom, Spirale, Pille und Drei-Monats-Spritze befestigt.
Während die Frauen diskutieren, fällt der Großmutter plötzlich auf, ich würde ja wie ihr Sohn aussehen.
"Wie war das, als sie selbst jung waren, als es noch keinen Gesundheitsposten gab?"
"Damals gab es keine Medikamente. Zu meiner Zeit haben wir einfach Jahr für Jahr für Jahr ein Kind geboren. Ich habe meine Familie hierhergebracht, damit sie nicht ständig schwanger werden. Jetzt leben wir in einer guten Zeit, die Kinder bekommen hier Hilfe, wenn ich Probleme habe, werde ich an die Klink überwiesen, wir sind versichert. Wir können unsere Geburten planen, es ist eine gute Zeit."
So also sieht die Revolution im afrikanischen Gesundheitswesen aus. Der Gesundheitsposten ist nicht viel mehr als eine einfache Hütte hinter Wellblech an einer staubigen Straße. Doch das täuscht. Kebene und Filehiwot machen ihn zu einem Leuchtturm der Innovation, auch wenn das Strahlen hier niemandem auffallen mag.