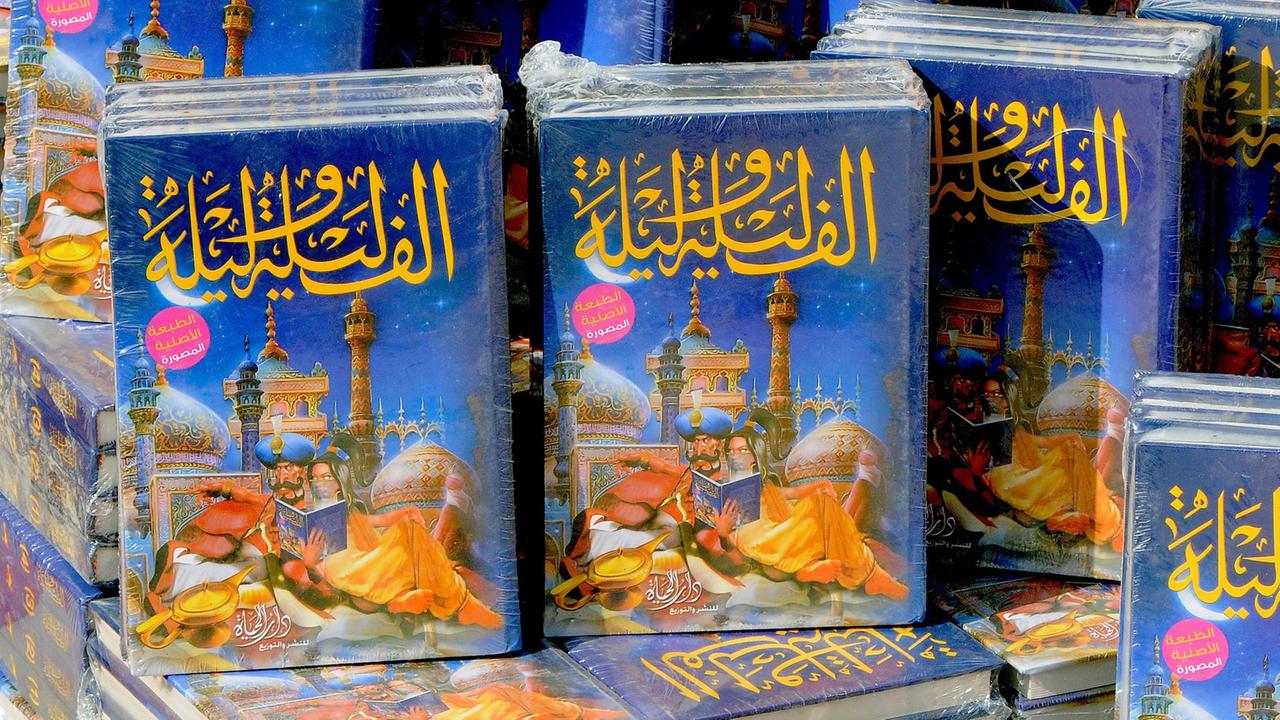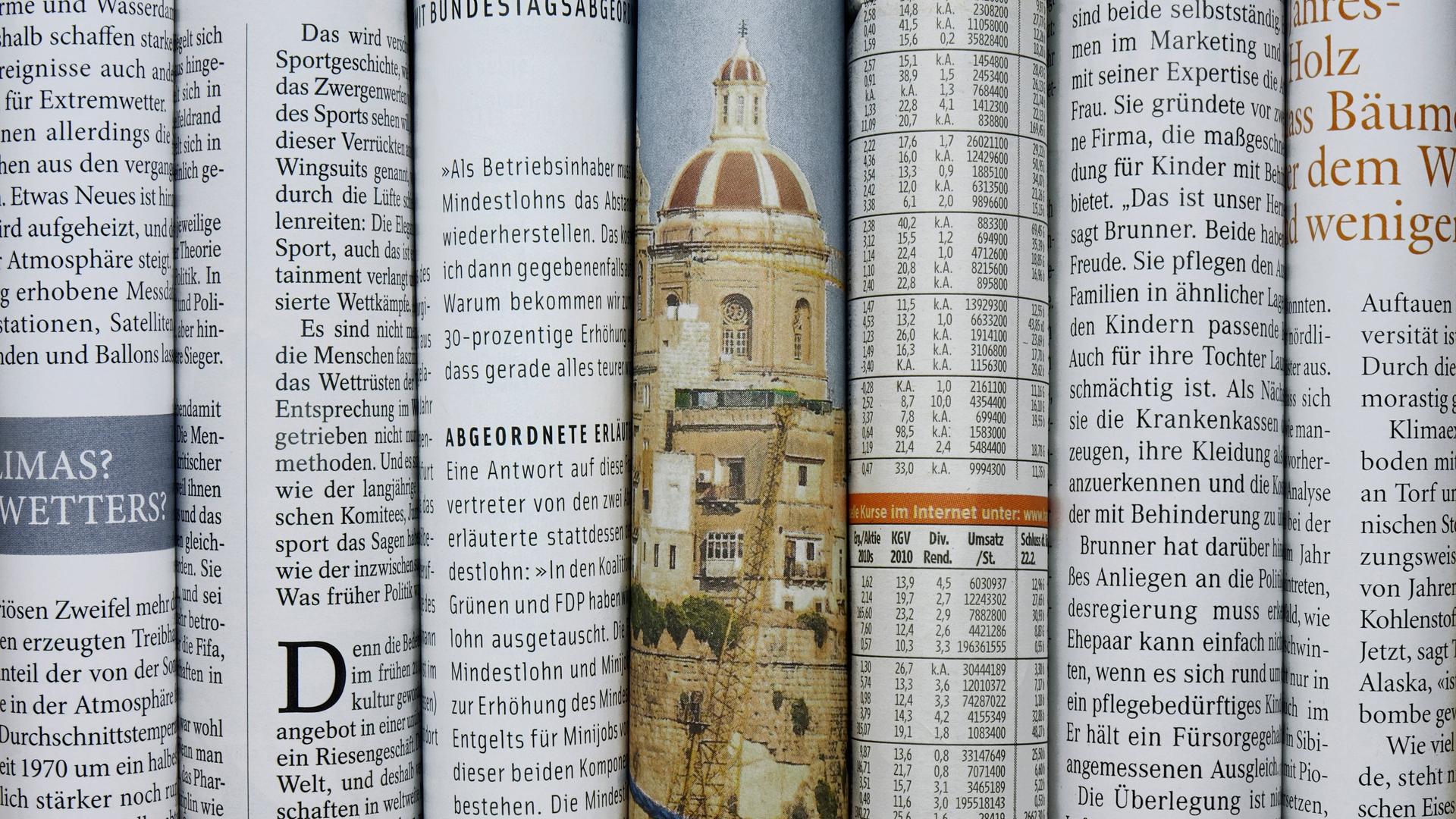Ein Dokumentarfilm über die Affen von Delhi gab der Kulturanthropologin Megnaa Mehtta Anlass, sich Gedanken zu machen über Pflege, Koexistenz und das Raubtier-Beute Verhältnis zwischen Menschen und Tieren. Die Affenplage in Delhi führt zu Verkehrschaos, Unterbrechung von Regierungssitzungen, Abbruch von Dinner Parties der Minister und Regierungsbeamten in den besseren Vierteln von Delhi. Aus den Armenvierteln werden Affenjäger angeheuert, deren Aufgabe es ist, die Affen zu jagen. Der Film begleitet einen der Jäger bei seinem fast aussichtslosen Unterfangen.
Angeblich funktioniert ein gutturaler Ruf, der aus der Magengrube und vermutlich auch aus den Tiefen der menschlichen Seele stammt. Megnaa Mehtta bespricht den Film und taucht ein in eine Welt aus Metaphern und Mythen.
Der Essay von Megnaa Mehtta stammt aus dem Magazin „HIMᾹL Southasian“ und wurde am 26. Juli 2021 veröffentlicht.
Der Dokumentarfilm “Eeb Allay Ooo!“ von Anurag Kashyap, Prateek Vats und Shardul Bharadwaj ist bei Netflix zu sehen.
Megnaa Mehtta ist Umwelt-Anthropologin an der Universität Sheffield und forscht über Werte, Gefühle, Mythologien in Zusammenhang mit globaler Verständigung und politischer Ökologie. Ihr Schwerpunkt liegt auf ethischen und ökologischen Fragen der Menschen in Bezug auf die Landschaften, in denen sie leben und arbeiten. Sie promovierte in Social Anthropology an der London School of Economics and Political Science 2020.
Der Film Eeb Allay Ooo! von Regisseur Prateek Vats beruht auf einer Handlung, die zunächst ziemlich simpel erscheinen mag: Im Zentrum von Delhi herrscht eine Affenplage, und da die Tiere Regierungssitzungen und offizielle Dinnerpartys in den Büros und Häusern der Minister stören könnten, werden eine Reihe von Affenjägern aus den armen Bevölkerungsschichten der Stadt engagiert, um die Primaten zu verscheuchen. Binnen weniger Minuten jedoch betreten wir eine Welt der Metaphern und Metonymien, vertauschten Bedeutungen. Eingebettet ist sie in die materiellen Schieflagen der Stadt Delhi und ihrer diversen menschlichen und nichtmenschlichen Bewohner. Von Anfang bis Ende schwelgt dieser Film in einer Form des schwarzen Humors, der für tiefes Unbehagen bei den Zuschauenden sorgt.
Wie Millionen anderer Migranten, auf deren Rücken Städte wie Delhi errichtet worden sind, ist Anjani verzweifelt auf der Suche nach einem Job. Irgendeinem Job. Seine Schwester, mit der er zusammen in einer Einzimmerbehausung in einem Elendsviertel am Stadtrand von Delhi wohnt, ist schwanger. Sie ist sehr darauf erpicht – in ihrer etwas verbissenen, herrischen und dennoch fürsorglichen Art –, dass Anjani einen recht unkonventionellen, wenn auch „staatlichen“ Job, einen Sarkari Naukri annimmt: und zwar als Affenvertreiber im Regierungsviertel Lutyens’ Delhi.
Anjanis neuer Job hat etwas Absurdes, Groteskes, aber gleichzeitig auch etwas Liebenswertes an sich. Obwohl er auf dem Raisina Hill stattfindet, dem buchstäblichen und metaphorischen Zentrum Delhis und der indischen Macht, findet der Affenjägerjob auf Vertragsbasis statt, geht aber nicht mit den Vergünstigungen eines echten Sarkari Naukri einher. Die Jobbeschreibung ist genauso lächerlich wie die Tätigkeit selbst. Doch wie bei den meisten Jobs geht es hier einfach ums Überleben.
Anjani tut sich schwer in seinem neuen Job. Tatsächlich hat er Angst vor den Affen, die er verscheuchen soll. Sein Kollege Mahinder hingegen ist ein Mann, dessen Familie schon seit Generationen ihren Lebensunterhalt als Affenjäger verdient. Er lernt Anjani an und gibt Tipps, wie dieser ein besserer Jäger werden kann.
Die entscheidende Fähigkeit zur erfolgreichen Jagd auf die Affen besteht darin, drei bestimmte Laute zu erzeugen: Eeb, Allay, Ooo!
Die Laute kommen tief aus der Magengrube, oder vielleicht auch aus irgendeiner verborgenen Nische in den Tiefen der menschlichen Seele. Es sind diese eindrucksvollen, langgezogenen Gutturallaute, mit denen der Film beginnt. Sie klingen animalisch und sind doch allzu menschlich. Dabei kann es sich um Laute tiefen Leids handeln, die dem Heulen in einem Käfig gleichen. Vielleicht sind sie aber auch Ausdruck einer sehr speziellen inneren Freiheit, wie sie nur Arbeiter wie Mahinder kennen. Sie sind ein offener Zugang zum Leben anderer.
Mahinder zaubert diese Laute auf ganz natürliche Weise hervor. Anjani versucht es ihm nachzutun, scheitert aber immer wieder. Stattdessen beschließt er zu improvisieren und es mit anderen Jagdmethoden zu versuchen. Fantasievoll kostümiert er sich als Langurenaffe, außerdem hängt er Poster und Bilder von Langurengesichtern an Zäunen und Mauern auf. Doch seine Kreativität wird jedes Mal aufs Neue unterdrückt. Sogar das Absurde wird von Regeln, starren Strukturen und bürokratischen Normen beherrscht und Anjanis Vorgesetzte fordern ihn auf, seinen unkonventionellen Job mit konventionellen Mitteln auszuüben.
[Die Indischen Languren sind eine Primatengattung innerhalb der Familie der Meerkatzen. Sie werden im Deutschen als Hanuman‑Languren oder Graue Languren bezeichnet. Hanuman-Languren gelten als Kulturfolger und heilige Tiere zu den bekanntesten Affenarten Indiens. Benannt sind sie nach Hanuman, einem indischen Gott in Affengestalt. Anm. der Red.]
Tiere und die tierische Natur haben Künstlern, Schriftstellern und Filmemachern von jeher unbegrenzte Möglichkeiten des kreativen Ausdrucks geboten. Der Kunstkritiker, Maler und Dichter John Berger hat einmal erklärt, es wäre „nicht unsinnig anzunehmen, dass die erste Metapher das Tier war.“ Es ist exakt diese ursprüngliche Affenfigur, die eine artenübergreifende Allegorie ermöglicht, in welcher das Leben der Tiere eine Vorstellung vom Leben der Menschen gibt und umgekehrt. Regisseur Prateek Vats navigiert in seinem Film fortwährend zwischen dem Allegorischen und dem Realen und verwischt dabei gelegentlich auch deren Grenzen.
In gewisser Weise ist Eeb Allay Ooo! ein Film über den Alltag in Delhi, über die ereignisarme, alltägliche und dennoch beängstigende Ungleichheit, die in Delhi herrscht. Der Film zeigt die Qual auf, keinen Job zu haben, die fundamentale Sehnsucht nach einer würdevollen Arbeit, aber auch den niederschmetternden Druck und die innere Zerrissenheit, nicht nur für den eigenen Haushalt und ein sich ankündigendes Kind zu sorgen, sondern auch noch den gewaltigen Erwartungen der Familie gerecht zu werden. Zugleich ist es ein Film über den Glauben in Südasien und sein Spektrum von Ehrfurcht bis Respektlosigkeit, Aberglaube und Hingabe. Wir sehen, wie wichtig es ist, die Affen (die Götter sind) trotz ihres bedrohlichen, Unruhe stiftenden Verhaltens zu respektieren, und wir erkennen die Allmacht der Affenherrschaft – und letztlich auch die Unerlässlichkeit sowohl des Affengottes als auch der Affenherrschaft.
Mittels der Geräuschkulisse sowie der unverkennbaren Ikonografie seiner Schauplätze des Films – der Stadtteil Lutyens’ Delhi, der Raisina Hill, die Parade zum Tag der Republik, das India Gate bis hin zu den Elendsvierteln auf der anderen Seite von Delhi – erzählt Regisseur Prateek Vats auch die Geschichte einer Stadt.
Abgesehen von diesen plakativen Verweisen gibt es auch ruhigere Momente im Film, die auf subtile, unaufdringliche Weise unsere Vorstellungen vom Alltäglichen und Absurden auf den Kopf stellen. Ein Beispiel dafür ist der flüchtige Augenblick, als Anjanis Schwager, der als Wachmann arbeitet, bei der Arbeit ein Gewehr ausgehändigt bekommt. Wir sehen, wie er auf dem Nachhauseweg unbeholfen versucht, das große und unhandliche Teil unter seinem Schal zu verstecken. Es stellt sich heraus, dass seine schwangere Frau den Anblick des Gewehrs nicht erträgt und es aus dem Blickfeld haben möchte. Ihr Mann bemüht sich, in der beengten Unterkunft einen Platz für die sperrige Waffe zu finden, doch sie ragt ostentativ aus jedem der Verstecke heraus. Der Wächterjob mit seinem Arsenal an Erwachsenenspielzeug wirkt im Vergleich zum Langurenkostüm nicht minder komisch und wir werden daran erinnert, wie sehr wir einige Absurditäten als Norm verinnerlicht haben. Plötzlich wird uns klar, wie bizarr doch die sogenannten „normalen“ Jobs in Delhi sind, selbst wenn man sie mit der offensichtlich absurden Tätigkeit des Affenjägers vergleicht.
Eines der weniger erforschten Themen des Films bezieht sich auf die Territorien und Lebensräume zweier verschiedener Lebewesen: Menschen und Affen. Man beachte das folgende Zitat:
„Dies ist der Raisina Hill [das Zentrum der Macht, wo Indiens mächtigste Führer ihre Büros und Häuser haben], der traditionell von Affen regiert wurde! Sogar die Gerichte erkennen das an.“
Wenn Mahinder behauptet, der Raisina Hill habe traditionell den Affen gehört, was will er uns damit sagen? Dass der Mensch in einen Bereich eingedrungen ist, der ursprünglich der Lebensraum der Affen war? Vielleicht ist die Frage aber gar nicht, wer der „ursprüngliche“ Bewohner ist, sprich, wer zuerst da war oder wer „traditionell“ in ein bestimmtes Gebiet gehört und wer verdrängt wird. Vielleicht fordert der Film ja vielmehr dazu auf, uns näher mit den Bedingungen der Koexistenz zu befassen. Auf welche Weise können zwei antagonistische Wesen ein Gebiet gemeinsam bewohnen?
Mahinder gibt Anjani Ratschläge, wie er die Affen verscheuchen kann, und er empfiehlt ihm, ihnen ähnlicher zu werden und ihre Verhaltensweisen zu übernehmen. Er sagt: „Warum wirst du nicht ihr Anführer? Denke wie sie, lebe wie sie“ und ein paar Sätze weiter: „Benutze deine Stimme, um sie einzuschüchtern.“ Diese Sätze offenbaren etwas eher Ungewöhnliches in Bezug auf die Bedingungen des Zusammenlebens: Einerseits wird anerkannt, dass es Unterschiede gibt, und es erscheint unmöglich, in andere Gedanken und Körper einzudringen und sie zu erleben. Andererseits scheint es im Bereich des Möglichen zu liegen, dass die Kluft zwischen diesen beiden Lebewesen überwunden wird und Anjani wie die Tiere „denken“ und „leben“ kann. Doch schlussendlich soll diese intime Kenntnis und Anjanis Verständnis für die Affen aber dazu dienen, dass er ein besserer Jäger wird: Er soll in der Lage sein, „sie einzuschüchtern“. Vielleicht ist dies ja eine viel ehrlichere Form der Koexistenz – eine, die nicht auf Freundschaft beruht, sondern auf Feindschaft.
Im Film taucht gelegentlich noch ein weiterer Mann auf, der unter den Würdenträgern arbeitet, denen die Affen auf dem Raisina Hill nachstellen. Aus Ehrfurcht vor den Affen und vor dem, was sie im Hinduismus repräsentieren, füttert dieser Mann die Affen – sehr zum Verdruss der Affenvertreiber. Er zeigt also eine Form der Fürsorge. Oder etwa nicht? Im weiteren Verlauf des Films wird klar, dass es vor allem Mahinder ist, der Nähe und Vertrautheit zu den Tieren verkörpert, auch wenn er die Affen vertreiben soll – und nicht so sehr der Mann, der scheinbar für die Affen sorgt, indem er sie füttert. Könnte es sein, dass die Ehrfurcht doch eher bei Ersterem zum Ausdruck kommt und weniger bei Letzterem? Mahinders Job beruht auf einer Reihe von inkorporierten Fertigkeiten und einem Wissen über die Affen, das er sich im Laufe der Zeit angeeignet hat, sowie auf dem Bemühen, „wie sie zu leben“ und mit ihnen zu leben. Und dennoch zeichnet er sich gleichzeitig durch die Fähigkeit zum Jagen aus, denn letztlich ist es Mahinders und nun auch Anjanis Aufgabe, die Affen davonzujagen. Die Jagd, so sehen wir, kann also Teil der Koexistenz sein.
Die Analogie, die einem hier in den Sinn kommt, ist die zwischen den sogenannten Gau Rakshaks, den Kuh-Schützern, auf der einen Seite und den Rinderzüchtern auf der anderen. Diejenigen, die Rinder züchten, mit ihnen arbeiten, sie ganz genau kennen, essen gelegentlich auch das Fleisch dieser Tiere. Die Gau Rakshaks wiederum wollen die Kuh beschützen. Nicht nur der Verzehr ihres Fleischs ist blasphemisch für sie, sie sind auch bereit, diejenigen zu töten, die die Kühe essen könnten. Allerdings haben sie selten eine vertraute Beziehung zur Kuh, eine, die sich auf Arbeit und der Einsicht in ihr „Denken und Leben“ gründet. Ähnlich wie bei dem Mann, der die Affen füttert, aus einer abstrakten Form der Ehrerbietung heraus, hat die Fürsorge der Gau Rakshaks etwas Scheinbares, Scheinheiliges an sich.
Der Film Eeb Allay Ooo! denkt das Verhältnis der Kategorien „Nähe“ und „Distanz“ neu. Wie kann man fürsorglich sein und gleichzeitig Jagd auf etwas machen? Der Film zeigt, wie sich unter dem Deckmantel der Liebe und des sogenannten ‚Schutzes‘ die tiefste Form der Gewalt verbergen kann – ein Thema, das die Anthropologin Radhika Govindrajan eindrucksvoll in ihren jüngsten Schriften erforscht.
Im Zusammenhang mit den Themen Territorium, Raum und Eindringung gibt es noch eine weitere Frage, der der Film nachgeht. Die Menschen, die als Affenvertreiber arbeiten, leben am äußersten Stadtrand von Delhi und müssen tagtäglich mehrere Zuglinien überqueren. Die Kamera verharrt minutenlang, um die Wartezeiten an Eisenbahnknotenpunkten einzufangen, und damit die Zeit, die es braucht, um die Gleise zu überqueren und die Distanz zwischen den beiden Lebensräumen zu überwinden – zwischen Anjanis Slumbehausung und den ausgedehnten Affenrevieren im Regierungsviertel. Von den Boulevards und den roten Steinfassaden des Raisina Hill, bis hin zum Slumverschlag, wo Anjani mit seiner Schwester und seinem Schwager lebt, sehen wir, wie Eindringlinge – menschliche und tierische – verschiedene metonymische Räume in der Stadt bewohnen.
Es gehört zu Anjanis Job, dass er Jagd auf die Affen machen muss. Gleichzeitig sehen wir, dass er bei der Arbeit selbst ziemlich hart angefasst wird: Man drängt ihn, seinen Job besser zu machen, und sein Chef droht ihm mit Rauswurf, wenn er die Affen nicht erfolgreich verscheucht. Doch diese Aufgabe ängstigt Anjani, und es gelingt ihm nicht, den Affen genügend Angst einzujagen. Als Zuschauer lachen wir, aber es bleibt unklar, über wen wir lachen. Über die Furcht der Bürobediensteten, Minister und Bewohner des Raisina Hill, über die Frechheit der Affen oder über den komischen und gleichzeitig verzweifelten Anjani im Langurenkostüm?
Der Film wirft die Frage auf, wer hier der Eindringling ist. Wer die Jäger sind. Und ob es sein kann, dass einige Jäger selbst zu Gejagten werden. Die Migranten in den meisten Städten sind entbehrlich – und auch wenn Anjani ein paar Stunden lang als Affenjäger agiert, bleiben er und seinesgleichen doch die eigentliche Beute.
Vielleicht lachen wir in dem Film ja nicht über, sondern mit. Doch es ist nicht klar, mit wem wir lachen. Anjani lacht jedenfalls nicht. Er hat Angst, seine Einkommensquelle zu verlieren – einen Job, den er zwar lächerlich findet, aber trotzdem machen muss – und er ist irritiert von der Affenherrschaft auf dem Raisina Hill, vom Animalischen im Menschen und seinem Bedürfnis, für das Tier menschlicher zu sein.
Am Ende des Films öffnet sich Eeb Allay Ooo! noch einer weiteren Dimension: eine Jaloos, eine religiöse Prozession für den Affengott Hanuman zieht vorbei. An ihr sind auch Tänzer beteiligt und viele von ihnen wirken wie besessen, was angesichts der Macht dieser Götter nicht weiter verwundert. Anjani schließt sich ihrem Tanz an. Wenn man sie schon nicht verjagen kann, wenn man nicht eins mit ihnen werden kann, dann sollte man vielleicht einfach zu ihren Melodien tanzen. Sie verehren.
Aber wer genau sind diese „sie“, die man verehrt? Die tierischen Affen, die menschlichen Affen, die Affengötter oder die Affenjobs? Vielleicht ist Eeb Allay Ooo! ja ein Film, der die Kraft des Kreatürlichen offenbart, einen Raum, der menschliches und nicht-menschliches Leben verbindet. Manche werden, obwohl sie Menschen sind, als mindere Menschen behandelt, und manche Halbmenschen werden verehrt. Zwei Lebewesen können denselben Flecken Erde bewohnen und tun dies nicht als Freunde, sondern als Feinde. In Eeb Allay Ooo! rücken Kaste und Klasse ebenso in den Mittelpunkt wie das Animalische im Menschen, und es zeigt sich, wie sehr die Jagd Teil des Zusammenlebens sein kann.
Aus dem Englischen von Jutta Schiborr