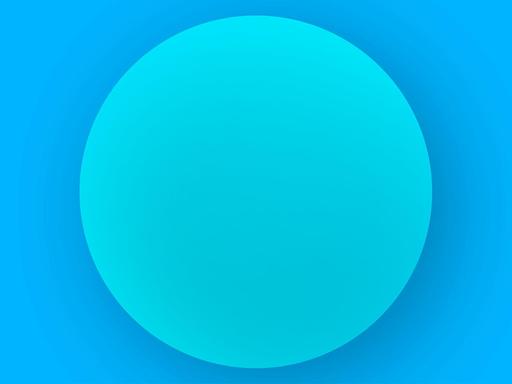Die Innenminister der Länder fordern, dass Abschiebungen in Länder wie Afghanistan und Syrien möglich sein müssen, wenn Asylsuchende und Geflüchtete aus diesen Ländern in Deutschland schwere Straftaten begehen. Bislang gilt für Afghanistan und Syrien ein Abschiebestopp, weil dort Menschenrechtsverletzungen drohen.
Flüchtlingsorganisationen kritisieren die Pläne, und auch die Linke hält Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien für nicht mit Grundgesetz und Völkerrecht vereinbar. Doch das Bundesinnenministerium sucht bereits nach Wegen, wie sich Abschiebungen in diese Länder ermöglichen lassen.
Inhalt
- Warum ist das Thema Abschiebung im Moment für die Bundesregierung wichtig?
- Was fordern die Innenminister der Länder und was sieht der Bund bei Abschiebungen vor?
- Warum werden Flüchtende aktuell nicht nach Afghanistan und Syrien abgeschoben?
- Wie ist die Lage in Afghanistan seit der Amtsübernahme der Taliban?
Warum ist das Thema Abschiebung im Moment für die Bundesregierung wichtig?
Der tödliche Messerangriff in Mannheim hat eine heftige Diskussion über die Abschiebung von Straftätern mit Migrationshintergrund ausgelöst. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte in einer Regierungserklärung nach dem Attentat klargemacht, dass Straftäter abgeschoben werden sollen, auch wenn sie aus Ländern wie Syrien und Afghanistan stammen.
Die Abschiebedebatte ist nicht neu und kocht regelmäßig hoch, so wie nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt 2023. Das Thema Migrationspolitik dominierte auch die Europawahlen.
Angesichts der bevorstehenden richtungsweisenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg fordern einige politische Parteien verstärkt eine verschärfte Abschiebepolitik, um Wähler zu gewinnen. Auch die Ampelkoalition will in der aufgeheizten Sicherheitsdebatte ein Signal senden. Menschenrechtsorganisationen und andere kritisieren die Diskussion indessen als populistische Scheindebatte.
Was fordern die Innenminister der Länder und was sieht der Bund bei Abschiebungen vor?
Die Innenminister der Länder dringen auf die Abschiebung von Schwerkriminellen und islamistischen Gefährdern nach Afghanistan und Syrien. Sachsen und Bayern forderten bei einer Innenministerkonferenz in Potsdam direkte Verhandlungen mit den Taliban und dem Assad-Regime sowie Rückführungszentren an deutschen Flughäfen für Menschen, die ausreisepflichtig sind. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sagte im Deutschlandfunk, die Leute befänden sich bereits in Haft beziehungsweise in Abschiebehaft und könnten sofort der Bundespolizei übergeben werden.
Hamburgs Innensenator Andi Grote schlug vor, internationale Flüge in Syriens Hauptstadt Damaskus auch für Abschiebungen zu nutzen. Grote und die Berliner Innensenatorin Iris Spranger erklärten, bei schweren Straftaten wiege das Schutzbedürfnis der Allgemeinheit schwerer als das des Einzelnen.
Bundeskanzler Scholz steht seit seiner Regierungserklärung im Wort, die Abschiebung von Intensivtätern durchzusetzen. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) arbeitet ihr Ministerium „intensiv“ an neuen Wegen, um islamistische Gefährder und Gewalttäter aus Afghanistan über Nachbarländer zurückzubringen, ohne dabei direkt mit den Taliban verhandeln zu müssen.
Offenbar soll mit Nachbarländern wie Pakistan oder Usbekistan Kontakt aufgenommen werden, um Abschiebungen über diese Länder möglich zu machen. Die Bundesregierung hat zudem erstmals Länder genannt, mit denen sie über Rücknahmeabkommen spricht: Georgien, Moldau, Kirgistan, Usbekistan, Kenia, die Philippinen, Marokko, Kolumbien und Ghana.
Die Zahl der Fälle möglicher Abschiebungen ist allerdings bislang überschaubar: In Brandenburg geht es laut Innenministerium um 28 Syrer und sechs Afghanen in Haft, weiterhin zählt die Task Force Abschiebung 27 syrische und sieben afghanische Mehrfach- und Intensivtäter. Die Hamburger Innenbehörde spricht von 18 vollziehbar ausreisepflichtigen Straftätern aus Afghanistan.
Warum werden Flüchtende aktuell nicht nach Afghanistan abgeschoben?
Flüchtende werden derzeit nicht nach Afghanistan abgeschoben, weil die Bundesregierung die Taliban nicht als legitime Regierung anerkennt und nicht mit ihnen zusammenarbeitet. Zudem geht das Auswärtige Amt von einer katastrophalen Menschenrechtslage im Land aus, die Abschiebungen nicht erlaubt.
Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Kabul im August 2021 gilt in Deutschland ein Abschiebestopp für Afghanen. Die Bilder vom Chaos am Flughafen Kabul, als verzweifelte Afghanen versuchten, auf die letzten Flieger zu gelangen, um vor den Taliban zu fliehen, haben sich tief ins Gedächtnis eingebrannt.
Auch für Syrien gilt seit 2012 Jahren ein Abschiebestopp. Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zum diktatorischen Assad-Regime. Aus Sicht von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) muss die Bundesregierung jetzt aber die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Intensivstraftäter und islamistische Gefährder in das Land abgeschoben werden können. In den meisten Regionen Syriens herrsche kein Krieg mehr, sagte er in Deutschlandfunk Kultur.
Rechtliche Hürden bei möglichen Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien
Doch nicht nur die politischen, auch die rechtlichen Hürden für Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien sind erheblich. Denn es gibt nach der Genfer Flüchtlingskonvention das „Non-Refoulement“-Gebot. Deutschland hat das in §60 des Aufenthaltsgesetzes festgeschrieben: Niemand darf in ein Land abgeschoben werden, wo ihm Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht.
Das macht Abschiebungen nach Afghanistan aufgrund der dortigen Menschenrechtslage oft unmöglich, vor allem für Angehörige von Risikogruppen: Schiiten, Hazara, Angehörige früherer Streitkräfte, Journalisten, Frauenrechtler, ehemalige Ortskräfte und Frauen.
Abschiebungen bedürfen einer Einzelfallprüfung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie einer individuellen gerichtlichen Überprüfung. Auch das persönliche Umfeld, wie familiäre Netzwerke, spielt dabei eine Rolle. Die Einschätzung der Sicherheitslage erfolgt durch das Auswärtige Amt und basiert auf verschiedenen Faktoren, einschließlich geheimdienstlicher Informationen und Einschätzungen von NGOs.
Ein weiterer Faktor ist die Gefahr für Bundespolizeibeamte, die solche Abschiebungen begleiten müssten. Abschiebungen in Nachbarländer sind ebenfalls schwierig, da die Sicherheit der Betroffenen auch dort gewährleistet werden muss.
Wie ist die Lage in Afghanistan seit der Amtsübernahme der Taliban?
Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Kabul im Jahr 2021 hat sich die Lage in Afghanistan dramatisch verschlechtert. Das Auswärtige Amt berichtet von einer katastrophalen Menschenrechtslage.
Die Deutsche Botschaft in Kabul ist geschlossen, konsularische Hilfe vor Ort gibt es nicht, berichtet das Auswärtige Amt. Die Ausreise ist schwierig, der Flughafen Kabul unsicher und die Lage an den Grenzübergängen unübersichtlich.
Die Zahl der Anschläge ist jedoch zurückgegangen, da die Taliban Kampfhandlungen weitgehend eingestellt haben. Dennoch bleiben schwere terroristische Anschläge – zum Beispiel durch den IS – im ganzen Land ein Risiko, vor allem für Ausländer.
Es gibt jedoch auch Rückkehrer, die nicht den Risikogruppen angehören und von den Taliban angeblich willkommen geheißen werden, um beim Wiederaufbau zu helfen. Ihnen droht offenbar keine Gefahr für Leib und Leben – dennoch kehren sie in ein Land mit einer katastrophalen humanitären Situation zurück, in dem ihnen fundamentale Grundrechte verweigert werden.
og, tha