
Der Burchardkai ist der größte Terminal im Hamburger Hafen. 30 Containerbrücken stehen bereit, um Frachter zu entladen. Trotzdem staut sich der Schiffsverkehr hier seit Wochen. Ein Grund ist, dass es im Terminal kaum noch Lagermöglichkeiten für die angelandete Fracht gibt. Die Container werden von den Abnehmern zu langsam weitertransportiert. Die Folge: Vor Cuxhaven warten mehr als zehn große Containerschiffe auf die Einfahrt in die Elbe – einige mit bis zu zwei Wochen Wartezeit.
„Vorrangig hat es natürlich mit den pandemischen Auswirkungen zu tun“, sagt Jens Hansen, Vorstand des Terminal-Betreibers HHLA. „Die Ukraine-Krise spürt man natürlich, wenngleich das eher ein temporärer Aspekt aktuell für uns ist. Es ist tatsächlich eher die außer Tritt geratene Supply-Chain durch die pandemische Auswirkung.“
„Vorrangig hat es natürlich mit den pandemischen Auswirkungen zu tun“, sagt Jens Hansen, Vorstand des Terminal-Betreibers HHLA. „Die Ukraine-Krise spürt man natürlich, wenngleich das eher ein temporärer Aspekt aktuell für uns ist. Es ist tatsächlich eher die außer Tritt geratene Supply-Chain durch die pandemische Auswirkung.“
Andrang an den Häfen
Zwei Prozent der weltweiten Containerflotte sollen derzeit vor den Küsten Deutschlands, der Niederlande und Belgiens auf Einfahrt in die Häfen warten. Das berichtet das Kiel Institut für Weltwirtschaft, das die Handelsflüsse in 75 Ländern und Regionen verfolgt. Das entspricht gut 100 Schiffen. Noch mehr Ungemach erwarten Experten nach dem langen Corona-Lockdown in Shanghai. Durch ihn hing ein großer Teil des Frachtverkehrs vor dem Hafen der chinesischen Handelsmetropole fest. Nun entspannt sich die Lage langsam – und an den Häfen hierzulande droht noch mehr Andrang.
Solch heftige Schwankungen im internationalen Lieferverkehr zwischen den großen Wirtschaftsblöcken hätten die Pandemie von Beginn an begleitet, sagt Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) in Wien. Nicht nur die Lockdowns hätten die Lieferketten unter Stress gesetzt, sondern auch eine plötzlich ansteigende Nachfrage:
Solch heftige Schwankungen im internationalen Lieferverkehr zwischen den großen Wirtschaftsblöcken hätten die Pandemie von Beginn an begleitet, sagt Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) in Wien. Nicht nur die Lockdowns hätten die Lieferketten unter Stress gesetzt, sondern auch eine plötzlich ansteigende Nachfrage:
„Als China Anfang 2020 schon die ersten Quarantänemaßnahmen durchgesetzt hat, kam es natürlich zu einem Einbruch des Handels, aber kurz danach sehr schnell nicht nur zu einem Auf- oder Nachholen, sondern zu einem regelrechten Boom, der dann eben manches an Verwerfungen hervorgerufen hat, weil die Welt nicht vorbereitet war auf diese starke Nachfrage nach Importen aus China. Die Containerschiff-Kapazitäten wurden in den ersten Monaten der Coronakrise eher abgebaut, da gab es Überkapazitäten. Und plötzlich dieser Boom, dann haben wir festgestellt, wir haben zu wenig Container, zu wenig Schiffe. Und das hat sich dann fortgesetzt, auch auf die nationalen Logistiksysteme.“
Die Corona-Pandemie war für die internationale Arbeitsteilung ein Schock, der längst nicht verarbeitet ist, wie es die wartenden Containerschiffe in der Nordsee zeigen. Grenzen wurden geschlossen, der Verkehr stand still. Lieferketten brachen zusammen. Unternehmen mussten nicht nur wegen der Kontaktbeschränkungen die Maschinen herunterfahren, sondern auch weil wichtige Rohstoffe und Zulieferungen fehlten.
Fragile Wertschöpfungsketten
Schnell wurde klar: Eine wichtige Idee der Globalisierung stieß an ihre Grenzen – dass alle profitieren, wenn alle sich auf das konzentrieren, was sie am besten können. Die Wertschöpfungsketten vieler Unternehmen, auf Kosten und Effizienz getrimmt, stellten sich häufig als äußerst fragil heraus. Und mit dem Krieg gegen die Ukraine kam eine weitere bittere Erkenntnis hinzu: dass Deutschland und Europa sich nicht nur zu abhängig von anderen gemacht haben könnten, sondern auch von den falschen Partnern.
Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie: „Dieser Krieg, das Brechen des Völkerrechts durch Russland, lehrt uns, dass wir im Umgang mit Autokraten umdenken müssen. Denn zu vertrauen, dass es einen globalen Grundkonsens gibt, das ist schlichtweg zu riskant, das kann man am Beispiel Russland einfach beweisen.“
Damit zerschlägt sich eine weitere Hoffnung, die besonders westliche Länder mit der Globalisierung verbanden: dass wirtschaftliche Öffnung dazu führen könnte, dass sich in autokratischen Regimen auch die Ideen einer offenen Gesellschaft einnisten – Wandel durch Handel. Im Fall Russlands wird ebenso deutlich wie in China, dass Handel langfristig keinen Wandel gebracht hat.
Damit zerschlägt sich eine weitere Hoffnung, die besonders westliche Länder mit der Globalisierung verbanden: dass wirtschaftliche Öffnung dazu führen könnte, dass sich in autokratischen Regimen auch die Ideen einer offenen Gesellschaft einnisten – Wandel durch Handel. Im Fall Russlands wird ebenso deutlich wie in China, dass Handel langfristig keinen Wandel gebracht hat.
Kein globaler Grundkonsens
Für Anna Cavazzini, Abgeordnete der Grünen im Europaparlament, nicht das einzige Anzeichen dafür, dass die Globalisierung in der Krise steckt. Weitere Faktoren kämen hinzu: „Das ist natürlich entstanden dadurch, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren die Lieferketten immer weiter ausdifferenziert haben, immer mehr auch einfach in den globalen Süden in andere Länder outgesourct und uns dadurch natürlich auch verwundbarer gemacht haben.“
Die wirtschaftliche Globalisierung wird vor allem aus dem linken politischen Spektrum seit Jahren grundlegend kritisiert. Ihr wird viel angelastet: eine stärkere Spaltung in Arm und Reich etwa, mehr Ausbeutung von prekären Arbeitsverhältnissen, zu große Macht für Unternehmen und die Zerstörung der Natur.
Gegen die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada, TTIP und CETA, protestierten vor einigen Jahren mehr als 200.000 Menschen in Deutschland. TTIP wurde nie umgesetzt und CETA läuft zwar, wurde aber noch immer nicht vollständig ratifiziert. Das bereits fertige Mercosur-Abkommen mit Lateinamerika legte die EU auf Eis – aus Protest gegen die Regenwaldrodung in Brasilien.
„Ich glaube schon, dass jetzt der Schock so groß ist, dass auch die – sage ich mal – Mainstream-Ökonom*innen und Wirtschaftslenker*innen sehen, dass es Probleme gibt und dass man in gewissen Dingen einfach umsteuern muss“, sagt Anna Cavazzini. Aus Sicht der Europaabgeordneten stehen den Erfolgen der Globalisierung viele schwerwiegende Probleme gegenüber.
„Dass es eben natürlich zu Wohlstandsgewinn geführt hat in ganz vielen Bereichen der Welt, aber dass insbesondere innerhalb vieler Gesellschaften die Globalisierung zu Spaltungen geführt hat, zu unglaublich hohen Einkommen auf der einen Seite, zu Wohlstandsverlust bei der unteren Mittelschicht, zu mehr Ausbeute im globalen Süden und natürlich auch zu Klimazerstörung und auch den Verlust von Biodiversität beigetragen hat. Und wenn man sich diese ganzen Probleme anschaut, würde ich sagen, jetzt ist es an der Zeit, da ein paar Weichen anders zu stellen. Denn es ist ja so, dass die Globalisierung nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist. Das waren einfach politische Entscheidungen.“
Wohlstand hier, Ausbeutung dort
Cavazzini gibt sich hoffnungsfroh, dass Deutschland sich nun, da mit Robert Habeck ein Grüner Wirtschaftsminister ist, für einen Schwenk in der Außenhandelspolitik einsetzt. Tatsächlich machte Habeck sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos dafür stark, die Krise für einen Umbau der Globalisierung zu nutzen: „Deswegen der Vorschlag: eine Globalisierung für die Menschen, mit nachhaltigen Kriterien, mit Schutz für Klima und Umwelt aufzulegen, wo das nicht mehr als Hindernis für den Handel gesehen wird, sondern als Ziel für den Handel.“
Habecks Parteifreundin Anna Cavazzini setzt darauf, dass ein europäisches Lieferkettengesetz für mehr Fairness sorgt – zumindest in einigen Bereichen. Nach dem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission sollen Unternehmen nicht nur selbst menschenwürdige Arbeitsplätze und Umweltstandards gewährleisten, sondern auch bei ihren Lieferanten von Vorprodukten dafür sorgen.
Cavazzini plädiert vor allem dafür, die ihrer Ansicht nach zu große Macht von Unternehmen einzudämmen:
„Wir haben internationale Investitionsschutzabkommen, die ausländischen Investoren massive Rechte zubilligen, jegliche politische Entscheidung in ihrem sozialen Gastland, wo die Investitionen getätigt werden, vor privaten Schiedsgerichten anzugreifen und Milliarden zu beklagen. Und ich könnte unzählige Fälle aufzählen, wo wirklich demokratisch getroffene Entscheidungen beklagt wurden, deswegen rückgängig gemacht wurden oder eben Milliardensummen gezahlt wurden. Also die Idee ist, Demokratie wird von globalen multinationalen Unternehmen de facto angegriffen.“
Auch von rechter Seite gibt es starke Vorbehalte gegen die Globalisierung. Im Zentrum dieser Kritik: ein angeblicher Souveränitätsverlust des Nationalstaats und verhasster Multikulturalismus. Die extreme und populistische Rechte bringt die Nation und die ethnisch definierte Volksgemeinschaft in Stellung gegen Importe und Investitionen, die angeblich heimische Arbeitsplätze in Gefahr bringen.
Auch von rechter Seite gibt es starke Vorbehalte gegen die Globalisierung. Im Zentrum dieser Kritik: ein angeblicher Souveränitätsverlust des Nationalstaats und verhasster Multikulturalismus. Die extreme und populistische Rechte bringt die Nation und die ethnisch definierte Volksgemeinschaft in Stellung gegen Importe und Investitionen, die angeblich heimische Arbeitsplätze in Gefahr bringen.
Wo Populisten Wahlerfolge feiern konnten, hatten sie meistens Globalisierungskritik im Gepäck. „America first“, hieß die Parole unter Ex-Präsident Donald Trump in den USA, „La France d’abord“ ist die französische Version von Marine Le Pen und ihrer rechtsextremen Partei Rassemblement National. Und die Populisten haben durch die Krisen womöglich Aufwind. Wirtschaftsminister Habeck warnte nicht umsonst vor nationalistischen Reaktionen.
Was aber neu ist an der Kritik der Globalisierung: dass sie auch von denen hinterfragt wird, die bislang zu ihren Verfechtern gehörten. Auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos im Mai bezog Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg klar Position: „Der Krieg in der Ukraine führt uns vor Augen, dass Wirtschaftsbeziehungen mit autoritären Regimen uns verletzlich machen können, durch zu große Abhängigkeit vom Import wichtiger Güter wie Energie, wegen der Risiken, die entstehen, wenn hochentwickelte Technologie wie Künstliche Intelligenz exportiert wird, durch die geschwächte Resilienz, wenn zentrale Infrastruktur wie das 5G-Netzwerk aus dem Ausland kontrolliert wird. Dabei geht es um Russland, aber auch um China, ein weiteres autoritäres Regime, das unsere Werte nicht teilt und die regelbasierte internationale Ordnung untergräbt. Internationaler Handel hat ohne Frage großen Wohlstand geschaffen. Aber wir müssen erkennen, dass unsere wirtschaftlichen Entscheidungen Konsequenzen für unsere Sicherheit hatten. Freiheit ist wichtiger als Freihandel.“
Wie handeln mit Autokratien?
Der Ausverkauf von High-Tech-Entwicklungen und die Risiken für wichtige Infrastrukturen waren auch zuvor schon Grund zur Sorge. Bislang aber wären führende Köpfe der westlichen Welt wie Stoltenberg kaum auf die Idee gekommen, in Freiheit und Freihandel einen Gegensatz zu sehen. Im Fall von Russland haben viele Unternehmen den Appell gar nicht benötigt, um sich aus dem Land zurückzuziehen. Darunter sind die großen deutschen Autobauer, Lebensmittelkonzerne oder Versicherer.
Unternehmen zögen heute mehr geopolitische Überlegungen als bisher in ihre Entscheidungen mit ein, sagt Claudia Schmucker, die bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP, das Programm für Geoökonomie leitet: „Das alte Konzept des Just-in-Time, dass man sich nur auf Effizienz verlässt, um möglichst kurzfristig zu produzieren, all das ist vorbei, weil eben die geo-ökonomischen Risiken stärker werden und deutsche Unternehmen sehr stark im Ausland investieren. Wir sind ja nicht die Unternehmen, die für den heimischen Markt produzieren, wie beispielsweise viele amerikanische Unternehmen, sondern wir sind im Ausland und natürlich auch hier nicht nur in Demokratien, sondern auch in Autokratien, sodass die Unternehmen eben sehen müssen, welche politischen Risiken gibt es? Wie wird sich hier die Politik verändern?“
In Bezug auf Russland war die Antwort vieler Unternehmen deutlich. Schwieriger ist es für die Politik, sich aus der Abhängigkeit vor allem von russischem Gas zu befreien. Die wurde trotz Warnungen aus dem Ausland über viele Jahre einvernehmlich von deutschen Unternehmen und deutscher Politik geschaffen – weil russisches Gas günstig und stets verfügbar war.
„Aber hier wird eben deutlich: Autokratien, auf die kann man sich nicht verlassen“, sagt Claudia Schmucker von der DGAP. „Und Russland ist relativ eindeutig, die deutschen Unternehmen haben sich hier relativ eindeutig verhalten. Aber die große Frage, die natürlich dahinter steht, ist immer China. Wie gehen wir mit China um – auch eine Autokratie – die enge Vernetzung, können wir uns darauf verlassen, dass China weiter Vorprodukte liefert, dass wir importieren können? All diese Fragen müssen sich Unternehmen stellen.“
Markt und Moral
Laut Statistischem Bundesamt wurden allein 2021 Importe und Exporte im Wert von insgesamt 245 Milliarden Euro zwischen China und Deutschland gehandelt. Mehr als ein Zehntel der Waren, die Deutschland importiert, kommen aus China. Deutschlands Exporte wiederum gehen zu sieben Prozent nach China. Vor allem für die deutschen Autobauer geht es kaum noch ohne den dortigen Markt. VW, BMW und Mercedes setzen zwischen 30 bis 40 Prozent ihrer Fahrzeuge in China ab. Auch in der Elektronik- und Chemieindustrie funktioniert nur wenig ohne Zwischenprodukte aus Fernost. Zum Problem dürfte auch werden, dass China auf unverzichtbare Rohstoffe wie seltene Erden ein Quasi-Monopol hält. Die Metalle stecken in Akkus, Solarmodulen oder Elektroautos.
Für den Europaabgeordneten Daniel Caspary, Chef der CDU/CSU-Gruppe im Europa-Parlament, ist es an der Zeit, gegenzusteuern: „Die Abhängigkeit ist zu groß. Wir haben zu viele Produkte und auch zu viele Rohstoffe, die eben nur aus China kommen oder wo Zulieferteile aus China kommen. Und ich glaube, wir in der Politik haben eigentlich für die Wirtschaft auch viele Alternativen in den letzten Jahren geschaffen, die aber nicht genutzt wurden. Nehmen Sie das breite Netz an Handelsabkommen, die wir zum Beispiel abgeschlossen haben. Dass man eben auch in anderen Länder in der asiatischen Region, Vietnam als Beispiel, Südkorea als Beispiel, Japan als Beispiel, investieren könnte und die Produkte herholen, weil wir eben Freihandelsabkommen haben.“
Dass solche Initiativen für die Wirtschaft so leicht zu ergreifen sind, bezweifelt Außenhandelsexpertin Claudia Schmucker von der DGAP jedoch: „Das Problem ist immer, dass sich Unternehmen natürlich die Frage stellen, wo ist das Wachstum? Wo ist der Markt? Und die deutschen Unternehmen und Arbeitsplätze können nur gehalten werden durch die Produktion auch in China. Und wenn man sich anguckt, wo sind die Alternativen? Wenn man sich die Automobilindustrie anschaut, die in Deutschland sehr wichtig ist – jedes zweite oder dritte Auto wird in China verkauft – die können nicht einfach auf den chinesischen Markt verzichten.“
VW etwa wurde dafür kritisiert, dass der Konzern auch nach erneuten Berichten über die Unterdrückung und Ausbeutung von Uiguren in chinesischen Arbeitslagern in der Provinz Xinjiang an der Produktion dort festhalte. Auf der anderen Seite überlegt etwa der Industrielobbyverband BDI bereits, wie die Abhängigkeit verringert werden kann. Die Industrievertreter haben China schon länger als systemischen Wettbewerber zu liberalen, marktwirtschaftlichen Staaten wie Deutschland ausgemacht und überlegen, ob sich die Wirtschaft stärker Richtung Westen orientieren sollte.
Trendwende in der Globalisierung?
Für Marktbeobachter wie Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, kündigt sich hier eine Trendwende in der Globalisierung an:
„In vielen Jahrzehnten haben wir gesehen, dass der Welthandel stärker gewachsen ist als das Welt-Bruttoinlandsprodukt und diese Intensivierung der Globalisierung hörte in der großen Finanzkrise 2008, 2009, 2010 auf. Das heißt in den zurückliegenden gut zehn Jahren hat sich die Globalisierung schon nicht weiter intensiviert. Und von nun an ist meine These: dass wir dort in eine Deglobalisierung übergehen. Das heißt, dass von nun an der Welthandel langsamer wächst als das Welt-Bruttoinlandsprodukt. Denn wir haben es zu tun mit einem China, das ich immer mehr re-ideologisiert. Und die politische Frontstellung zwischen China und im Westen wird immer ausgeprägter.“
Deglobalisierung: Das ist das Schlagwort, das seit einiger Zeit die Politik aufschreckt. Eine Abkehr von der weltweiten Zunahme wirtschaftlicher Vernetzung, die in den vergangenen Jahrzehnten Wachstum und Wohlstand gesichert hat. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor einer Deglobalisierung.
Deglobalisierung: Das ist das Schlagwort, das seit einiger Zeit die Politik aufschreckt. Eine Abkehr von der weltweiten Zunahme wirtschaftlicher Vernetzung, die in den vergangenen Jahrzehnten Wachstum und Wohlstand gesichert hat. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor einer Deglobalisierung.

Für den Wiener Ökonom Gabriel Felbermayr ist noch nicht ausgemacht, dass ein Rückschritt in der Globalisierung ansteht. Er erwartet aber, dass sie in eine andere Richtung verläuft – und regionaler wird: „Also dass man wohl weiter Handel treibt und die Wertschöpfungsnetzwerke verzahnt international, aber nicht eben mit allen Ländern, sondern mit Ländern, wo es ein hohes Ausmaß an politischem Vertrauen gibt. Und das könnte bedeuten, dass in diesen Klubs von gleichgesinnten Ländern es zu einer Vertiefung des Handels kommt, aber der Handel über die Klubgrenzen hinaus eingeschränkter wird.“
Jenseits dieser Grenzen stünde wohl auch China, das seinen Aufstieg dem Zugang zu westlichen Märkten zu verdanken habe, sagt Commerzbank-Ökonom Krämer. Eine Annäherung an westliche Werte und Vorstellungen habe es damit aber noch nicht gegeben: „Ganz im Gegenteil: Damit ging einher eine Außenpolitik, die zunehmend machtbetonter ist und von manchen auch als Bedrohung wahrgenommen wird. Gerade in der amerikanischen Politik, da sind sich Republikaner und Demokraten einig, versuchen sie jetzt, den Außenhandel mit China einzuschränken.“
Die EU sichert sich ihrerseits etwa durch Handelsschutzinstrumente und Maßnahmen gegen staatliche Subventionen ab. Bei so viel Schutzmaßnahmen und geopolitischem Abwägen komme eines zu kurz, mahnt die Ökonomin Claudia Schmucker: ein positiver Impuls für die Globalisierung. „Gerade wenn wir sagen, wir müssen raus aus China oder uns weniger auf Autokratien verlassen, wo sind denn dann unsere Abkommen, die wir mit anderen Ländern schließen? Die sind eben ins Stocken geraten.“
Durch die Sanktionen gegen Russland und die Vorbehalte gegen China kommt aber Bewegung in die Sache. In den kommenden Wochen soll ein Freihandelsabkommen mit Neuseeland abgeschlossen werden. Verträge mit Chile und Mexiko sollen folgen. Und auch mit Australien gibt es wieder Gespräche, nachdem sie wegen eines Streits mit Frankreich um einen U-Boot-Auftrag ins Stocken geraten waren. Und weitere Abkommen sind geplant. In einer lahmenden und von geopolitischen Interessen belasteten Globalisierung sucht die EU den Schulterschluss mit gleichgesinnten Staaten. Wenn sie noch Rohstoffe haben, umso besser.


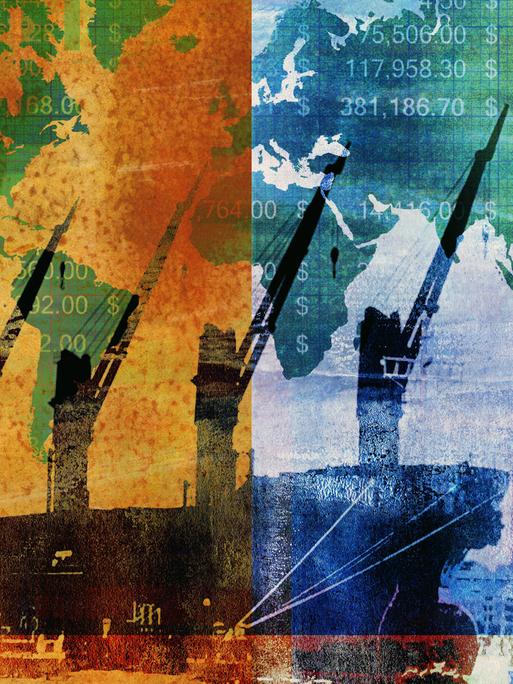




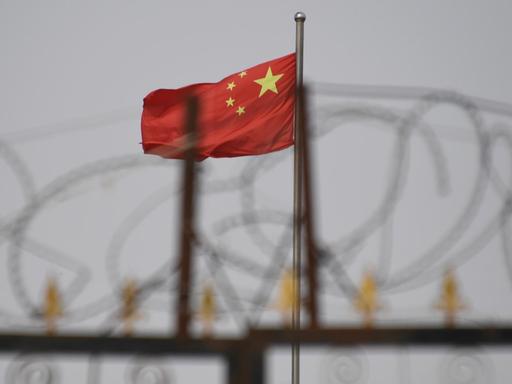






![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)


