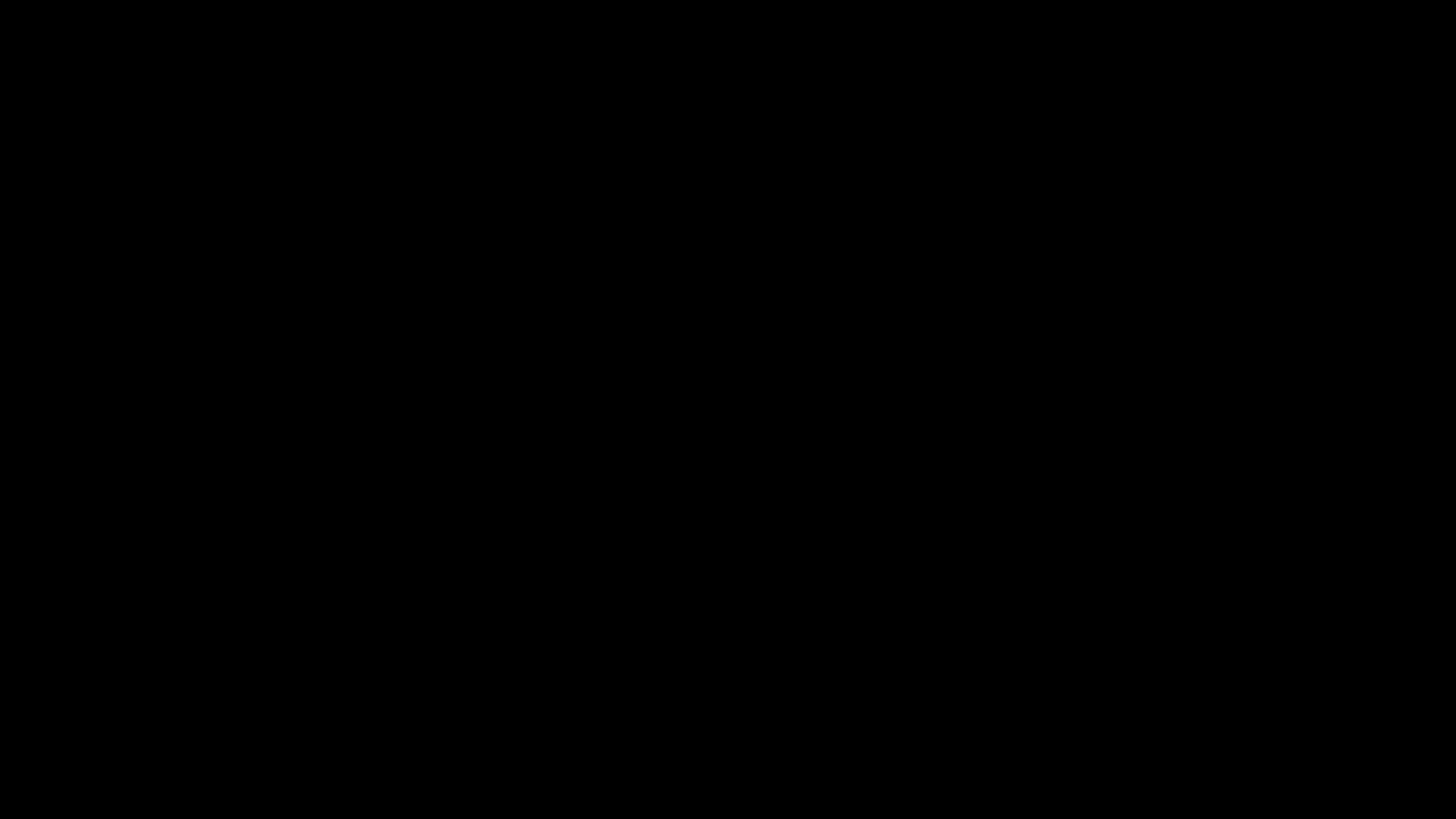"Ich war nie wütend, sondern verletzt und verwirrt", sagt Keisha Buchanan. Die Popsängerin sitzt auf ihrem Sofa und spricht in die Kamera über ihr Leben als "das schwarze Sugababe".
Der Tod von George Floyd hat eine große Debatte ausgelöst, besser gesagt einer langen bestehenden Debatte eine breite Aufmerksamkeit verschafft. Diese Debatte geht weit über einen rassistisch motivierten Mord an einem Afroamerikaner durch einen weißen Polizisten hinaus. Es geht um die Strukturen, die Taten wie dieser zugrunde liegen. Und spätestens seit dem Blackout Tuesday und der Initiative #theshowmustbepaused haben sich auch vermehrt Popstars in den USA und Europa zu Wort gemeldet, um strukturellen und Alltagsrassismus in der Gesellschaft und im Musikbusiness zu thematisieren.
"Keisha reacts angrily"
Die von britischen Popstars wie der "Little-Mix"-Sängerin Leigh-Anne Pinnock oder auch der X-Factor-Kandidatin Misha B geschilderten Situationen, erscheinen erst mal sehr persönlich, aber in der Häufung wird schnell deutlich, da doppeln sich Motive.
So auch in kleinen Formulierungen, etwa wenn Keisha Buchanans in einem Interview von einem weißen Journalisten mit den Worten "Keisha reacts angrily" beschrieben wird. Dann nämlich führe das dazu, so die Sängerin, "dass sich in den Köpfen der Leute das Bild von mir als 'Angry Black Woman' bildet."
"Angry Black Woman" – also eine "wütende schwarze Frau" kennt die Filmemacherin und Geschätsführerin des rassimuskritischen Vereins Each One Teach One Nadja Ofuatey-Alazard als eine "Abwertungsstrategie", die erst mal für alle Frauen gilt:
Verärgerung und Wut ist ja eine Domäne, die erst mal den Männern zugeschrieben werde, sagte sie im Deutschlandfunk, schließlich werde weißen Männern sehr viel seltener verboten, sich auch so zu äußern. Aber, so Ofuatey-Alazard, "wenn Frauen sich wütend oder verärgert äußern, werden sie sowieso diffamiert, ob es nun weiße oder schwarze Frauen sind".
Narrative aus der Zeit des Versklavungshandels
Dass die Maßgabe schwarzen Frauen gegenüber, weniger mit Wut zu reagieren, aber auch eine rassistische Komponente hat, wird deutlich, wenn man sich mit der Geschichte der "Angry-Black-Woman"-Figur beschäftigt. Diese beginnt für Nadja Ofuatey-Alazard "mit dem Versklavungshandel" und der damit verbundenen "Entmenschlichung".
Davor seien schwarze Menschen in Europa eher als Könige oder Heilige dargestellt worden. Danach würden sie "auf einer Achse zwischen einer Tumbheit" – hier nennt sie die Figur des Uncle Sam – "und dem hypersexuellen, aggressiven schwarzen Mann" beschrieben. Analog dazu bei Frauen "die tumbe Afrikanerin oder versklavte Frau und auf der anderen Seite diese wütende schwarze Frau, die auch eine exotische und sexuelle Komponente hat, in diesem Konstrukt".
Das Recht, wütend zu sein
Der Grund dafür, dass das Narrativ der "Angry Black Woman" auch heute noch so wirkmächtig sei, sieht Nadja Ofuatey-Alazard in einer Verweigerung des weißen Westens "sich mit seinen Rassismen wirklich auseinanderzusetzen". Wenn man Frauen, die sich öffentlich kritisch zu einem Thema äußern, als besonders wütend bezeichne, dann spreche man ihnen eine Expertise und Sachlichkeit ab. Auf diese Weise vermeide man, sich inhaltlich mit den Themen und Inhalten, die sie ansprechen, auseinanderzusetzen. Gleichzeitig werde übersehen: "Wenn es eine Gruppe an Menschen in den USA und in Europa gibt", so Nadja Ofuatey-Alazard, "die das Recht haben, wütend zu sein, dann sind es schwarze Menschen."
Folgt man Ofuatey-Alazard, kann in einer so kleinen Bemerkung wie "Keisha reacts angrily" also eine "Entwertung der Aussagen oder der ganzen Person" mitschwingen. Darüber hinaus werde schwarzen Frauen mit einem Jahrhunderte alten rassistischen Stereotyp auch heute noch "das Recht abgesprochen, wütend zu sein". Die Darstellung schwarzer Frauen als Angry Black Woman erscheint somit vor dem Hintergrund von drängenden Debatten über strukturellem Rassismus als "ein sehr gewaltvoller und natürlich rassistisch motivierter Abwehrreflex".