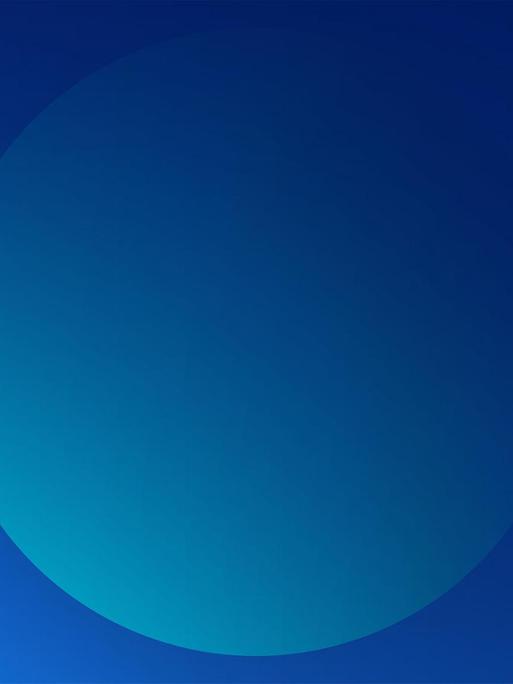Ein indischer Arbeiter in Israel, getötet von einer Hisbollah-Rakete: Im März 2024 schlug die Geschichte von Nibin Maxwell international Wellen. Er war einer von vielen Indern, die sich in Israel als Billiglöhner verdingen. Warum arbeiten Menschen aus Indien in Israel, obwohl es dort so gefährlich ist?
Der Fall Nibin Maxwell
Im Dezember 2023 verlassen Nibin Maxwell und sein Bruder Nivin ihre Heimat Indien. Sie wollen tausende Kilometer entfernt in Israel arbeiten - einem Land, das da schon mitten im Gaza-Krieg steckt. Seit dem Angriff der Hamas wirbt Israel in Indien gezielt Arbeitskräfte an, ein entsprechendes Abkommen wurde im vergangenen Jahr unterzeichnet.
Nibin findet Arbeit auf einer Mandelfarm, auf einem Feld nahe der Grenze zum Libanon. Anfang März schießt die Hisbollah eine Rakete aus dem Libanon Richtung Israel, vorbei am Iron Dome, dem Raketenabwehrsystem des Landes.
Die linke Körperhälfte zerfetzt
Die Rakete schlägt auf dem Feld ein, auf dem Nibin arbeitet. Er beschneidet gerade einen Mandelbaum, als seine linke Körperhälfte zerfetzt wird. Sein Bruder Nivin, der in Israel eine Arbeit an einem anderen Ort gefunden hatte, fliegt mit dem Sarg zurück nach Indien.

Doch Nivin wird nach Israel zurückkehren. Die Arbeitsbedingungen und der Lohn in Israel seien besser als in Indien oder den Golfstaaten, sagt er.
Die fehlenden palästinensischen Arbeiter
Indische Arbeiter wie die Maxwells werden in Israel meist für die harte Arbeit auf Plantagen oder Baustellen eingesetzt. Sie füllen die Lücke, die Palästinenser auf dem israelischen Arbeitsmarkt hinterlassen haben - denn diese dürfen seit dem Angriff der Hamas nicht mehr nach Israel kommen, wegen Sicherheitsbedenken.
Israel fehlen seitdem schätzungsweise mehr als 150.000 Arbeiter aus dem Westjordanland und Gaza. Wie viele es genau waren, ist schwer zu sagen, weil einige auch ohne Genehmigung illegal in Israel gearbeitet haben und die Zahl der palästinensischen Arbeiter in israelischen Siedlungen im Westjordanland nicht klar erfasst wird.
Der lange Weg zur Arbeit
Die Palästinenser waren schnell und flexibel, doch ihr Arbeitsweg war kein einfacher - auch vor dem Krieg nicht. Die Arbeiter mussten oft lange an Checkpoints warten, um vom Westjordanland nach Israel zu kommen. Arbeitswege von vier Stunden waren nicht ungewöhnlich. Und bei fast jeder Militäroperation wurden die palästinensischen Arbeiter nach Hause geschickt, sagt Assia Ladishinskaya von der israelischen NGO Kav LaOved, die sich für Arbeiterrechte einsetzt.
Ladishinskaya spricht von einem System der kollektiven Bestrafung, das Israel immer wieder anwende: „Gab es beispielsweise eine Welle von terroristischen Anschlägen, wurden die Baustellen stillgelegt und die palästinensischen Arbeiter nach Hause geschickt. Man wartet dann darauf, dass sich die öffentliche Meinung entspannt, und danach dürfen dann die Arbeiter wieder kommen.”
Mit dem Lohn, der in Israel deutlich höher ist als im Westjordanland, haben die palästinensischen Arbeiter oft ganze Familien ernährt. Wann sie wieder nach Israel kommen können, ist vollkommen ungewiss. Währenddessen suchen die Israelis im Ausland nach Ersatz. So auch in Indien.
Indien rekrutiert Arbeiter für Israel
Hilfe dabei leistet Uttar Pradesh: Der bevölkerungsreichste Teil Indiens rekrutiert als erster Bundesstaat in Indien Arbeiter für Israel. Die Lokalregierung erfüllt damit ein neues Abkommen, das Israel und Indien im November 2023 unterschrieben hatten. Der Angriff der Hamas auf Israel ist da noch nicht einmal einen Monat her.
Das Abkommen stößt schnell auf heftige Kritik in Indien. Indien helfe Israel dabei, den palästinensischen Arbeitern die Lebensgrundlage zu rauben, meint Usman Jawed, der die Nichtregierungsorganisation FairSqaure berät: „Seit unserer Unabhängigkeit war Indien eigentlich immer auf der Seite der Palästinenser. Und jetzt all das über Bord zu werfen, und auch die Sicherheit der eigenen Arbeiter dort über Bord zu werfen, nur um an ein paar Tausend Jobs zu kommen, halte ich für ziemlich verwerflich.“
Es ist ein außenpolitischer Kurswechsel, der sich in Indien schon seit längerem angedeutet hatte, wie Tapan Sen, Generalsekretär der indischen Gewerkschaftsverbands CITU, berichtet. Während es ehemals keine Handelsbeziehungen zu Israel gab, habe die derzeitige indische Regierung einen anderen Kurs eingeschlagen. Indien sei einer der größten Abnehmer von Waffen und Überwachungssystemen, die von Israel hergestellt werden.
Fehlende Perspektiven in Indien
Einen “moralisch verwerflichen Doppelstandard” nennt der GewerkschafterTapan Sen das. Indien schicke seine Arbeiter bereitwillig nach Israel, schütze sie dann aber vor Ort aber nicht ausreichend – wie im Fall von Nibin Maxwell.
Die Arbeiter aus Indien kommen trotzdem. Denn vielen fehlt im Heimatland die Perspektive. Obwohl Indien heute so stark und schnell wie kein anderes Land der Erde wächst, sei das keine Erfolgsgeschichte der breiten Masse, sagt Usman Jawed von der Nichtregierungsorganisation FairSquare. Er spricht von “jobless Growth”, einem Wachstum ohne Arbeitsplätze. Es gebe zu wenig Jobs, und die Arbeitsbedingungen und Gehälter seien schlecht.
Die Situation der indischen Billiglöhner
Eine Lebenswirklichkeit, die auch Nibin und Nivin Maxwell teilten. Auf der Suche nach Arbeit versuchten sie es zunächst in Indien, dann in den Golfstaaten und sogar in Großbritannien.
Jedes Mal gaben sie privaten Agenturen Geld für die Vermittlung, nahmen Kredite auf, die sie nur schwer abbezahlen konnten. Bis sich mit Israel eine lukrative Möglichkeit auftat, über 1.500 Dollar im Monat lockten. “Hindus only” stand in einer Anzeige: Nur Hindus wurden gesucht, keine Muslime. Die Maxwells sind Christen, auch sie durften kommen.
Auf der Suche nach einem neuen Job
Obwohl das Arbeiten in Israel seinem Bruder Nibin das Leben gekostet hat, ist Nivin inzwischen wieder dort, auf der Suche nach einem neuen Job. Er hat zu Hause in Indien zwei Kinder. Sie wachsen ohne ihn auf. Auch sein Bruder wäre zum zweiten Mal Vater geworden. Den Flug zurück kann sich Nivin momentan nicht leisten.

Ein Arbeitsangebot auf einer Farm in der Nähe des Gazastreifens hat er nach dem Tod seines Bruders abgelehnt - zu gefährlich. Und bei seinem letzten Job auf einer Farm im Zentrum von Israel habe er nicht den vereinbarten Lohn bekommen, sagt er.
Weniger als der Mindestlohn
Assia Ladizhinskaya von der israelischen NGO Kav LaOved kennt Beschwerden wie diese. Oft würden Arbeiter dazu gezwungen, sechs Tage in der Woche zu arbeiten, manchmal sogar sieben, kritisiert sie: „Und wenn man dann die Stunden berechnet, bekommen sie nicht den Mindestlohn, den sie eigentlich kriegen sollten.“
Die schlechten Arbeitsbedingungen seien ein grundsätzliches Problem in der Landwirtschaft, berichtet Ladizhinskaya. Beschwerden darüber habe es auch oft von den palästinensischen Arbeitern gegeben.
Sophie von der Tann, Annette Kammerer, ikl