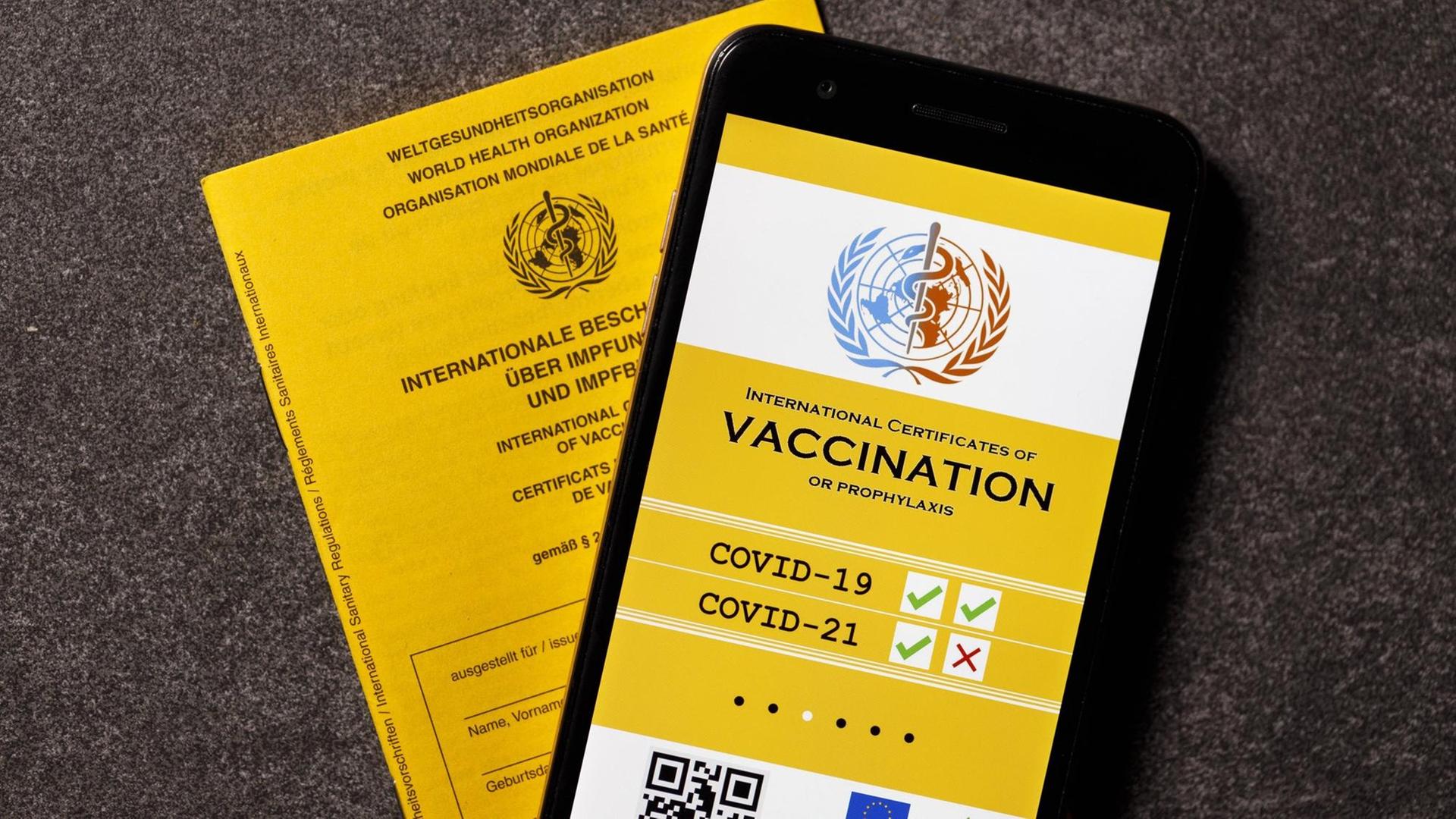Welche seelischen Auswirkungen haben die wiederkehrenden Lockdowns auf die Menschen? Darüber hat Benedikt Schulz mit Frank-Gerald Pajonk gesprochen. Pajonk ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, ehemaliger Benediktinermönch und nach wie vor aktiver Diakon und Seelsorger. Damit ist er eine Art Grenzgänger zwischen Psychologie und Religion, zwischen Therapie und Seelsorge. Er beobachte, dass Menschen zunehmend in eine „resignierte Selbstisolation“ abrutschen.
Benedikt Schulz: Wie hat sich das Leben Ihrer Patientinnen und Patienten nach gut einem Jahr Pandemie verändert?
Frank-Gerald Pajonk: Das Thema Pandemie beschäftigt die meisten Patienten wirklich substanziell. Wir haben im Laufe des vergangenen Jahres einen wahren Ansturm von Patienten gehabt. Und das größte und wichtigste Thema ist immer: die Unsicherheit. Wie geht es weiter mit mir persönlich? Mit mir im Beruf? Was geschieht mit mir? Was wird demnächst wieder beschlossen?
Die Unsicherheit prägt ganz maßgeblich die Gespräche und auch die Therapie. Und ich muss auch ganz klar sagen: Diese Unsicherheit verzögert in vielen Fällen einen therapeutischen Fortschritt.
„Das Wesentliche ist die Unsicherheit“
Schulz: Weil man nicht im normalen Modus zu Ihnen in die therapeutische Praxis kommen kann?
Pajonk: Nein, wir haben hier eine Akutpraxis für Psychiatrie und Psychotherapie. Das heißt: Unsere Türen sind offen – auch während eines Lockdowns. Aber es gibt einfach sehr, sehr viel mehr Patienten, die ganz konkrete Alltagssorgen wegen der Pandemie haben.

Schulz: Was sind das für Sorgen? Worüber konkret reden die Menschen, die da zu Ihnen kommen? Was geht in denen vor?
Pajonk: Das Wesentliche ist tatsächlich die Unsicherheit, die Ahnungslosigkeit, die fehlende Führung, die Sorge und auch der Ärger, dass Politiker oder andere, die in diesem Zusammenhang etwas zu sagen haben, keine Verantwortung übernehmen, und unsere Patienten sich selbst dem völlig hilflos, machtlos und wirkungslos ausgeliefert fühlen.
„Permanentes Hin und Her“
Schulz: Was heißt machtlos? Fällt es den Menschen schwer, sich an veränderte Umstände anzupassen? Menschen können sich ja anpassen an veränderte Umstände, aber nicht andauernd, oder?
Pajonk: Das ist genau der Punkt. Die Anpassungsfähigkeit der Menschen ist ganz wunderbar, aber ein permanentes Hin und Her – gibt es nun bundeseinheitliche Regeln oder länderspezifische Regeln oder Regeln auf Ebene des Landkreises? – ermüdet und frustriert sehr. Und das jetzt zum dritten Mal hin und her. Und überhaupt die Frage: Lockdown light, Lockdown hart, Brücken-Lockdown? Testen wann, wie? Das sind alles Fragen, die die Menschen zentral beschäftigen, weil davon ja deren Alltagsleben ganz wesentlich abhängt.
Schulz: Von welchen Sorgen konkret im Alltag berichten Ihnen die Menschen?
Pajonk: Da gibt es sicherlich bei manchen Menschen, die jetzt nicht mehr arbeiten können, die Sorge um die finanzielle Zukunft. Viel häufiger bei uns in der Praxis sind aber Menschen, die ihren Alltag nicht mehr bewältigen können, weil zu viele neue Aufgaben gleichzeitig auf sie einprasseln. Zum Beispiel, wenn die Kinder noch zur Schule gehen, die Schule mal zugemacht wird, dann mal wieder aufgemacht wird. Das bedeutet, dass sie ihre Abläufe im Alltag ständig neu anpassen müssen. Und ganz grundsätzlich bei vielen Menschen mit Depressionen und Ängsten: die Ahnungslosigkeit, was die Zukunft bringt und wie lange dieser Zustand des Nichtwissens und des Nicht-Planen-Könnens noch andauert.
„Eine resignierte Selbstisolation“
Schulz: Sie haben vor einem Jahr von einer Mischung aus Überforderung und Unterforderung gesprochen. Und im Prinzip, so höre ich das jetzt bei Ihnen raus, kann man das ja immer noch attestieren, oder?
Pajonk: Genau. Wobei im Moment die Überforderung im Vordergrund steht. Viele Menschen haben in den letzten Wochen doch zunehmend begonnen, zu resignieren und sich zurückzuziehen. Während wir vor einem Jahr noch Gemeinschaftsaktionen hatten, die einen positiven Geist verstärkt haben, so hat das doch eher nachgelassen. Die Menschen gehen immer mehr in eine resignierte Selbstisolation, schauen vielmehr darauf, wie sie alleine durchkommen. Die Gegner der Maßnahmen, die verbinden sich noch und demonstrieren. Die Befürworter der Maßnahmen sind doch zunehmend vereinzelt und schauen, wie sie irgendwie für sich durchkommen.
„Fragen, die den Menschen Angst machen“
Schulz: Ja, Sie haben es jetzt gerade gesagt: Vor einem Jahr gab es kollektive Rituale, die die Gesellschaft erfunden hat, möchte ich fast sagen: Man hat einmal am Abend applaudiert von den Balkonen – nicht alle, aber viele. Auch eine Möglichkeit, dem Thema Gemeinschaft Ausdruck zu verleihen. Und das ist jetzt alles weg. So eine Art kollektive Lethargie macht sich da breit, oder?
Pajonk: Das ist richtig, eben verbunden mit der Ratlosigkeit, wie lange diese Ausnahmesituation jetzt noch dauern soll. Und das nimmt natürlich ganz gewaltig den Antrieb, durchhalten zu wollen, auch gemeinschaftlich durchhalten zu wollen. Auch in vielen Familien ist das so. Doch gibt es ganz eindeutig auch das Phänomen, dass durch viele Gespräche oder auch Gespräche mit Freunden Mut weitergegeben wird. Und das ist tatsächlich viel nötiger als noch vor einem Jahr, als wir geglaubt haben, wir werden die Pandemie doch innerhalb eines Jahres im Großen und Ganzen durchstehen können.
Und jetzt haben wir eben die Sorge: Was wird passieren? Wie schnell werden wir geimpft werden können? Wird es neue Mutationen geben? Wird es neue Wellen geben – auch aufgrund der neuen Mutationen? Wirken die Impfstoffe dagegen? Es gibt also sehr viele neue Fragen und unbeantwortete Fragen, die den Menschen Angst machen.
„Dann glaubt man den Durchsagen nicht mehr“
Schulz: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Taktung zwischen Hoffnungsbotschaften und Hiobsbotschaften extrem schnell geworden ist. Es gibt ja immer wieder Signale der Hoffnung. Wir sind ja in die Weihnachtsferien gegangen im Wissen: Das Impfen geht bald los. Und jetzt, gut drei Monate später, stecken wir schon mitten in der dritten Welle. Es gibt jeden Tag bedrohlich klingende Zahlen über Neuinfektionen, Todesfälle, Intensivkapazitäten. Wie sehr ermüdet uns dieses Hin und Her zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit?

Pajonk: Das ist tatsächlich ein ganz ausgeprägter Faktor. Und da will ich auch nicht verhehlen, dass ich mit der Kommunikation sicher nicht einverstanden bin. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Bahnsteig und warten auf einen Zug, der um 13 Uhr kommen soll. Der Zug kommt nicht. Sie warten auf eine Nachricht, werden immer ungeduldiger. Dann kommt die Nachricht, der Zug kommt 15 Minuten verspätet. Sie haben wieder Hoffnung. Um 13:15 Uhr kommt der Zug immer noch nicht. Sie warten erneut 20 Minuten und erfahren, dass der Zug um 13:45 Uhr kommt. Um 13:45 Uhr kommt der Zug immer noch nicht. Und es gibt wieder keine Nachricht. Jeder, der Bahn fährt und das schon einmal erlebt hat, weiß, wie frustrierend und ermüdend das ist. Und irgendwann glaubt man den Durchsagen einfach auch nicht mehr.
„Hilflosigkeit und Ohnmacht“
Schulz: Wenn Sie jetzt einen Zustand beschreiben, dass man eine Dreiviertelstunde auf einen Zug wartet, der nicht kommt. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn ein solcher Zustand über zwölf Monate lang anhält? Jetzt mal aus Sicht des Psychotherapeuten – wie fühlt sich das an?
Pajonk: Na ja, es führt letztendlich zu Hilflosigkeit und Ohnmacht. Hilflosigkeit und Ohnmacht sind extrem starke Emotionen – mit die stärksten und am meisten belastenden, die wir Menschen empfinden können. Das mündet dann – je nach Persönlichkeit und Zustand des Betroffenen – entweder in ausgeprägtem Ärger oder eben in einer eher depressiven Grundverfassung.
„Seit einem Jahr das Haus nicht mehr verlassen“
Schulz: Welche Rolle spielt denn eigentlich Angst? Haben die Menschen auch Angst, die zu Ihnen in Ihre Praxis kommen? Angst vor dieser Krankheit, vor Infektionen, aber auch Angst vor der Isolation?
Pajonk: Das ist sehr unterschiedlich, sehr heterogen. Ich habe einige Patienten in der Praxis, die seit dem ersten Lockdown vor einem Jahr das Haus nicht mehr verlassen haben. Das sind Menschen, die zuvor schon eine ausgeprägte Angst- oder Zwangsstörung hatten und die sich so sehr vor diesem Virus fürchten, dass sie auch bereit sind, andere gesundheitliche Nachteile in Kauf zu nehmen, dass sie zum Beispiel nicht mehr zum Zahnarzt zu gehen, obwohl das dringend notwendig wäre, oder dass dringend notwendige Herzuntersuchungen unterbleiben.
Es gibt die anderen, die resignieren, weil sie das Gefühl haben, es wird kein Zurück zur Normalität mehr geben. Das Leben, das sie geführt haben, wird vorbei sein und wird so auch nicht mehr wiederkommen. Diese Menschen haben aber auch keine Vorstellung davon, wie ein anderes neues Leben, eine andere neue Normalität aussehen kann. Es gibt aber auch andere Menschen, vor allem mit Depressionen, die sogar erleichtert sind, weil sie sich dem Druck der Öffentlichkeit nicht mehr aussetzen müssen – dem Druck, funktionieren zu müssen. Die fühlen sich jetzt in dieser eher ruhigen oder stilleren Atmosphäre sehr wohl. Und es gibt auch Menschen, die überhaupt keine Furcht vor dieser Erkrankung haben, sondern tatsächlich ganz gelassen da durchgehen, die aber ganz andere Fragen ihres Alltags beschäftigen.
„Angst vor der Angst“
Schulz: Sie haben gerade auch das Thema Angststörungen, Zwangsstörungen angesprochen. Wann wird denn aus der Angst für viele Menschen auch so eine Art Gewöhnung? Es kann ja sein, dass Angst ein aktiver Begleiter des Alltags wird. Droht das vielen Menschen derzeit, dass eben diese Pandemie oder auch die Isolation in diversen Lockdowns zu einer Angststörung führt?
Pajonk: Das ist ganz sicher der Fall. Wir sehen bei bestimmten Gruppen von Menschen ja jetzt schon ein dramatisches Ansteigen von psychischen Erkrankungen, zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen, die mit Essstörungen reagieren. Wir haben deutlich mehr Aufenthalte von Kindern und Jugendlichen in psychiatrischen Kliniken im letzten Jahr – auch wegen Depressionen.
Und grundsätzlich imüssen wir uns die Frage stellen: Diese Dauerbesorgnis und -angst, die wir haben, setzt die sich fest? Das ist ja ein wesentlicher Faktor: Angst kann sich verbeißen, Menschen können eine Angst vor der Angst entwickeln. Das ist dann therapeutisch relativ schwer, dann zu beeinflussen oder viel schwieriger zu beeinflussen. Und ich glaube schon, dass wir von der Pandemie – aus Sicht der Psychiater und Therapeuten – noch sehr viel länger etwas haben werden, selbst wenn die akute Gefahr durch körperliche Erkrankungen durch das Virus schon geschwunden ist.
„Angst hängt den Menschen weiter in den Knochen“
Schulz: Also kann es sein, dass wir, wenn, wie Sie gesagt haben, die akute Gesundheitsgefahr durch diese Pandemie nicht mehr so gegeben ist, wie sie jetzt gegeben ist – oder auf gut Deutsch: wenn diese Pandemie irgendwann einmal ein Ende hat, dass wir trotzdem aus dieser Angstfalle nicht herauskommen oder dass Teile der Gesellschaft aus dieser Angstfalle nicht herauskommen können?
Pajonk: Genau. Ich glaube, das wird Teile der Gesellschaft betreffen. Es ist doch einerseits immer wieder bemerkenswert, wie sehr und wie schnell sich Menschen auch erholen können. Es wird aber sicherlich einige geben, die das eben nicht so schnell schaffen. Wenn man schaut, wie es derzeit in Israel zugeht, dass dort die Clubs und Bars und Restaurants mittlerweile aufhaben. Ich habe über Ostern mit einem Freund gesprochen, der sagte: Es war wieder das ganz normale Leben. Wie vor der Pandemie. Es erscheint zumindest, als gäbe es eine Normalität, die relativ rasch zurückgekehrt ist.

Aber selbst in Israel drehen sich die Gespräche immer noch darum: Was passiert, wenn es wiederkommt? Sind wir alle gesund geblieben? Sind Menschen aus der Familie gestorben? Das heißt, selbst im Rückblick auf ein vergangenes Geschehen hängt die Angst vor einer Rückkehr der Probleme den meisten Menschen doch noch sehr in den Knochen.
„Persönliche Schlupflöcher sind verschlossen“
Schulz: Was wir uns ja alle wünschen, ist so eine Unbeschwertheit, die man gerne wieder hätte. Aktuell ist aus guten Gründen Unbeschwertheit im Umgang mit dem Virus ja verpönt, also aus vernünftigen Gründen verpönt. Wie kommen wir denn irgendwann mal wieder zu einer Unbeschwertheit im Alltag?
Pajonk: Die äußeren Umstände und epidemiologischen Daten sprechen zurzeit ganz klar dagegen. Wir haben weiterhin Unsicherheit, wie die nächsten sechs Monate weitergehen werden, und daher wird sich auch kaum eine Unbeschwertheit einstellen können. Wir haben weiterhin die Situation, dass unsere persönlichen Schlupflöcher alle verschlossen sind. Wir können eben nicht einfach so mehr Sport treiben, ins Fitnessstudio gehen, nicht ins Kino gehen, nicht so ohne Weiteres in den Urlaub fahren. Und wenn man es doch tut, wird man schräg angesehen.
Diese persönlichen Schlupflöcher, aus denen wir einen Großteil unserer Unbeschwertheit ziehen können, die sind für die meisten Menschen weitgehend verschlossen. Das, was dann übrigbleibt, ist zu schauen, ob man die Unbeschwertheit in sich persönlich entdeckt.
Schulz: Und wie geht das?
Pajonk: Es geht, glaube ich, dabei ganz wesentlich um eine innere Haltung, die darauf beruht, sich ständig überraschen zu lassen. Und wenn wir in eine Haltung kommen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir aktiv das auswählen, was möglich ist, dass wir uns gegenseitig bestärken, mit Freunden im Kontakt bleiben, Gemeinschaft auf andere Weise aufbauen, dann kann auch wieder Hoffnung, Zuversicht und Unbeschwertheit entstehen.
„Generation ohne Vorbilder“
Schulz: Es gibt ja eine Gruppe von Menschen, denen ist das Staunen, sag ich jetzt mal vorsichtig, näher als den Erwachsenen, nämlich eben den Kindern. Lassen Sie uns auch mal kurz über Kinder reden, Sie haben die gerade schon angesprochen. Ich habe vor Kurzem gelesen, es drohe derzeit eine Generation Nichtschwimmer heranzuwachsen. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was die derzeit heranwachsende Generation belastet. Die Entwicklung von Seele, von Gemeinschaft findet ja eben in Gemeinschaft statt. Droht uns da eine Generation seelischer Nichtschwimmer in der Zukunft?
Pajonk: Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Aber es gibt für diese Generation ja zurzeit überhaupt gar keine Vorbilder. Die Kinder und Jugendlichen müssen sich selbst suchen, wo und wie sie Gemeinschaft erleben. Sie müssen auch mit immer neuen Abbrüchen von Gemeinschaft leben. Zum Beispiel, wenn die Schule oder die Kita wieder schließt. Es wird sicherlich noch eine große Herausforderung, dieses Zutrauen in Gemeinschaft wiederaufzubauen.
Achtsamkeit als „seelische Impfung“
Schulz: Ich habe es am Anfang erwähnt: Sie sind ehemaliger Benediktinermönch, Sie sind Seelsorger. Wie hilft denn Religion, sich dieses Staunen, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, diese Fähigkeit, sich überraschen zu lassen, wie hilft Religion, sich so etwas aufzubauen, sich so etwas zu bewahren und auch langfristig zu bewahren?
Pajonk: Die gemeinschaftliche Religionsausübung bedeutet auch, wieder Gemeinschaft zu leben. Bei uns in der Klosterkirche, da berichten viele Menschen, wie unglaublich wichtig für sie der Sonntagsgottesdienst in den letzten Monaten geworden ist, weil sie dort eben vertraute Gesichter sehen, vertraute Botschaften hören. Und das gibt Ihnen Kraft für die gesamte Woche.
Es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, und in der Praxis empfehle ich dies in den letzten Monaten immer häufiger, sich mit Meditation zu beschäftigen. Das wird aktuell von viel mehr Patienten dankbar an- und wahrgenommen als in den Jahren zuvor. Bei Meditation geht es ja im Wesentlichen darum, in eine Art von Achtsamkeit und Wahrnehmung mit sich selbst zu kommen. Und das ganz Wunderbare ist zu akzeptieren, nicht in dieser Achtsamkeit und Wahrnehmung bei sich selbst bleiben zu können, sondern zu lernen, immer wieder dorthin zurückzukehren, nachdem man abgeschweift ist. Ich bin überzeugt, dass das eine zentrale Fähigkeit ist, die aktuell in der Pandemie – mit weiter unklarer zeitlicher Perspektive – ganz besonders vonnöten ist und hilfreich ist.
Schulz: So eine Art seelische Impfung?
Pajonk: Eine Art seelische Impfung, wenn Sie wollen, ja. Immer wieder wiederholt, täglich neu.
„Neue Formen von Zusammenleben“
Schulz: Die meisten Vertreterinnen und Vertreter von Religionsgemeinschaften weltweit haben sich ja eher rational angesichts dieser Pandemie verhalten. Allerdings, das ist mein Eindruck, haben sich viele Religionsgemeinschaften verständlicherweise wohl auch irgendwie schwergetan, eine Deutung anzubieten für dieses Jahrhundertereignis. Wie ist Ihr Eindruck?
Pajonk: Das ist eine schwierige Frage. Beziehungsweise: Darauf habe ich auch keine pragmatische Antwort. Ich würde ganz ungern das Pandemiegeschehen vor dem Hintergrund eines göttlichen Eingreifens beurteilen, das als Strafe oder Schuld für eine sündige Menschheit verstanden wird. Ich glaube, wir werden die Pandemie genauso annehmen müssen, wie sie ist. Sie wird unsere Gesellschaft verändern; und das Leben aus dem Glauben kann uns auch dabei helfen, neue Formen von Zusammenleben zu entwickeln, die für diese Situation gut passen.
Schulz: Wäre das denn eine Aufgabe von Religionsgemeinschaft, so eine Deutung anzubieten? Also die Pandemie eben jetzt nicht als göttliches Zeichen, sondern als Herausforderung für Solidarität in der Gesellschaft?
Pajonk: So würde ich das verstehen.
„Wir werden weiterleben“
Schulz: Ich bin heute früh in einem Plakat vorbeigefahren an einer Kirche, da stand zu lesen: Tod, wo ist dein Sieg? Das bezieht sich natürlich jetzt auf die Botschaft des christlichen Osterfests. Aber natürlich, man liest es auch im Kontext von Covid 19. Helfen solche Hoffnungsbotschaften im Jahr 2021 eben angesichts dieser grassierenden Unsicherheit gegenüber der Pandemie?
Pajonk: Tatsächlich hilft es vielen Menschen, zu wissen, dass das Ganze nicht zu Ende ist. Ein Satz, der dem Dichter Robert Frost zugeschrieben wird, hat mich über das ganze letzte Jahr ganz wesentlich begleitet: „Es gibt drei Wörter, die alles zusammenfassen, was ich über das Leben weiß: Es geht weiter.“ Das Weitergehen kann man sicherlich unter dem Aspekt der Trauer betrachten, nämlich dass das Leben weitergeht und wir manches verlieren oder zurücklassen müssen. Man kann es aber auch als Zeichen der Hoffnung deuten, dass wir auf jeden Fall weiterleben und dafür auch einen guten Weg finden werden. Und davon bin ich zutiefst überzeugt: Das ist die christliche Botschaft, und auch die Botschaft von Ostern.
„Vieles haben wir gut geschafft“
Schulz: Ich habe mich mal zu Beginn der Pandemie gefragt, also tatsächlich offen gefragt: Wird unsere Gesellschaft – und nicht nur unsere Gesellschaft – aus dieser Krise gestärkt hervorgehen, weil sie sich eben miteinander solidarisch gezeigt hat, weil man auf Mitmenschen geachtet hat? Oder gehen wir an Wunden verletzt aus dieser Zeit heraus? Was glauben Sie?
Pajonk: Wahrscheinlich sowohl als auch. Je nachdem, in welcher Lebenssituation sich der einzelne Mensch befindet. Möglicherweise sogar beides gleichzeitig. Wir werden mit Sicherheit zurückblicken und feststellen, dass wir Menschen verloren haben oder dass Menschen krank geworden sind, die über lange Zeit nicht wieder gesund geworden sind oder ihr altes Leistungsniveau zurückerlangt haben. Wir werden feststellen, dass manche Menschen ökonomisch unglaublich viel verloren haben oder sozial gravierende Rückschläge einstecken mussten.
Ich glaube aber auch, dass wir vielleicht in zwei, drei Jahren – denn ich glaube wirklich, uns werden die Pandemie und ihre Folgen noch länger begleiten – erleichtert darauf schauen können, dass wir am Ende vieles doch gut geschafft haben, durch eine schwere Zeit hindurchgegangen sind mit dem Ausblick, dass es wieder gut, aber anders gut wird.
Risse durch Familien
Schulz: Das Ganze wird ja auch Auswirkungen haben aufs eigene Selbstbild, ob man jetzt eben mit Stolz oder zumindest ohne sich zu schämen auf diese Pandemie zurückblicken kann. Was denken Sie, was wird für die meisten Menschen übrigbleiben? Ich meine, Egoismus spielt in diesen Tagen ja auch eine Rolle.
Pajonk: Es wird schon mitunter eine scharfe Trennlinie zwischen Menschen geben. Es wird diejenigen geben, die am Ende versöhnt und zufrieden darauf schauen, wie sie, ihre Familie, Bekannten und Nachbarn oder die Gesellschaft das geschafft haben. Es wird allerdings auch diejenigen geben, die sich abwenden, die Hoffnung auf ein faires Gemeinwesen aufgeben, sich isolieren, sehr verstärkt auf ihre eigenen Bedürfnisse schauen und eben egoistischer reagieren. Bei wem und wo die Grenze verläuft, ist beim einzelnen Menschen nicht vorherzusehen.
Was ich als Erfahrung hier aus der Praxis mitnehme: Diese Trennlinie besteht bereits jetzt und geht quer durch Familien. Ich habe hier ein Mitglied einer Familie in Behandlung, die Eltern haben drei erwachsene Söhne. Während die Eltern besorgt wegen der Corona-Pandemie sind und sich zurückziehen, sind zwei Söhne strikte Corona-Leugner. Der dritte Sohn ist auf Seiten der Eltern. Ich erfahre in der Therapie sehr deutlich, dass innerhalb der Familie kaum noch eine Verständigung zwischen einzelnen Personen und den beiden Fraktionen möglich ist und dass wirklich bereits eine Trennung, eine Absonderung und eine Ausgrenzung von Menschen und Meinungen eingetreten ist.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.