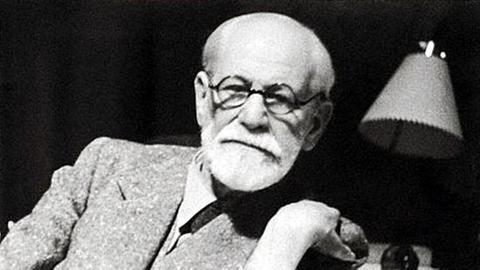Viele der neuerdings so zahlreich erscheinenden Lebenserinnerungen funktionieren nach dem bewährten Muster "Phönix aus der Asche" - wie aus dem Opfer ein Sieger wurde. Den Siegern, gerade wenn sie sich unter Qualen nach oben gearbeitet haben, gilt die Bewunderung der meisten.
John Burnsides Autobiographie "Lügen über meinen Vater" bedient dieses Muster mit keinem Wort. Er schreibt über die Hölle seiner Kindheit, seiner Jugend, aber er vergisst nicht, den Duft des Kuchens in der Küche auszumalen, den rot aufflammenden Blättern im herbstlichen Wald eine halbe Seite zu widmen und den von ihm als sakral empfundenen Trips mit LSD, mit Morphium, mit Ecstasy, mit Pillen und Alkohol fast das gesamte letzte Drittel des Buches.
"Lügen über meinen Vater" ist keine Abrechnung, sondern eine Art präziser Erinnerungsfantasie. Klingt paradox: Wie kann eine Fantasie präzise sein? Aber für John Burnside war seine Imagination fast der einzig mögliche Raum, in dem er erkunden konnte, was in seinen Eltern, besonders in seinem Vater wohl vorgegangen sein mochte. Als er soff, brüllte und dem drei-, dem fünf-, dem siebenjährigen Sohn immer wieder eindringlich erklärte: Besser, er wäre tot! Das ist die Schlüsselszene der Kindheit von John Burnside.
Und präzise ist Burnsides Phantasie deshalb, weil der Autor sich nicht schont, seine hilflose Sehnsucht ebenso klar benennt wie die Spurenelemente von Väterlichkeit in dem "breitschultrigen Kerl, eins achtzig groß, stark, skrupellos", dessen Stimme immer ein "Vorbote von Schmerz und Entsetzen" war.
Sieben Jahre nach dem Tod des Vaters, John Burnside ist inzwischen 33, befragt er eine Tante nach dessen Familie:
"Die Hauptgeschichte des Buches, wie ich herausbekam, dass mein Vater ein Findelkind war, war eine gute Geschichte für mich. Sie bot mir ein wenig Erklärung dafür, warum er so war wie er war. Es ist abgefahren zu sagen, dass es einen Sohn glücklich macht herauszufinden, dass sein Vater ein Findelkind war. Für mich war das eine gute Nachricht, als ich das von meiner Tante erfuhr. Ich hatte das Gefühl, die gute Seite an ihm entdeckt zu haben."
1926, in Schottlands Industrierevieren herrscht Massenarbeitslosigkeit, wird George McGee auf den Treppenstufen eines Arbeiterhauses ausgesetzt. Dort behält man ihn für ein paar Wochen, und reicht ihn an die nächste Familie weiter. "Ein Niemand aus Nirgendwo" nennt John Burnside seinen Vater und erklärt, dass eine solche Kindheit Verlassenheitsgefühle in besonders vernichtender Ausprägung nach sich ziehen muss. Das Buch ist der Versuch des Autors, sich begreiflich zu machen, warum der Vater auf der Suche nach Halt zum Alkohol greift. Und warum er auf der Suche nach einer Geschichte zum Lügner wird. George McGee, dies ist einer von mehreren Namen, die der Vater sich gibt, stilisiert sich zum Adoptivkind einer Unternehmerfamilie, zum Fußballprofi, zum Helden der britischen Armee, dabei war er sein Leben lang Gelegenheitsarbeiter und Quartalssäufer. John Burnside:
"Jede Lüge ist ein Hinweis auf die Wahrheit. Eine wirklich gute Lüge erzählt immer auch einige Wahrheiten zusammen mit den Lügen. Das stiftet Verwirrung beim Zuhörer. Denn man weiß nie, wann sagt er die Wahrheit, wann lügt er. Damit hat er mehr Macht über den Zuhörer als einer, der immer nur die Wahrheit sagt oder immer nur lügt. Und der Zuhörer bleibt misstrauisch und verwirrt zurück."
Es ist verwirrend, aber auch anrührend zu lesen, mit welcher Hingabe und Energie sich der ungeliebte Sohn an die posthume Rückeroberung des Vaters macht. Jetzt wo der sich nicht mehr wehren kann, Vater zu sein. Jetzt entdeckt Burnside, dass der Vater mit seinen Lügengeschichten wohl eine schmerzhafte Lücke schließen wollte. "Er brauchte eine Geschichte, brauchte ein Ich-Gefühl.", heißt es in dem Buch. Und der Sohn entdeckt, dass der Vater mit seiner Legendenproduktion immerhin auch eine gewisse Vorstellungskraft unter Beweis stellt. Burnside sammelt die winzigen positives Teilchen, die das große schwarze Loch des väterlichen Grauens für ihn hergibt. Und die schier übermenschliche Anstrengung dahinter ist spürbar. Letztlich sind es nur Deutungen, die Trost spenden sollen. Deshalb der Titel "Lügen über meinen Vater".
John Burnside fing an, nach solchen Ursachen für Trost zu fahnden als für ihn absehbar war, dass er Probleme bekommen würde mit seiner eigenen Vaterschaft, wenn er es nicht schafft, mit seiner Vergangenheit Frieden zu schließen.
"Ein wichtiger Grund wieso mir das erst mal gelang, sind meine Kinder. Vielleicht bin ich stabiler geworden, weil es sie gibt. Sie sind zehn und sechs."
John Burnside hat inzwischen 14 Gedichtbände vorgelegt und sieben Romane, davon sind bislang erst zwei ins Deutsche übersetzt worden - "Glister" und "Die Spur des Teufels". Er ist Professor für Creative Writing an der schottischen St. Andrews Universität, sein Spezialthema ist Umweltschutz und Literatur. Also hat er durchaus eine Phönix-aus-der-Asche-Karriere hingelegt. Er würde ins Heldenschema "Erst Opfer dann Sieger" passen. Aber der 56-Jährige winkt ab:
Eine ganze Zeit lang - mehr als zehn Jahre - sah es so aus, als wollte John Burnside den Wunsch seines Vaters an sich selbst vollstrecken und aus dem Leben verschwinden. Nach exzessivem Drogengebrauch kam er mehrfach in die Psychiatrie mit der Diagnose "Borderline Störung und Suizidgefährdung".
"Wenn Sie solche Geisteszustände schon einmal erlebt haben, dann warten Sie darauf ... dann achten Sie darauf, ob Ihr Leben nicht möglicherweise wieder schief läuft. Ich glaube, dann ist man nie so ganz und gar über'm Berg."
Burnside erkennt, dass der Vater sich in seinem Kopf eingenistet hat. In "Lügen über meinen Vater" heißt es: Er war mir "überall hin gefolgt, ein glühender Funke Selbsthass im Innersten meiner Seele, sengend heiß und unauslöschlich." Die autobiografische Arbeit Burnsides mag dazu gedient haben, diesen Selbsthass des Vaters quasi an ihn zurückzugeben, dort wo er hingehört, um aus der Einflusszone seiner toxischen Ausstrahlung zu entkommen. Der Autor nennt noch einen anderen Grund:
"Als ich das Buch schrieb, war es wichtig für mich herauszufinden, dass mein Schicksal nicht einmalig ist. Saufende Väter, die ihre Kinder vernachlässigen, verprügeln, missbrauchen - da wo ich herkomme, aus der schottischen Arbeiterklasse, war das zwar nicht die Regel, aber selten war es auch nicht gerade."
Das Kind John Burnside versucht immer wieder aus seiner Familie zu verschwinden, erst taucht er in Bücherwelten ab, dann in die Wälder hinter der Stadt, mit 17 der erste LSD-Trip. Seine Theorie, auch heute noch:
"Um jemand Neues zu werden, muss man erst einmal verschwinden. In eine Art Vorhölle vielleicht. Und dann kann man wieder auftauchen. Es ist wie mit Raupe und Schmetterling. Die Raupe verschwindet, damit der Schmetterling hervorkommen kann."
"Lügen über meinen Vater" von John Burnside ist die überaus wahrhaftige Geschichte eines Sohnes, der sich seinen Vater posthum zusammenreimen muss. Die Leerstelle muss gefüllt werden, denn wo kein Vater, da auch kein Sohn. "Lügen über meinen Vater" ist eine Mischung aus Autobiographie und Horrorroman, markerschütternd gut geschrieben.
"Ich glaube, Sprache schafft einen Sinn für Ordnung, auch wenn es um die schlimmsten Dinge geht. Sprache rückt die Dinge an ihren Platz. So kann die Diagnose des Horrors beginnen, wenn Sie so wollen, mit dem Ziel, ihn begreiflich zu machen."
John Burnside: "Lügen über meinen Vater"
Knaus Verlag, 384 Seiten, 19,99 Euro
John Burnsides Autobiographie "Lügen über meinen Vater" bedient dieses Muster mit keinem Wort. Er schreibt über die Hölle seiner Kindheit, seiner Jugend, aber er vergisst nicht, den Duft des Kuchens in der Küche auszumalen, den rot aufflammenden Blättern im herbstlichen Wald eine halbe Seite zu widmen und den von ihm als sakral empfundenen Trips mit LSD, mit Morphium, mit Ecstasy, mit Pillen und Alkohol fast das gesamte letzte Drittel des Buches.
"Lügen über meinen Vater" ist keine Abrechnung, sondern eine Art präziser Erinnerungsfantasie. Klingt paradox: Wie kann eine Fantasie präzise sein? Aber für John Burnside war seine Imagination fast der einzig mögliche Raum, in dem er erkunden konnte, was in seinen Eltern, besonders in seinem Vater wohl vorgegangen sein mochte. Als er soff, brüllte und dem drei-, dem fünf-, dem siebenjährigen Sohn immer wieder eindringlich erklärte: Besser, er wäre tot! Das ist die Schlüsselszene der Kindheit von John Burnside.
Und präzise ist Burnsides Phantasie deshalb, weil der Autor sich nicht schont, seine hilflose Sehnsucht ebenso klar benennt wie die Spurenelemente von Väterlichkeit in dem "breitschultrigen Kerl, eins achtzig groß, stark, skrupellos", dessen Stimme immer ein "Vorbote von Schmerz und Entsetzen" war.
Sieben Jahre nach dem Tod des Vaters, John Burnside ist inzwischen 33, befragt er eine Tante nach dessen Familie:
"Die Hauptgeschichte des Buches, wie ich herausbekam, dass mein Vater ein Findelkind war, war eine gute Geschichte für mich. Sie bot mir ein wenig Erklärung dafür, warum er so war wie er war. Es ist abgefahren zu sagen, dass es einen Sohn glücklich macht herauszufinden, dass sein Vater ein Findelkind war. Für mich war das eine gute Nachricht, als ich das von meiner Tante erfuhr. Ich hatte das Gefühl, die gute Seite an ihm entdeckt zu haben."
1926, in Schottlands Industrierevieren herrscht Massenarbeitslosigkeit, wird George McGee auf den Treppenstufen eines Arbeiterhauses ausgesetzt. Dort behält man ihn für ein paar Wochen, und reicht ihn an die nächste Familie weiter. "Ein Niemand aus Nirgendwo" nennt John Burnside seinen Vater und erklärt, dass eine solche Kindheit Verlassenheitsgefühle in besonders vernichtender Ausprägung nach sich ziehen muss. Das Buch ist der Versuch des Autors, sich begreiflich zu machen, warum der Vater auf der Suche nach Halt zum Alkohol greift. Und warum er auf der Suche nach einer Geschichte zum Lügner wird. George McGee, dies ist einer von mehreren Namen, die der Vater sich gibt, stilisiert sich zum Adoptivkind einer Unternehmerfamilie, zum Fußballprofi, zum Helden der britischen Armee, dabei war er sein Leben lang Gelegenheitsarbeiter und Quartalssäufer. John Burnside:
"Jede Lüge ist ein Hinweis auf die Wahrheit. Eine wirklich gute Lüge erzählt immer auch einige Wahrheiten zusammen mit den Lügen. Das stiftet Verwirrung beim Zuhörer. Denn man weiß nie, wann sagt er die Wahrheit, wann lügt er. Damit hat er mehr Macht über den Zuhörer als einer, der immer nur die Wahrheit sagt oder immer nur lügt. Und der Zuhörer bleibt misstrauisch und verwirrt zurück."
Es ist verwirrend, aber auch anrührend zu lesen, mit welcher Hingabe und Energie sich der ungeliebte Sohn an die posthume Rückeroberung des Vaters macht. Jetzt wo der sich nicht mehr wehren kann, Vater zu sein. Jetzt entdeckt Burnside, dass der Vater mit seinen Lügengeschichten wohl eine schmerzhafte Lücke schließen wollte. "Er brauchte eine Geschichte, brauchte ein Ich-Gefühl.", heißt es in dem Buch. Und der Sohn entdeckt, dass der Vater mit seiner Legendenproduktion immerhin auch eine gewisse Vorstellungskraft unter Beweis stellt. Burnside sammelt die winzigen positives Teilchen, die das große schwarze Loch des väterlichen Grauens für ihn hergibt. Und die schier übermenschliche Anstrengung dahinter ist spürbar. Letztlich sind es nur Deutungen, die Trost spenden sollen. Deshalb der Titel "Lügen über meinen Vater".
John Burnside fing an, nach solchen Ursachen für Trost zu fahnden als für ihn absehbar war, dass er Probleme bekommen würde mit seiner eigenen Vaterschaft, wenn er es nicht schafft, mit seiner Vergangenheit Frieden zu schließen.
"Ein wichtiger Grund wieso mir das erst mal gelang, sind meine Kinder. Vielleicht bin ich stabiler geworden, weil es sie gibt. Sie sind zehn und sechs."
John Burnside hat inzwischen 14 Gedichtbände vorgelegt und sieben Romane, davon sind bislang erst zwei ins Deutsche übersetzt worden - "Glister" und "Die Spur des Teufels". Er ist Professor für Creative Writing an der schottischen St. Andrews Universität, sein Spezialthema ist Umweltschutz und Literatur. Also hat er durchaus eine Phönix-aus-der-Asche-Karriere hingelegt. Er würde ins Heldenschema "Erst Opfer dann Sieger" passen. Aber der 56-Jährige winkt ab:
Eine ganze Zeit lang - mehr als zehn Jahre - sah es so aus, als wollte John Burnside den Wunsch seines Vaters an sich selbst vollstrecken und aus dem Leben verschwinden. Nach exzessivem Drogengebrauch kam er mehrfach in die Psychiatrie mit der Diagnose "Borderline Störung und Suizidgefährdung".
"Wenn Sie solche Geisteszustände schon einmal erlebt haben, dann warten Sie darauf ... dann achten Sie darauf, ob Ihr Leben nicht möglicherweise wieder schief läuft. Ich glaube, dann ist man nie so ganz und gar über'm Berg."
Burnside erkennt, dass der Vater sich in seinem Kopf eingenistet hat. In "Lügen über meinen Vater" heißt es: Er war mir "überall hin gefolgt, ein glühender Funke Selbsthass im Innersten meiner Seele, sengend heiß und unauslöschlich." Die autobiografische Arbeit Burnsides mag dazu gedient haben, diesen Selbsthass des Vaters quasi an ihn zurückzugeben, dort wo er hingehört, um aus der Einflusszone seiner toxischen Ausstrahlung zu entkommen. Der Autor nennt noch einen anderen Grund:
"Als ich das Buch schrieb, war es wichtig für mich herauszufinden, dass mein Schicksal nicht einmalig ist. Saufende Väter, die ihre Kinder vernachlässigen, verprügeln, missbrauchen - da wo ich herkomme, aus der schottischen Arbeiterklasse, war das zwar nicht die Regel, aber selten war es auch nicht gerade."
Das Kind John Burnside versucht immer wieder aus seiner Familie zu verschwinden, erst taucht er in Bücherwelten ab, dann in die Wälder hinter der Stadt, mit 17 der erste LSD-Trip. Seine Theorie, auch heute noch:
"Um jemand Neues zu werden, muss man erst einmal verschwinden. In eine Art Vorhölle vielleicht. Und dann kann man wieder auftauchen. Es ist wie mit Raupe und Schmetterling. Die Raupe verschwindet, damit der Schmetterling hervorkommen kann."
"Lügen über meinen Vater" von John Burnside ist die überaus wahrhaftige Geschichte eines Sohnes, der sich seinen Vater posthum zusammenreimen muss. Die Leerstelle muss gefüllt werden, denn wo kein Vater, da auch kein Sohn. "Lügen über meinen Vater" ist eine Mischung aus Autobiographie und Horrorroman, markerschütternd gut geschrieben.
"Ich glaube, Sprache schafft einen Sinn für Ordnung, auch wenn es um die schlimmsten Dinge geht. Sprache rückt die Dinge an ihren Platz. So kann die Diagnose des Horrors beginnen, wenn Sie so wollen, mit dem Ziel, ihn begreiflich zu machen."
John Burnside: "Lügen über meinen Vater"
Knaus Verlag, 384 Seiten, 19,99 Euro