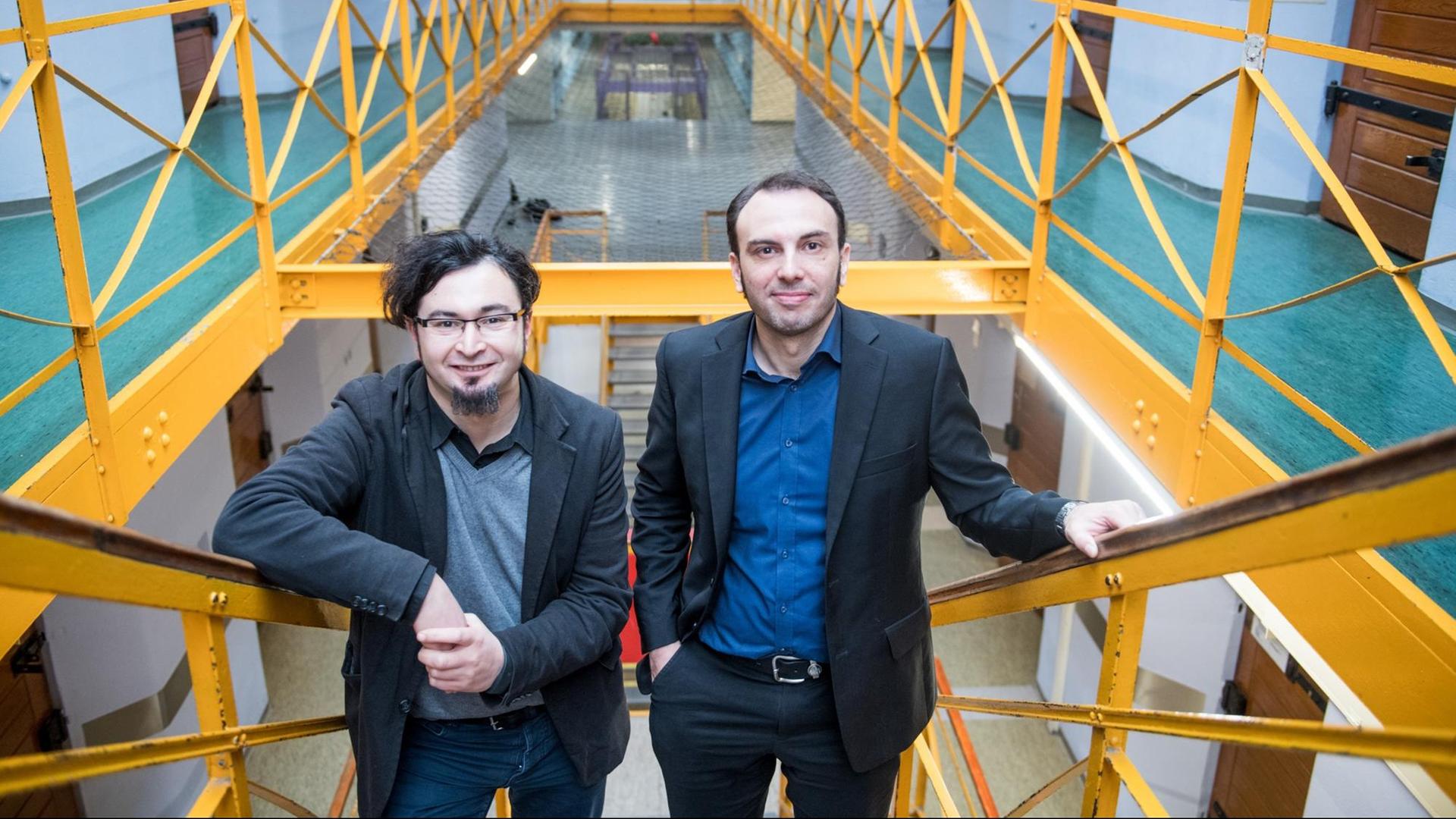Christiane Kaess: Sie erzeugen Angst und Misstrauen, denn sie könnten potenzielle Täter sein eines Mordes oder gleich eines großen Anschlags. In Sicherheitskreisen werden sie im Extremfall auch als Gefährder geführt, egal ob damit ein Islamist oder ein Rechtsextremist gemeint ist. Und die Reaktion auf die, die möglicherweise die Gesellschaft gefährden, ist überall auf der Welt meistens die gleiche, nämlich Härte. Es kann auch anders funktionieren, diese Menschen wieder auf einen normalen Weg zurückzubringen: mit Empathie. Diese Geschichten aber sind wenig bekannt, der Journalist und Autor Bastian Berbner ist ihnen nachgegangen, und zwar weit über die Geschichten von Radikalisierten hinaus, bis hin zu den ganz alltäglichen Vorurteilen. Und er findet nach seinen Recherchen, dass Empathie und das gegenseitige Zuhören ein Heilmittel für gespaltene Gesellschaften sein könnte gegen Konflikte, wie es sie auch hierzulande viele gibt und wie sie sich zum Beispiel in polarisierenden Themen wie der Migrationspolitik niederschlagen. Guten Morgen, Herr Berbner!
Bastian Berbner: Guten Morgen!
"Er hat sich schrittweise vom Islamismus abgewendet"
Kaess: Fangen wir mal mit dem Extrembeispiel an. Ist das nicht ein bisschen eine gewagte These, zu sagen, jemand, der einen Anschlag plant, mit dem reden wir mal ein bisschen, und dann ist er bekehrt. Was hat Sie denn auf dieses Thema gebracht?
Berbner: Ich glaube, wenn man konkrete Hinweise darauf hat, dass ein Anschlag bevorsteht, dann ist man natürlich gut beraten, so schnell wie möglich einzuschreiten und den zu verhindern. Aber ich bin eben in meiner Recherche auf einen Fall gestoßen eines jungen Islamisten, der noch keinen konkreten Anschlag geplant hatte, aber eben auf dem besten Weg war, in den Dschihad zu ziehen, also nach Pakistan damals in seinem Fall auszuwandern, vielleicht sogar nach Syrien. Und in seinem Fall hat das eben sehr geholfen. Dieser junge Mann kommt aus Dänemark – also ursprünglich aus Somalia, aber er ist dann mit fünf Jahren nach Dänemark gekommen – und hat sich halt in seiner Jugend sehr schnell sehr stark radikalisiert und wollte dann in den Heiligen Krieg ziehen. Dann gab es aber diesen einen Tag, als sein Telefon geklingelt hat und am anderen Ende war halt ein Polizist der Präventionseinheit, der zu ihm gesagt hat: Ich hab hier in einer Akte von dir gelesen, willst du nicht mal bei mir vorbeikommen auf dem Revier und mit mir einen Kaffee trinken, wir könnten ja mal drüber reden. Das ist eine lange Geschichte, die daraufhin folgt, die ich jetzt hier nicht erzählen kann, aber dieser Kontakt, diese Kontaktaufnahme – der Islamist, dieser junge Mann hat dann gesagt, okay, ich hör mir das mal an, was du zu sagen hast – hat halt dazu geführt, dass er ganz langsam und schrittweise sich vom Islamismus abgewendet hat und wieder zurück ins Leben geführt hat.
Kaess: Was hat ihm geholfen?
Berbner: Na ja, der ist da hingegangen zu diesem Treffen mit dem Polizisten und hat erwartet, na ja, Polizisten sind Feinde, die gehören zu dem System, das ich als rassistisch empfinde, das mich hier ausstößt und provoziert und so weiter. Kurzum, er hatte eine Begegnung mit dem Feind erwartet, und dann war aber da dieser Polizist, der mit einem Lächeln – wie er sagte – begrüßt hat, der ihn in so eine Teeküche geführt hat und gesagt hat, darf ich dir einen Kaffee anbieten, und ihn erst mal nur gefragt hat, wie es ihm so geht. Und diese Banalitäten, also dass er ihn einfach ganz normal, wie einen normalen Menschen behandelt hat, hat diesen jungen Mann so überrascht, dass er neugierig geworden ist. Und auf dieses eine Treffen folgten dann weitere, und es dauerte wie gesagt eine ganz Weile, bis er von seinem Radikalismus abgelassen hat, aber er hat dann eben gelernt, dass nicht alle Polizisten Feinde sind. Auf einige mag das zutreffen, von denen er in der Vergangenheit schlecht behandelt worden war in seinen Augen, aber nicht auf alle. Und dann hat er irgendwann seinen Frieden wieder gemacht mit der dänischen Gesellschaft.
Vorurteile aus der Ferne entwickelt
Kaess: Dieses Programm in Dänemark, das ist sehr erfolgreich, das schildern Sie auch in Ihrem Buch, aber es geht nicht immer nur um Extremisten, sondern es geht auch um ganz normale Vorurteile oder Konflikte in der Gesellschaft. Welche Geschichten haben Sie noch gefunden?
Berbner: Ich hab zum Beispiel eine Geschichte gefunden, die in Hamburg spielt: Da waren zwei Rentner, die ganz große Vorurteile hatten gegen Ausländer im Allgemeinen, gegen Muslime, ganz speziell aber auch gegen Roma, und sie waren aber eigentlich nie richtig konfrontiert gewesen mit diesen Menschen, über die sie so große Vorurteile hatten, das heißt, sie hatten die quasi aus der Ferne entwickelt. Und dann kam es eben zu der Situation im Jahr 2014, dass in der Nachbarwohnung eine sechsköpfige Roma-Familie eingezogen ist, sozusagen in direktem Kontakt unter Nachbarn ist von diesen Vorurteilen nicht viel übrig geblieben. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber die sind sich sehr nahegekommen, und wenn man heute mit diesen beiden Rentnern redet, unterscheidet sich das eben sehr, sehr stark, was man hört im Vergleich zu dem, was sie vorher dachten.
Lernen für das große Ganze
Kaess: Jetzt ist das, was Sie schildern, ja nicht ganz neu, das kann man auch an anderer Stelle in der Gesellschaft beobachten, und auch gegen Radikalisierte gibt es Präventionsprogramme schon lange. Was hat Sie persönlich fasziniert an den Geschichten, die Sie gefunden haben, und warum fanden Sie es notwendig, darüber zu berichten?
Berbner: Na ja, als ich damit anfing – 2016 war das, in diesem Höllenjahr, als man ja wirklich dachte irgendwie, es wird jetzt immer nur noch schlimmer und schlimmer mit Le Pen und Brexit und Trump und so weiter, man hatte das Gefühl, uns bricht hier an allen Ecken und Enden die Gesellschaft auseinander –, fand ich halt, dass in diesen Geschichten erst mal eine Hoffnung steckte. Im Kleinen ist da gelungen, was man sich im Großen gewünscht hat, nämlich dass Leute zusammengefunden hatten, bei denen man von außen gesagt hätte, die können eigentlich nicht zusammenfinden, die sind so weit auseinander und hassen einander so stark teilweise, das kann nicht funktionieren. Und dann hat es eben doch funktioniert, und meine Frage war halt, können wir daraus irgendwas lernen fürs große Ganze, also können wir irgendwie das, was zwischen diesen Individuen geklappt hat, irgendwie anwenden auf die Gesellschaft.
Solche Begegnungen in der Gesellschaft stärker hervorrufen
Kaess: Was ist Ihre Antwort, was können wir lernen daraus?
Berbner: Na ja, ich hab dann angefangen, mich mit der Forschung dazu zu beschäftigen, und die geht tatsächlich zurück bis in die 40er-Jahre. Seither sind sehr, sehr, sehr viele Sozialpsychologen diesem Phänomen der Begegnung und des Kontakts nachgegangen, so sehr, dass man – na ja, ich will nicht sagen, dass jetzt die Frage ausgeforscht ist, weil so eine Frage ja nie ausgeforscht ist, aber man weiß doch ziemlich gut Bescheid, dass diese Art von Kontakt, diese Art von Begegnung unter Feinden, Gegnern und Andersdenken, wie auch immer man es bezeichnen will, eben hilft, Vorurteile zu reduzieren. Und in der Regel kommen Menschen, nachdem sie einander begegnet sind, besser miteinander klar nachher. Für mich war das eine Erkenntnis, und ich finde, daran schließt sich halt die Frage an, wie können wir solche Begegnungen stärker hervorrufen in der Gesellschaft.
"Härte ist das Rezept und Terror noch größer zu machen"
Kaess: Auf der anderen Seite – das wäre jetzt die empathische Seite –, auf der anderen Seite gibt es, wie Sie das eben auch beschreiben, die Tatsache, dass viele Staaten vor allem mit Härte reagieren auf Extremisten zum Beispiel. Das prominenteste Beispiel war der "War against [on] Terror", der Krieg gegen den Terror der USA nach dem 11. September 2001. Was ist die Bilanz auf der Seite?
Berbner: Im letzten Jahr, 2018, haben Wissenschaftler der Brown University in Amerika eine große Studie dazu gemacht, die hieß "Costs of War". Da haben die quasi einmal ausgerechnet, was der ganze Kampf gegen den Terrorismus seit dem 11. September gekostet hat, also alles zusammengenommen: der Krieg im Irak, in Afghanistan, die Geheimgefängnisse, das Drohnenprogramm, Guantanamo, all das: 5,9 Billionen Dollar, also eine unfassbare Summe Geld. Und heute haben wir ungefähr viermal so viele sunnitische Dschihadisten wie am 11. September. Jetzt kann man natürlich irgendwie nur schwer eine Kausalität belegen zwischen diesen beiden Zahlen, aber es gibt halt viele Experten, die sagen, na ja, wenn man Härte in so einem Umfang anwendet gegen Feinde, dann führt das halt dazu, dass man noch mehr Feinde schafft. Wenn man zum Beispiel einen Terroristen tötet, wird man in seiner Familie, unter seinen Freunden und Bekannten weitere Terroristen heranziehen. Wenn man einen Terroristen foltert, wovon wird der den Rest seines Lebens erzählen, wenn er wieder freikommt: nämlich von der Unmenschlichkeit und der Folter, die er erlitten hat. Das ist sozusagen, wenn man vielen Experten glaubt, das Rezept, um den Terror noch größer zu machen.
Manche Kontakte haben auch keine Konsequenzen
Kaess: Auf der anderen Seite wirkt aber auch die Empathie nicht immer, Sie haben auch Gegenbeispiele gefunden.
Berbner: Ja, ich hab zum Beispiel eine Geschichte gefunden, auch eine eher extreme: Da geht es um einen Neonazi, einen deutschen Neonazi, der in eine Situation gekommen ist – das würde jetzt zu weit führen, die zu erklären, ist eine völlig verrückte Geschichte –, dass er in Afrika mit einem linken Radikalen durch die Wüste gewandert ist. Und dort ist erst mal dasselbe passiert, wie wir bei diesem jungen Islamisten aus Dänemark und dem Polizisten gesehen haben, nämlich die beiden haben sich angefreundet, hatten irgendwie eine gute Zeit miteinander. Der Nazi hat auf einmal den Rucksack des Linken durch die Wüste getragen und so weiter, aber dann ist er zurückgekommen in seine Heimat, nach diesem "Abenteuer", in Anführungszeichen, und hat gesagt, nee, das will ich nicht, ich will diese Menschen hassen. Ich hab jetzt gemerkt, der Kontakt zu denen führt dazu, dass mir das schwerer fällt, sie zu hassen, also ziehe ich mich wieder zurück in meine Filterblase, in der Freunde, Nachbarn, Mitarbeiter alle Nazis sind, und ich breche diesen Kontakt ab. Und das hat dann eben bei ihm dazu geführt, dass dieser Kontakt keine großen Konsequenzen hatte.
"Mit denen reden, die man verurteilt"
Kaess: Was bedeuten Ihre Recherchen für Sie persönlich, übertragen auf die große Debatte, die Deutschland so polarisiert hat wie, würde ich sagen, kein anderes Thema in den letzten Jahren die Flüchtlingsdiskussion?
Berbner: Einerseits gibt sie mir Hoffnung, weil ich gesehen habe, dass es auch in Fällen funktionieren kann, dass Menschen zusammenkommen, bei denen man das vorher nicht denken würde. Gleichzeitig frustriert es mich natürlich, dass ich jetzt seit Jahren sehe, dass das eben nicht passiert, dass die Debatte, ich will nicht sagen auf der Stelle tritt, aber im Prinzip sind die Lager seit 2015 die gleichen geblieben. Die Fronten sind verhärtet, und man findet nur selten Menschen, die tatsächlich mal auf die andere Seite offen versuchen zuzugehen und zu verstehen und auch neugierig sind, sondern eben sich damit begnügen, in der eigenen Meinung zu verharren und allzu oft aus der Ferne sich diese Meinung zu bilden – das frustriert mich.
Kaess: Was, glauben Sie, würde helfen?
Berbner: Nach allem, was ich jetzt recherchiert habe, Kontakt. Also wenn man der Meinung ist, Flüchtlinge sind nicht gut für dieses Land und Deutschland sollte keine Flüchtlinge aufnehmen, würde es, glaube ich, helfen, mit Flüchtlingen zu sprechen. Wenn man der Meinung ist, alle AfD-Wähler sind Nazis, dann würde es, glaube ich, helfen, mit einigen AfD-Wählern mal zu sprechen, um zu merken, dass das nicht stimmt. Man sieht das ja überall irgendwie, diese Art von Vorurteilen und Kampfbegriffe werden ja immer aus der Ferne kultiviert. Also Pegida mobilisiert dort gegen den Islam, wo es kaum Muslime gibt in Sachsen. AfD-Wähler werden hauptsächlich dort beschimpft, wo es wenige von ihnen gibt, in den westdeutschen Metropolen. Und ich hielte es für sinnvoll, sozusagen hinter diese Kampfbegriffe zu schauen, einmal auf die andere Seite zu gehen, sich diejenigen anzuschauen und mit denen zu reden, die man verurteilt.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.