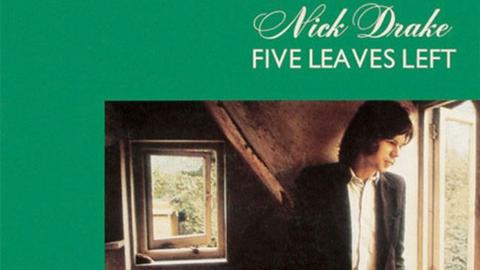Christoph Reimann: Das neue Album erinnert mich an Nick Drake – die Melancholie, die Wärme, die Streicher. Und – ich glaube, das hören Sie nicht zum ersten Mal – ich musste auch an frühe Platten von Joni Mitchell denken: die Art, Geschichten zu erzählen, die ungewöhnlichen Harmoniefolgen. Sind diese beiden Songwriter wichtig für Sie?
Bedouine: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Nick Drake. Ich finde es super, wenn ich mit ihm verglichen werde. Er konnte so eine Stimmung erzeugen, schwer zu sagen, was genau die ausmacht, aber die ist toll. Ich bin keine besonders gute Gitarristen, oft weiß ich gar nicht, was ich da eigentlich mache. Aber manchmal, besonders dann, wenn ich mal eine andere Stimmung ausprobiere, dann entstehen Klänge, die mich an ihn erinnern. Und das ist ein gutes Zeichen. In dieser Hinsicht habe ich schon das Gefühl, von ihm beeinflusst zu sein.
Reimann: Und Joni Mitchell?
Bedouine: Auch von ihr bin ich ein großer Fan. Ihr Einfluss auf meine Musik passiert eher unterbewusst. Aber ich bin mir sicher, dass er da ist. Ich liebe Joni Mitchell. Das Album "Blue" ist eines der größten Singer-Songwriter-Meisterwerke überhaupt.
Reimann: In einem ihrer bekanntesten Songs, in "Big Yellow Taxi", singt Joni Mitchell: "They paved paradise and put up a parking lot". Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, sind diese Zeilen immer noch aktuell – mit der Gentrifizierung in den großen Städten. Einer der neuen Songs auf Ihrem Album heißt "Echo Park", ein Stadtteil Ihres Wohnortes Los Angeles ist das. Es gab eine Zeit, da wollte da niemand wohnen, alles war runtergekommen, jetzt entwickelt sich der Stadtteil ins komplette Gegenteil. Wie sieht der von Ihnen besungene Stadtteil "Echo Park" denn aus?
Song über Gentrifizierung
Bedouine: Ich finde Echo Park wunderschön. Ich habe das Gefühl, dass noch viel von früher da ist. Der namensgebende Park zum Beispiel wurde wieder hergerichtet. Der Song spielt darauf an, was sich alles verändert hat, seitdem ich da wohne, also was in den letzten neun Jahren passiert ist.
Was die Gentrifizierung angeht, bin ich zwiegespalten. Einerseits mag ich viele der Veränderungen, aber ich kriege auch mit, was das mit der Umgebung macht. Die Geschwindigkeit, mit der das abläuft, bereitet mir Sorge. Der Song ist daher auch als Satire gedacht – etwa, wenn ich über diese offene, multikulturelle Blase singe, in der ich mich bewege. Einerseits kann man es sich darin gemütlich machen, andererseits lassen sich die Regeln dieses Zusammenlebens nicht auf das gesamte Land übertragen.
Leben in der multikulturellen Blase
Das sind kleine Beobachtungen in dem Song, die man allerdings leicht überhören kann. Ein Freund von mir dachte zum Beispiel, dass der Song als Liebesbrief an Echo Park gemeint ist. Bis er dann gemerkt hat: Irgendwann wird’s ganz schon finster. Und ich habe zu ihm gesagt: Ja. Genau.
Reimann: Man könnte Ihnen, also einer Künstlerin, vorwerfen, zur Gentrifizierung beizutragen.
Bedouine: Ja, total. Viele Reaktionen auf den Song waren positiv. Aber es gab auch ein paar Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass ich es wage, einen Song über Echo Park zu schreiben. Die haben mir vorgeworfen, noch nicht lange genug da gelebt zu haben. Ich weiß, dass Vertreibung ein großes und auch schwieriges Thema ist. Und natürlich kann Gentrifizierung zu Vertreibung führen, und ich wünschte, wir hätten da bessere Gesetze.
Auf die Welt gekommen in Syrien
Als eine Person, die wegen der Künstler-Community hier hingezogen ist, habe ich das Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen. Denn ich bin ja nicht die große Investorin, die die gesamte Nachbarschaft umkrempelt. Aber ich weiß, dass Leute mit Geld gerne in Gegenden investieren, die eine lebhafte Künstler-Szene haben. Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist. Ich habe Vertreibung am eigenen Leib erfahren, mehrere Male. Und ich wünsche das keinem anderen.
Reimann: Sie sind in Syrien auf die Welt gekommen, Ihre Eltern kommen aus Armenien. Aufgewachsen sind Sie in Saudi-Arabien. Seit wann sind Sie in den USA?
Bedouine: Ich bin 1995 nach Amerika gezogen.
Reimann: Ich nehme an, Sie sind damals mit Ihren Eltern umgezogen, also in die USA, richtig?
Bedouine: Ja.
Reimann: War das auch Displacement, also eine Vertreibungserfahrung für Sie?
Bedouine: Irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, dass sich meine Vergangenheit hinter mir auflöst, dass sie verschwindet. Das Land, mit dem mich am meisten verbunden hat, war Syrien. Da war meine ganze Familie zuhause, bis der Krieg das Leben dort unmöglich gemacht hat. Große Teile meiner Familie haben das Land dann verlassen. Aber in Syrien habe ich mich zuhause gefühlt.
"Ich bin nie irgendwo angekommen"
Aufgewachsen bin ich in Saudi-Arabien, ein Land, das wie kaum ein anderes von Unterdrückung geprägt ist. Besonders stark erlebt man das, wenn man eine Frau ist. Jetzt, wo meine Eltern im Ruhestand sind, ist Saudi-Arabien der nächste Ort, der aus meiner Vergangenheit verschwindet.
Reimann: Damit wir uns richtig verstehen: Ihre Eltern wohnen noch in Saudi-Arabien?
Bedouine: Bis vor ein paar Tagen haben sie noch da gelebt. Eigentlich wollten sie ihren Ruhestand in Syrien verbringen. Aber wegen des Kriegs machen sie das jetzt in Armenien.
Reimann: Was meinen Sie: Welche Rolle spielen Ihre Herkunft und Ihre Kindheit für Ihre Musik?
Bedouine: Schwer zu sagen, welchen Einfluss mein kulturelles Erbe hat. Ich bin in einem sehr amerikanischen Umfeld aufgewachsen. Selbst in Saudi-Arabien bin ich auf eine amerikanische Schule gegangen, habe in einer amerikanischen Wohnanlage gelebt, zusammen mit Menschen, die in den meisten Fällen aus dem Westen kamen. Einerseits wurde ich so schon früh auf ein Leben im Westen vorbereitet. Andererseits gab es doch so etwas wie einen Kulturschock, als ich in den USA ankam.
Saudi-Arabien mit zehn Jahren hinter mir zu lassen – ich glaube, das hat dazu geführt, dass es mir schwerfällt, mich irgendwo zuhause zu fühlen. Das hat auch meine Werdegang geprägt: Ich bin so viel gereist, wie es möglich war. Ich habe das College als Möglichkeit gesehen, von einem Ort zum anderen zu ziehen. Aber ich bin nie irgendwo angekommen. Und ich glaube, das findet sich auch in meinem Songwriting.
Reimann: Was man in Ihrer Musik nicht hört, sind Anleihen aus traditioneller armenischer, syrischer oder saudi-arabischer Musik. Sie scheinen mehr von westlicher Popkultur beeinflusst zu sein.
Anti-Trump-Song
Bedouine: Ja. Auf jeden Fall. Eine Zeitlang habe ich in Kentucky gelebt. Da habe ich Leute kennengelernt, die sich für ältere Popmusik interessiert haben. Die haben mir die Folkmusik der 60er und 70er nahegebracht, die Bands der British Invasion, so was. Das hat mich beeinflusst, nicht so sehr die Musik, die bei uns zuhause lief, als ich klein war.
Reimann: Sie waren eine von vielen Künstlern und Künstlerinnen, die einen Song von Matthew E. White gecovert haben. Den Song "There Is No Future In Our Frontman", ein Anti-Trump-Song, der kurz vor den Midterm-Wahlen im November 2018 erschienen ist. Fühlen Sie sich wohl in Amerika?
Bedouine: Ich habe das Glück, in einer Umgebung zu leben, in der es viele Leute gibt, die so denken wie ich. Das schützt mich in gewisser Weise vor den verheerenden Auswirkungen der Politik. Aber natürlich informiere ich mich. Es sieht aussichtlos aus. Aber die Geschichte wiederholt sich nun einmal. Und ich glaube daran, dass sich das Pendel auch wieder in die andere Richtung bewegt. Ich wünschte natürlich, wir, als Gesellschaft, würden uns stetig in nur eine Richtung bewegen – nach vorne.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.