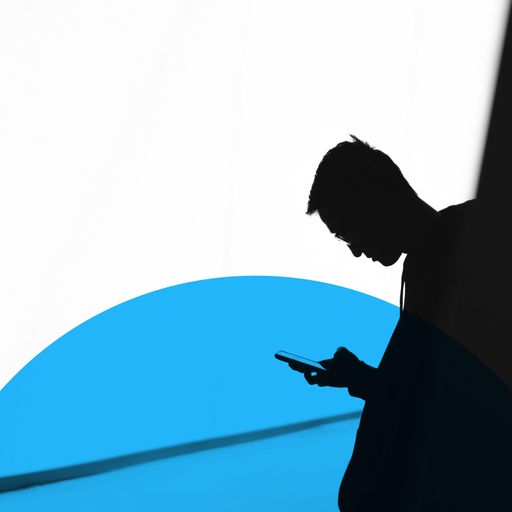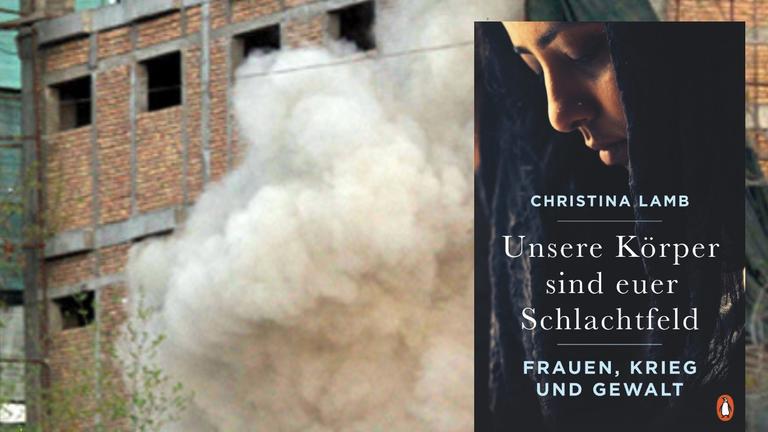Hilfsorganisationen wie Human Rights Watch dokumentieren sexualisierte Gewalt in der Ukraine.* Und auch Journalistinnen und Journalisten berichten von Gesprächen mit vergewaltigten Frauen.
Machen Sie sich Sorgen um ein Kind oder suchen für sich selbst Hilfe und Unterstützung? - Auf dem Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch finden Sie vertrauliche und professionelle Hilfe per Telefon, Online-Beratung, Chat oder im persönlichen Gespräch.
Sexualisierte Gewalt im Krieg folgt einer Systematik und wird oft als Kriegswaffe eingesetzt. Es geht dabei unter anderem um Machtausübung, Erniedrigung, Demütigung und Isolierung des Opfers von der Gruppe.
"Wenn Vergewaltigung mit einem nichts zu tun hat, dann ist es Sex", betont Romy Fröhlich, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. "Vergewaltigungen sind kein Zeichen für einen aggressiven Ausdruck von Sexualität, sondern ein sexueller Ausdruck von Aggressivität." Dennoch halte sich der Mythos, aufgrund des sexuellen Drucks oder Triebs der Soldaten sei unmöglich, im Krieg sexuelle Übergriffe zu vermeiden.
Medien sind auf Zeugenberichte angewiesen
Die Berichterstattung über sexualisierte Gewalt in Kriegen stelle eine besondere Herausforderung für Journalistinnen und Journalisten dar, so Fröhlich. Etwa bei der TV-Berichterstattung, für die es Bilder brauche. "Wenn man Erschießungen zeigen möchte, dann halten Journalisten die Kamera drauf. Das geht bei Vergewaltigungen natürlich nicht."
Medienschaffende sind also auf Zeugenberichte angewiesen. "Aber nicht auf Augenzeugenberichte, sondern auf Berichte von Betroffenen. Das Schwierige dabei ist, dass Opfer - verständlicherweise - keine große Bereitschaft zeigen, über das ihnen Widerfahrene zu berichten." Umso wichtiger ist es laut der Medienforscherin, dass Journalistinnen und Journalisten sensibel mit dem Thema umgehen und genau rechechieren.
"Ein, zwei Berichte von Opfern nützen ihnen in der Regel nicht, sondern sie brauchen da schon ein gerüttelt Maß an Masse, bevor sie über Vergewaltigung im Krieg als Strategie der Konfliktparteien berichten können. Das braucht Zeit."
Seifert: "Systematische und befohlene Aktion"
Lange wurden Vergewaltigungen in Kriegen von Forschung, Politik und Medien als Einzelfälle betrachtet oder gänzlich verschwiegen. Einen Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung gab es erst Anfang der 1990er-Jahre, nachdem Massenvergewaltigungen aus dem Bosnienkrieg und dem Völkermord in Ruanda bekannt wurden.
"Mit eigens zum Zwecke der Vergewaltigung bzw. der sexuellen Folter eingerichteten Lagern in der Mitte Europas hat die Gewalt gegen Frauen eine neue Stufe erreicht. Nach Ermittlungen einer Untersuchungskommission der Europäischen Gemeinschaft müssen die Massenvergewaltigungen und sadistischen Folterungen von Frauen in Bosnien-Herzegowina als systematische und befohlene Aktion betrachtet werden", schreibt die Militärsoziologin Ruth Seifert in ihrem Essay "Krieg und Vergewaltigung".
Erst 2008 hat der UN-Sicherheitsrat Vergewaltigungen und andere Formen sexualisierter Gewalt im Krieg als Kriegsverbrechen anerkannt. Damit können Täter und Täterinnen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verurteilt werden.
Berichterstattung über Vergewaltigung im Krieg gilt als eskalativ
Für Journalistinnen und Journalisten ergibt sich bei dem Thema ein weiteres Problem: "Es wird gerne mal vorgeworfen, dass Berichterstattung über Vergewaltigung in kriegerischen Konflikten zur Verschärfung des Konflikts beitragen würde", sagt Romy Fröhlich. Der Vorwurf von Vergewaltigungen im Krieg werde oft als Rechtfertigung instrumentalisiert, um einzugreifen.
"Als die ersten Berichte über Vergewaltigungen in Bosnien in den Medien im Westen bekannt wurden, wurde lauter als zuvor für ein Eingreifen des Westens in diesen Krieg gesprochen." Auch im Afghanistan-Konflikt wird laut Fröhlich oft mit dem Hinweis auf die Unterdrückung bis hin zur sexuellen Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen für ein Eingreifen argumentiert.
Fröhlich: "Es ist Zeit, Frauen aus der Opferrolle zu holen"
Im Krieg taucht regelmäßig die Erzählung auf, wonach Männer die Kämpfer sind und Frauen beschützt werden müssen. "Das Narrativ wird vor allem von den Militärs genutzt. Da müssten Journalisten genauer hinhören und nachfragen", meint Fröhlich.
Auch zur Flucht und zum vor Ort bleiben gehöre viel Mut. "Was Frauen auf der Flucht erleben, ist wirklich dazu geeignet, sie zu Heldinnen zu machen", so die Medienforscherin. "Sie sind die Beschützerinnen ihrer Familien." Im Krieg in der Ukraine sehe man auch Frauen, die kämpfen wollen.
"Es wäre längst an der Zeit, Frauen aus der Opferrolle zu holen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass sie gerade als Flüchtende und als Zielscheibe von Angriffen zwangsläufig in der Opferrolle sind."
*Der ursprüngliche Text enthielt eine Falschinformation, die wir gelöscht haben.