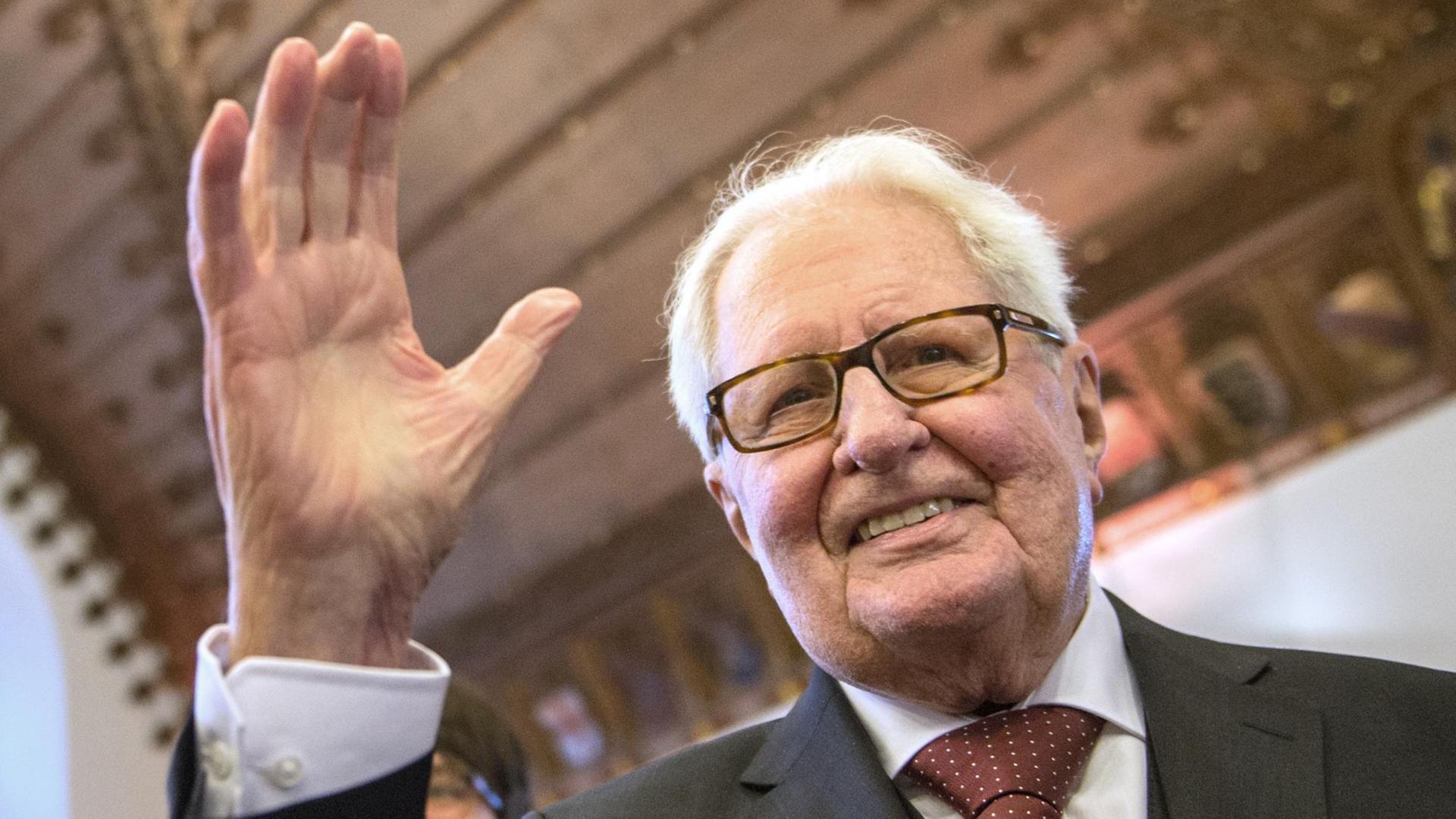Anne Damrau hat vor ein paar Monaten einen Brief erhalten, von dem die meisten Menschen in Berlin wohl nicht einmal zu träumen wagen.
"Gemäß Beschluss erfolgt hier die Mietsenkung auf die aktuell gültige Basismiete der Genossenschaft. Mietsenkung – als ich das jemand erzählt hab, hat'n Freund gesagt: Mietsenkung – gibt’s das Wort überhaupt?"
Bekanntlich diskutiert Berlin seit Jahren über immer weiter steigende Mieten, über Verdrängung und den Verlust von sozialer Infrastruktur. Dementsprechend war die Gefühlslage Damraus, als sie diese Ergänzung zum Mietvertrag, wie das Dokument überschrieben ist, in Händen hielt.
"Naja, ein bisschen erstaunt war ich schon. Es war ja vorher schon so, dass ich für diese Gegend hier, was jetzt hier die Neuvermietungspreise sind, haben wir ja schon vorher extrem günstig hier gewohnt."
Günstige Mieten im überhitzten Immobilienmarkt
Die Gegend ist der zentral gelegene Stadtteil Friedrichshain. Bemerkenswert am Fall Rigaer Straße 77 ist nicht nur, dass die Haushalte eine Mietsenkung erhalten haben. Ungewöhnlich niedrig ist die Miethöhe. Bisher zahlte Anne Damrau 4,40 Euro pro Quadratmeter nettokalt, nun sind es 3,50 Euro. Zum Vergleich: Der Berliner Senat gibt auf Anfrage an, dass die durchschnittlichen Nettokaltmieten der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen im Jahr 2018 zwischen 5,96 Euro und 6,27 Euro betrugen. Heiz- und Betriebskosten machen in der Rigaer Straße 77 knapp über zwei Euro pro Quadratmeter aus – auch das ist kein hoher Wert. Der sanierte Altbau sei in gutem Zustand, sagt Anne Damrau.
"Wir haben jetzt hier Dielen vorne drinnen, das sind teilweise die alten Dielen, und hier nicht, aber in anderen Räumen sind teilweise dann neue damals gemacht worden."
Damals, das war Ende der Neunziger. Friedrichshain ist so etwas wie das Kreuzberg Ostberlins. Wie im Westberliner Kreuzberg in den Achtzigern, wurden Anfang der Neunziger hier viele Häuser besetzt, gerade auch in der Gegend um die Rigaer Straße. So auch die Nummer 77. 1997 wurde das Haus von der Genossenschaft Luisenstadt gekauft, der 19 weitere ehemalig besetzte Häuser in Kreuzberg gehören, zum Teil in Erbbaupacht. Die nötige Sanierung wurde mit viel Eigenarbeit gestemmt.
"Wände rausgerissen, Treppenhaus, alles selber gemacht, was man selber machen kann. Schutt geschleppt, ganz viel gearbeitet. In der Phase bin ich dazu gekommen, zu dem Projekt."
Sanierung in Eigenregie
Seit 2000 wohnt Damrau im Haus, wobei sie mehrmals die Wohnung gewechselt hat. Heute lebt sie zu viert auf über 120 Quadratmetern. Um die 25 Haushalte gebe es hier im Vorder- und Hinterhaus sowie einem Seitenflügel, sagt sie. Die wenigen Leute, die schon bei der Sanierung dabei waren, haben ihr zufolge all die Jahre eine niedrigere Miete gezahlt, als diejenigen, die erst später eingezogen sind. Nun also die Angleichung nach unten an die sogenannte Basismiete der Genossenschaft. In wie vielen der 20 Häuser die 3,50 Euro nettokalt gelten, mochte der Vorstand gegenüber dem Deutschlandfunk bis Redaktionsschluss nicht sagen. Anne Damrau erzählt, dass für ihr Haus Kredite abbezahlt werden mussten, und dass das nun wohl erledigt sei. Dass die Mieten so niedrig sind, liegt auch an der teilweisen Selbstverwaltung. Nicht nur in den Gremien der Genossenschaft bringen sich die Mitglieder ein, sondern auch in der Instandhaltung.
"Wir haben Leute im Haus, die handwerkliche Berufe haben, oder Leute, die landschaftsgärtnerisch irgendwie unterwegs sind, oder verbandelt. Und wenn wir jetzt hier den Baum beschneiden, das machen wir dann selber mit unseren Bekannten, oder irgendwelche Pflanzen, die an der Seite zu dolle wuchern und beschnitten werden müssen, da holen wir keine Firma. Und für andere Sachen, Reparaturen und sowas, haben wir auch manchmal Leute im Haus, die das machen, und dann klären wir das mit den Rechnungen mit der Luisenstadt, dass statt einer Handwerksfirma das dann hier jemand macht."

Der Innenhof des Hauses ist schön begrünt und war all die Jahre nicht nur für die Kinder eine Gemeinschaftsfläche. Und wie so oft bei ehemalig besetzten Häusern dient auch das Ladenlokal zur Straße hin einem sozialen Zweck. Lange Zeit beherbergte es eine von der Hausbesetzungsbewegung frequentierte Kneipe.
Das Haus als Nachbarschaftszentrum
"Da ist jetzt das TiK Nord drin, also TiK heißt: Theater im Kino. Leute aus unserem Haus machen und managen das auch. Da ist manchmal einfach so offen Kneipe, es gibt aber auch Musikveranstaltungen. Und Theateraufführungen. Die Leute, die Theater machen, die proben hier auch. Und unser Haus – ich glaub, wir haben die Abmachung, dass jeder, der im Haus wohnt, einmal im Jahr Geburtstag da drin feiern kann, einfach so, und den Laden nicht mieten muss, oder irgend – ist schon ewig her, das machen jetzt auch nicht alle, aber öfter mal, wenn Leute im Haus Geburtstag feiern, machen sie das auch hier unten."
Anne Damrau fühlt sich wohl in ihrem Hausprojekt. Die beschwerliche Sanierungsarbeit dauerte lange, und das Leben auf einer Baustelle war eine Belastung. Doch heute zahlt sich das Modell Eigenarbeit und Selbstverwaltung aus.