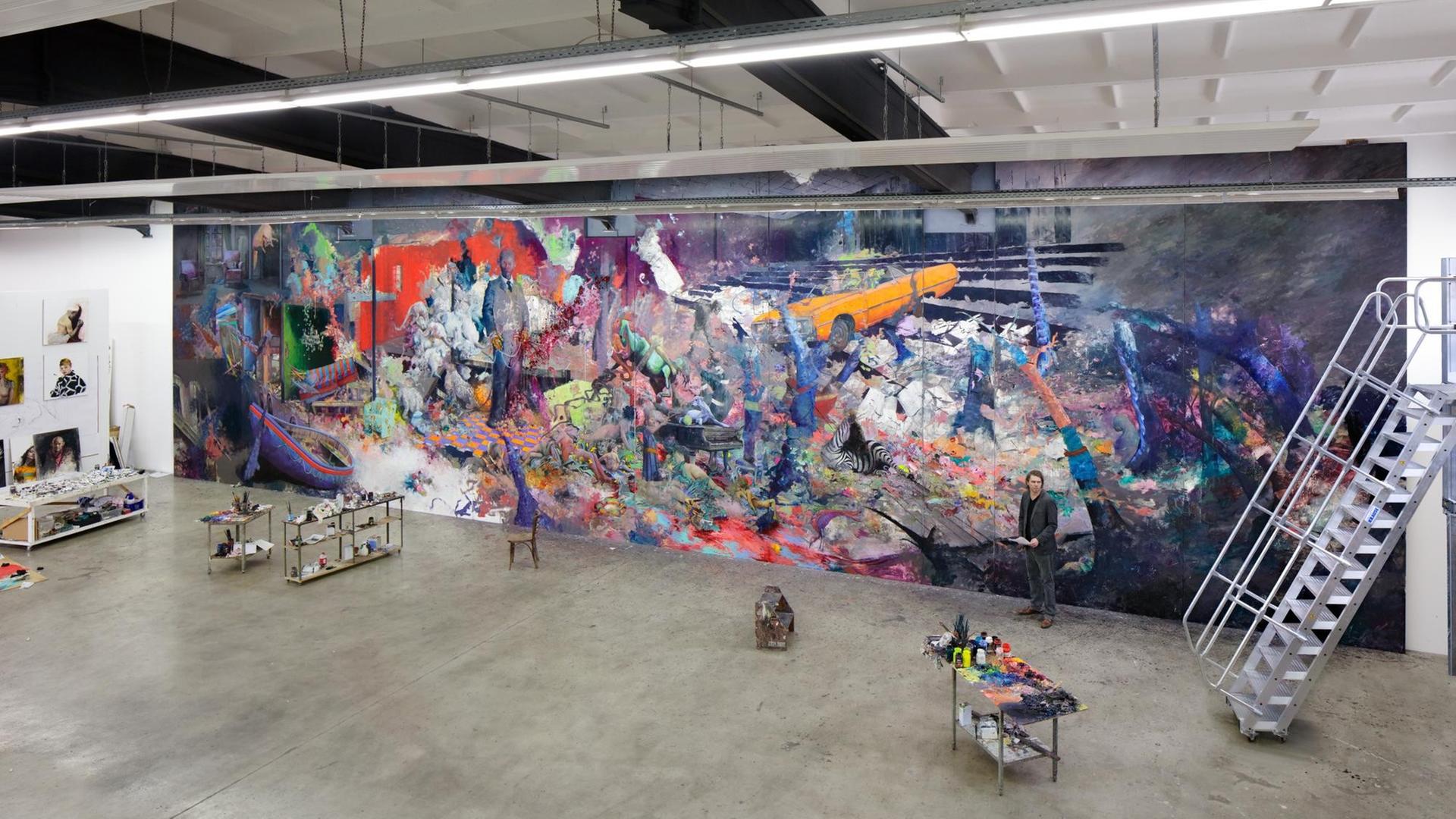Ein wenig erinnert es an die Datenanzüge der neunziger Jahre, was Chris Salter den Besuchern seiner Installation „Haptic Field“ überzieht. Ein schwarzer Kaftan mit insgesamt sieben Sensoren an Armen, Beinen und Brust, und über die Augen zieht man eine Art Skibrille, durch die man allerdings nicht viel mehr erkennt als Schemen.
„Und dann geht man in diese dunklen Räume, und es gibt kein Ziel. Das ist, was interessant ist, es gibt kein Ziel, das ist mehr, wie man so eingetaucht ist, Immersion, also eingetaucht ist, und dann bewegst du dich durch diese Räume, und die Räume sind verschiedene sogenannte Zustände, einer sehr dunkel, einer sehr überwältigend, einer ist sehr minimal, einer ist so mehr schwebendes Gefühl, und über einen Zeitraum ist alles so miteinander verbunden, so dass man nicht mehr die Grenzen zwischen dem, was innen und was extern, wahrnehmen kann.“
Geisterhaftes und schwebendes Raumgefühl
Tatsächlich wirken in Chris Salters Installation verschiedene Licht- und Soundempfindungen auf den Körper ein, glimmende oder strahlende Lichter, tiefe Bässe, der Sehsinn ist zurückgenommen, man ist ganz auf seine sonstigen Sinne und sein inneres Orientierungsvermögen verwiesen. Ist man mit vielen anderen zugleich in diesen Räumen, steigert sich das Gefühl des Geisterhaften und Schwebenden noch. Und doch ist es deutlich eine Aktion im analogen Raum, mehr eine Imitation von Zukunft, als schon deren Realität. Chris Salter sieht seine Arbeit dabei weniger als Kunstwerk, denn als eine Mischung aus Forschung, Kunst, Soziologie, Experiment und Engineering. Immersion, sagt er, sei eigentlich etwas Altes, man könne auch schon Meditation oder religiöse Rituale als Immersion verstehen. Aber:
„Die neue Immersion ist, dass die Umgebung wird immer mehr technologisch. Und das bedeutet, wir müssen ein neues Verhältnis zwischen der Umgebung und uns einordnen. Und das bedeutet, dass wir uns selbst mehr als technologische Wesen sehen können.“
Wo liegen die Grenzen der Wahrnehmung?
Der Mensch als biochemischer, neuro-technologischer Apparat, der der von ihm geschaffenen Computerwelt immer ähnlicher wird – das ist der eine, wenn man will, gesellschaftskritische Aspekt von „Immersion 2017“. Thomas Oberender, der künstlerische Leiter des einmonatigen, interdisziplinären Ereignisses, sieht aber noch andere Bereiche:
„Das sind zum Teil transzendente Aspekte, aber oft sind es auch ganz wissenschaftliche oder fundamental menschliche, ja, so: Was kann man begreifen? Und wir sitzen jetzt hier gerade, während wir uns unterhalten, in einem Raum, da ist ein Aquarium, und da ist der Fangschreckenkrebs zu sehen, das ist ein Lebewesen, das über eine Weltwahrnehmung verfügt, die können wir uns gar nicht vorstellen. Da wo wir in den Augen drei Rezeptoren haben, für drei Primärfarben, hat dieses Lebewesen neun. Das heißt, es sieht Farben, die wir nicht sehen, die aber da sind.“
Fangschreckenkrebse und Korallenzüchtungen gehören allesamt zu einem mehrteiligen Parcours unter dem Titel „Arrival of Time“, der die Besucher mit Fragen zu den Grenzen sinnlicher Wahrnehmung konfrontieren will.
Vermächnisräume – mal klischeehaft, mal anrührend
Eine Erfahrung ganz anderer Art bietet dagegen das Theater- und Performanceprojekt Rimini Protokoll mit acht sogenannten Vermächtnisräumen, Mausoleen des 21. Jahrhunderts, wie sie hier auch genannt werden. Acht Menschen sollten dafür eine persönliche Umgebung gestalten, die nach ihrem Tod zurückbleiben wird. Das Publikum kann dann in diese gestalteten Vermächtnisräume und somit gleichsam in die Welt der betreffenden Person eintreten.
Diese Art von Immersion gelingt mal mehr und mal weniger: Der deutsche Bankier, der noch einmal über seine Position im Nationalsozialismus nachdenkt; der Base Jumper, der eine Risiko-Lebensversicherung zugunsten seiner Familie abschließt, sie wirken eher wie selbstgeschaffene Klischees einer durchfunktionalisierten Welt. Damit steht die Arbeit von Rimini Protokoll beispielhaft für alle Projekte, die hier vorgestellt werden: Anrührend, wirklich überwältigend wird es nur, wo Situationen wahrer Intimität entstanden sind: Der Mann, der sich vor seinem Tod im Zwiegespräch an seine Tochter wendet, oder die 19-jährige, die versucht, ihrem noch kaum gelebten Leben in Fotografien nahezukommen. Die Arbeit von Rimini Protokoll zeigt exemplarisch: Immersion ist nicht vorrangig eine Frage der Technik, sondern von Nähe und Distanz.