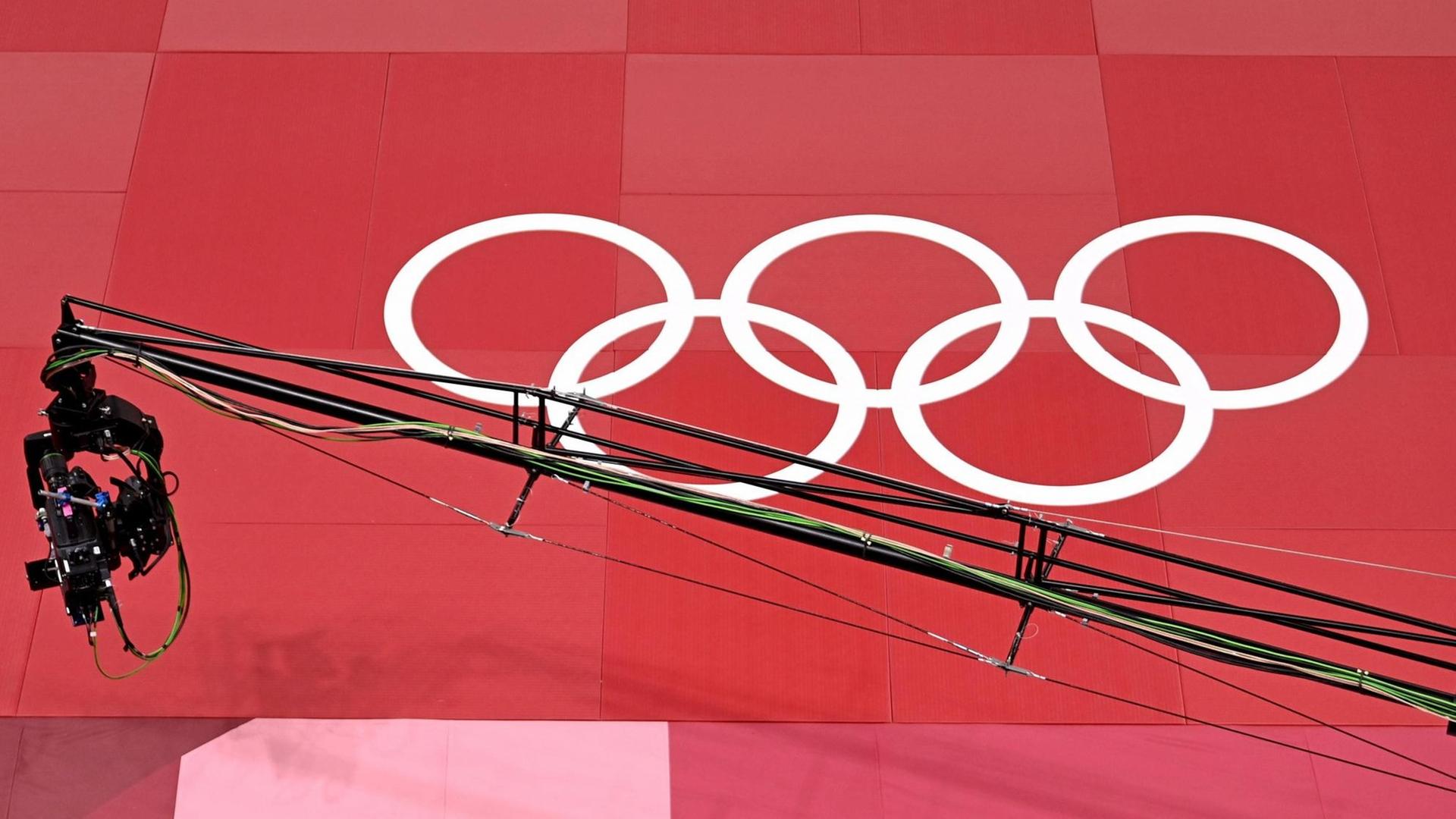
Der Algerier Fethi Nourine wollte bei den Olympischen Spielen einem möglichen Kampf gegen den Israeli Tohar Butbol aus dem Weg gehen und hat seine Teilnahme in Tokio zurückgezogen. Nourine begründete das damit, dass er aufgrund seiner politischen Überzeugung nicht gegen einen Israeli antreten könne. Das algerische Olympische Komitee erkannte Nourine und seinem Trainer daraufhin die Akkreditierung ab und ordnete ihre Rückreise an. Der Judo-Weltverband suspendierte den Sportler vorläufig und nahm weitere Ermittlungen auf. An diesem Montag ist der Sudanese Mohamed Abdalrasool nicht zum Kampf gegen Butbol erschienen. Ein Grund für den Rückzug wurde zunächst nicht genannt.
Alex Feuerherdt, der kürzlich ein Buch über die Israel-Boykottbewegung BDS veröffentlich hat, erinnerte im Dlf-Gespräch daran, dass es in der Vergangenheit diverse ablehnende Gesten oder sogar Boykotte von arabischen gegen israelische Sportler gab. Ein Beispiel: Der ägyptische Judoka Islam El Shehaby hat nach seiner Niederlage bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 dem Israeli Or Sasson den Handschlag verweigert. Ein anderes: 2008 in Peking ist bei den Schwimm-Vorläufen über 100 m Brust der Iraner Mohammad Alirezaei nicht angetreten, weil auch der Israeli Tom Beeri im Becken war.
Verweigerungshaltung mit antisemitischem Hintergrund
"In letzter Konsequenz ist es immer ein antisemitischer Hintergrund, der hinter solchen Boykotten steht", erklärte Feuerherdt. Die Sportler würden sich, wenn sie sich äußern, meistens auch klar positionieren und argumentieren, dass sie für den Kampf der Palästinenser eintreten und deshalb israelische Sportler boykottieren würden. Die politische Linie der jeweiligen Staaten werde dabei auf den Sport übertragen – beispielsweise im Fall Iran: "Der Iran will Israel vernichten, entsprechend lässt er seine Sportler auch nicht gegen Israel antreten."
In Israel sei man enttäuscht, dass es noch immer zu solchen Boykotten komme: "Die israelischen Sportler würden gerne antreten. Sie machen auch immer klar, dass sie selbstverständlich gegen ihre Gegner – aus welchen Ländern auch immer – antreten würden." Die Hoffnung sei da, dass Boykotte bald ein Ende haben. Gleichzeitig sei der Frust groß: "Man will ja nicht kampflos weiterkommen, man will ja sportlich seine Kämpfe gewinnen." Der israelische Judoka Tohar Butbul ist in Tokio fast kampflos bis ins Viertelfinale gekommen.
Einige Iraner widersetzen sich dem Boykott
Es gebe aber auch einige, die eine Verweigerungshaltung gegenüber Israel nicht mehr mittragen wollten, so Feuerherdt. Etwa der iranische Judoka Saeid Mollaei: Bei der Weltmeisterschaft 2019 sollte er nicht gegen seinen israelischen Kontrahenten Sagi Muki antreten. Die Begegnung wäre im Finale möglich gewesen. Mollaei widersetzte sich den Anweisungen aus dem iranischen Sportministerium und verlor schließlich seinen Halbfinalkampf. Daraufhin floh er nach Deutschland und gratulierte schließlich Muki zum Weltmeister-Titel.
Der Iraner Vahid Sarlak, früher Judoka und heute Trainer des Teams aus Tadschikistan, hat aktuell in Tokio ein Video mit einem israelischen Trainer gedreht. Darin sprechen sich die beiden dafür aus, den Sport und nicht die Politik in den Mittelpunkt zu stellen.
"Gräben und Grenzen überwinden"
"Sport ist selbstverständlich Politik", bekräftigte Feuerherdt. Umso wichtiger sei es, dass Sportler politische Signale aussenden – für Völkerverständigung und gegen Boykotte. In Bezug auf die Regel 50 der Olympischen Charta, die politische Meinungsäußerungen verbietet und die das IOC neuerdings von Fall zu Fall auslegen will, findet Feuerherdt: "Ich glaube, niemand hat etwas dagegen einzuwenden, wenn gerade an dieser Stelle Gräben und Grenzen überwunden werden."




