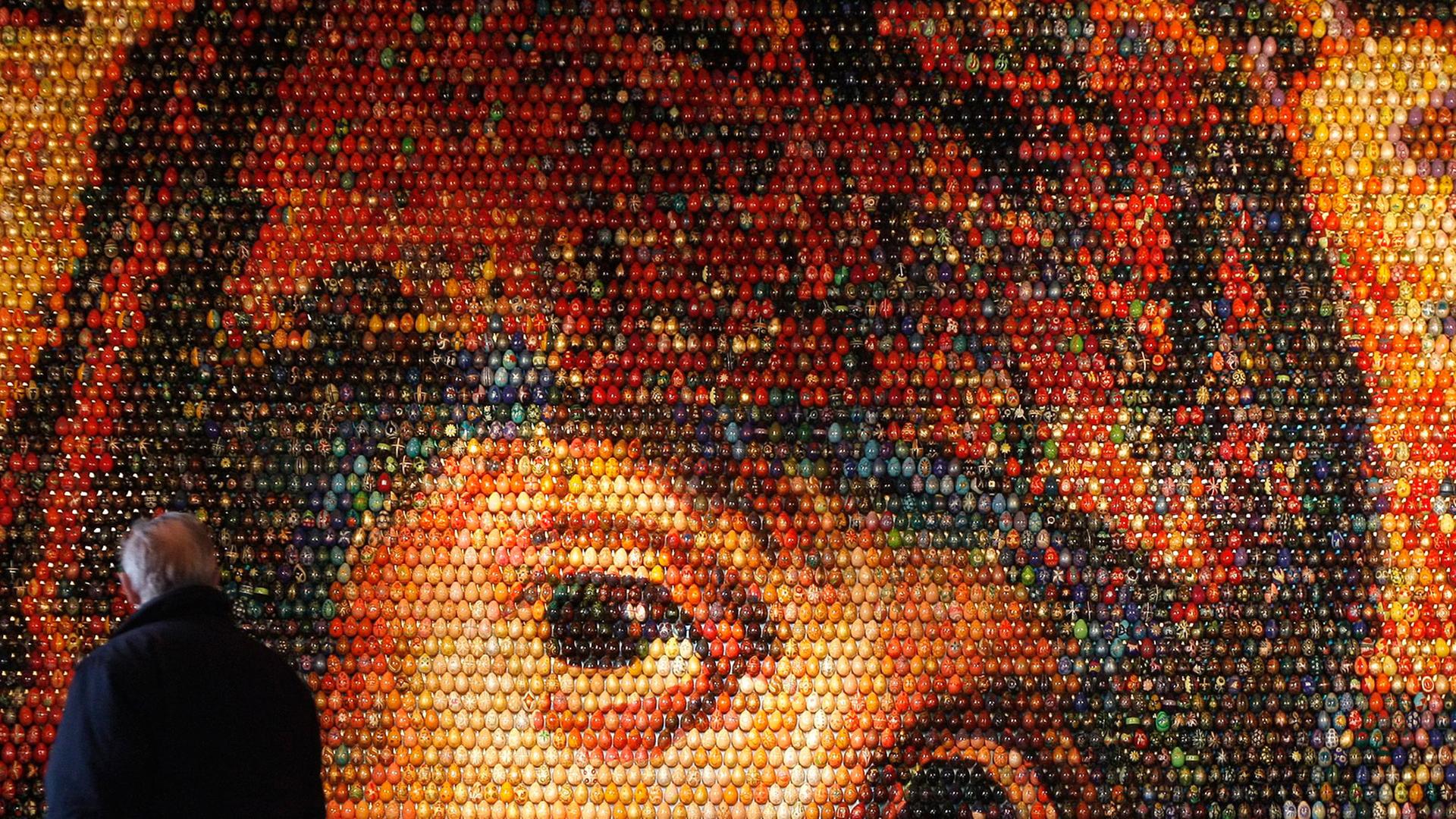Ein weiteres Buch, könnte man meinen, das die Geschichte des Neuen Testaments erneut erzählt. Noch einmal die unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria, noch einmal die Kreuzigungsszene, die Schmerzensmutter, die ihren Sohn beweint, diesmal erzählt von einem irischen Autor, den der Katholizismus so tief geprägt hat, dass ihn seine Motive am Ende einholen, die Kunst und Kirche bereits bis zur Erschöpfung ausgebeutet haben. "Marias Testament" heißt diese knapp 100 Seiten lange Novelle Colm Tóibíns, die 2013 auf der Shortlist des Booker Preises stand. Tóibíns Buch fällt in eine restaurative Zeit, in der sich die westlichen Gesellschaft der eigenen Werte bevorzugt rückwärtsgewandt über historisierende Bauweisen und über die Hinwendung zum Dekor des Religiösen versichert. Es fällt auch in eine Zeit, in der sich das Religiöse in fanatischer, terrorisierender Form Ausdruck verschafft. "Marias Testament" lässt sich als Reaktion auf das eine wie auf das andere lesen. Vor allem aber hat Tóibín mit einer ungeheuren sprachlichen Meisterschaft und imaginativer Kraft eine originäre literarische Figur geschaffen.
In einem Monolog legt Maria Zeugnis ab von sich und ihrem Sohn. Zwanzig Jahre nach Jesus Kreuzigung ist sie in einem sicheren Haus untergekommen, vermutlich im türkischen Ephesus, in das sie ihre namenlosen Wächter zum Schutz vor den Pharisäern gebracht haben. Die beiden Männer kommen regelmäßig in ihre Unterkunft, um die Geschichte ihres Sohnes aus Marias Mund zu hören. So jedenfalls verkünden sie ihr Vorhaben. Allerdings geht das Ansinnen der Evangelisten, von denen der eine Apostel Johannes sein dürfte, in eine andere Richtung. Sie schreiben bereits am Mythos. Nichts darf die Macht und die Wirkkraft dieses Mythos stören, nichts das Bild vom Sohn Gottes trüben:
2Sie tauchen jetzt häufiger auf, die beiden, und bei jedem Besuch wirken sie ungeduldiger, mit mir und mit der Welt. Sie haben etwas Hungriges und Rohes, etwas Brutales, das in ihrem Blut wallt, das ich schon früher erlebt habe und wittern kann, so wie ein Tier, das gejagt wird. Doch mich jagen sie jetzt nicht. Nicht mehr. Ich werde versorgt und leise befragt und beobachtet. Sie glauben, ich wüsste nicht, wie verworren ihre Wünsche sind. (...) Sie glauben, mir sei nicht klar, was da langsam in der Welt heranwächst; sie glauben, ich sähe den Sinn ihrer Fragen nicht, und bemerkte die Gereiztheit nicht, die verhüllt in ihre Gesichter oder verhohlen in ihre Stimmen tritt, wenn ich etwas Unnützes oder Dummes sage, etwas, was uns nicht weiterbringt. Wenn ich mich nicht an das erinnere, woran ich mich ihrer Ansicht nach erinnern müsste."
Tóibíns Maria hat Angst
Diese Maria ist keine Heiligenfigur. Sie ist eine Mutter, die ihren Sohn aufwachsen sieht, sich an die glücklichen Sabbattage seiner Kindheit erinnert und die den Bruch miterlebt, der sich an ihm vollzieht, sobald er alt genug ist, das Elternhaus zu verlassen. Dieser Sohn, dessen Namen sie nicht mehr auszusprechen vermag, wurde erst zum Anführer einer Horde ungefestigter junger Männer, vaterloser Nichtsnutze mit Bindungsangst, die ihn in ihrer Bewunderung, ihrer Dummheit und ihrem Bedürfnis nach Gefolgschaft überhöhten zu ihrem gottgleichen Führer, dem Gottessohn, als der er sich wenig später selbst bezeichnet. Tóibíns Maria hat nachvollziehbare Angst. Sie hat Angst um ihren Sohn, aber auch um ihr eigenes Leben, sie lehnt die Freunde des Sohnes ab und sie misstraut den Wundern, die sich an sein Erscheinen knüpfen wie etwa die Auferweckung Lazarus von den Toten. Diese Maria bittet ihren Sohn nicht darum, Wasser in Wein zu verwandeln. Sie ist auf der Hochzeit in Kana, um ihn anzuflehen, nach Hause zu kommen, denn sie weiss, dass er in Gefahr ist. Er ist ein Dorn im Auge der römischen Obrigkeit und will ihn in Sicherheit bringen. Er aber lässt sie abblitzen:
"Als ich aufstand, um ihn zu umarmen, wirkte er fremd, seltsam förmlich und von oben herab, und ich dachte, dass ich jetzt sprechen sollte, flüsternd sprechen, ehe andere zu uns stießen. Ich drückte ihn an mich. 'Du schwebst in großer Gefahr', flüsterte ich. 'Du stehst unter Beobachtung. Wenn ich den Tisch verlasse, musst du ein paar Minuten warten und mir dann folgen, und du darfst keinem etwas sagen, und wir müssen von hier weggehen. Du darfst keinem sagen, dass du gehst.' Noch ehe ich ausgeredet hatte, war er von mir abgerückt. 'Weib, was geht's dich an, was ich tue?', fragte er, und dann noch einmal lauter, sodass es überall zu hören war: 'Weib, was geht's dich an, was ich tue?' - 'Ich bin deine Mutter', sagte ich. Aber da hatte er schon begonnen, zu anderen zu sprechen, geschwollene Sprüche und Rätsel, und er sprach in seltsamen, anmaßenden Wendungen von sich und seiner Aufgabe in der Welt.
Es hat eine innere Logik, dass ausgerechnet Tóibín die sinnbildlichste und entrückteste aller Mütter der westlichen Kultur zu einer lebendigen literarischen Figur macht. Schon in früheren Werken beschäftigt sich Tóibín mit Mutterfiguren. In seinem Erzählband "Mütter und Söhne" stellt er die Beziehung zwischen Mutter und Sohn als ein komplexes psychologisches und häufig tragisch-unauflösbares Geflecht dar. Für Tóibín ist die Liebe der Mutter durchsetzt von Schuldgefühlen, von Eifersucht und von uneingestandenem Begehren. Der Sohn dagegen fühlt sich vereinnahmt oder vernachlässigt und kommt nie los von der frühkindlichen Liebe. Der Vater ist in all diesen Geschichten abwesend. Auch für Maria symbolisiert nur noch ein Stuhl den toten Ehemann.
"Stabat mater dolorosa" als pure Erfindung
In "Marias Testament" gelingt es Tóibín, die Starre überlieferter und tausendfach wiederholter Bilder zu durchbrechen. Sein Text ist nicht abstrakt, sondern lyrisch, körperlich, frisch, ohne aufdringliche Psychologie, konzentriert aufs Wesentliche. Er entwirft die Figur einer starken, gepeinigten Frau, einer Selbstbewussten, einer Zweifelnden. Eine Person tritt hinter den Abbildern hervor, die die Abbilder blass und unglaubwürdig erscheinen lässt. Und nicht nur das. Auch die Pieta, die Bildnisse der Schmerzensmutter, die ihren toten Sohn vom Kreuz nimmt und in den Armen hält, und das "Stabat mater dolorosa", das lange Zeit Teil der katholischen Liturgie war, stellen sich in Tóibíns Version als Schwindel, als pure Erfindung heraus. Denn Maria flieht, bevor ihr Sohn am Kreuz stirbt. Sie hat Angst vor den Gehilfen der Pharisäer, unter ihnen ein sogenannter Würger, der dafür bekannt ist, lautlos zu morden. Sie fürchtet um ihr eigenes Leben, und damit spricht Tóibín einem zentralen Moment der biblischen Erzählung den Wahrheitsgehalt ab: Maria, die ihren toten Sohn im Arm hält, ist bloß ein Traum. Maria träumt diesen Traum gemeinsam mit einer der Schwestern des Lazarus. Erst von den Evangelisten wird der Traum zu einem tatsächlichen Ereignis umgedeutet:
"Wir träumten beide, dass mein Sohn ins Leben zurückkehrte. Es war Morgen, aber noch war niemand zum Brunnen gekommen, da sie Sonne gerade erst aufgegangen war. Und plötzlich wurden wir beide vom Geräusch von aus der Erde emporgurgelndem Wasser geweckt. Und dann drehte ich mich um, und ich sah ihn, er war zu uns zurückgekehrt. Er war nackt, und die Stellen, an denen er verletzt worden war, an den Händen, den Füßen, den Beinen, da, wo die Knochen gebrochen worden waren, waren blau gerändert und klafften offen. Sein übriger Körper war weiß. In unserem Traum gab es Augenblicke, bevor wir aufwachten, in denen er die Augen öffnete, in denen er die Hände bewegte und dann die Arme. Und dann war er still, oder er war tot, oder ich wachte auf. Und weiter war nichts. Wir konnten uns nicht zurückhalten, und so bekam unserer Führer jedes Wort mit. Da änderte sich etwas in ihm, er fing an zu lächeln und sagte, er habe schon immer gewusst, dass das passieren würde, das sei Teil der Weissagung gewesen. Er ließ uns den Traum haarklein erzählen, und nachdem wir das mehrere Male getan hatten und er ihn auswendig gelernt zu haben schien, sagte er, wir seien jetzt außer Gefahr."
Tóibíns Maria ist eine Frau, die ihrer Stimme beraubt wird. Schon während ihr Sohn stirbt, wird sie zugunsten einer Idee, einer kollektiven Einbildung zum Schweigen gebracht. Damit stellt Tóibín das überlieferte Bildnis der Maria als eine weitere und vielleicht die prominenteste Repräsentation der Imaginationen des Weiblichen dar, die im Laufe der Geschichte der männlichen Einbildungskraft entsprungen sind. Nicht einmal der Vorgang der Geburt gehört noch ihr. Die Evangelisten erklären Maria, wie das mit der unbefleckten Empfängnis vor sich ging, und Maria kann sich nur abwenden. Zu übermächtig ist der Umdeutungswahn dieser Männer. Auch die Kreuzigung soll sie so erinnern, wie ihre Wächter es wollen; ohne Nebensächlichkeiten wie etwa der Mann, der neben einem der Kreuze einen Falken in einem Käfig mit lebenden Kaninchen fütterte. Für Maria wird das zum Sinnbild für die Qual ihres Sohnes; der Vogelkäfig ist gefüllt von halbgefressenen, aber noch lebenden Tierkörpern. Sie erinnert die Kreuzigung als eine Marktszene, eine lärmende Menge, die mit Alltäglichem beschäftigt ist wie auf einem Gemälde Tintorettos, von dem sich Tóibín inspirieren ließ. Von Jesus Tod scheinen hier alle Seiten zu profitieren:
"Ich versuchte, sein Gesicht zu sehen, während er vor Schmerzen schrie, aber es war so qualvoll verzerrt und mit Blut besudelt, dass ich niemanden sah, den ich gekannt hätte. Es war die Stimme, die ich wiedererkannte, die Geräusche, die er machte, die ausschließlich ihm gehörten. Ich stand da und blickte umher. Es spielten sich auch andere Dinge ab – Pferde wurden beschlagen und gefüttert, Spiele wurden gespielt, Beleidigungen und Scherzworte ausgesprochen und Küchenfeuer entzündet, deren Rauch aufstieg und über den ganzen Hügel wehte. Es ist vielleicht heute schwer zu begreifen, dass ich nicht zu ihm hinrannte oder ihm etwas zurief. Aber ich tat's nicht. Ich starrte voller Grauen hinüber, aber ich rührte mich nicht von der Stelle und gab keinen Laut."
Erzählungen schaffen Wirklichkeit
Widersprüchliche Erinnerungen passen nicht in eine Erzählung, in der sich alles auf Jesus Leiden konzentrieren soll und auf die Erlösung durch den Gottessohn. Was nicht passt, wird gestrichen oder gefälscht. Nicht zuletzt handelt "Marias Testament" auch davon, wie das Erzählen Wirklichkeit schafft. Und wie ein Ereignis im Dienste einer höheren Idee zu einer zweckdienlich verfälschten Fiktion gerät, die künftig als die Wahrheit gilt. Den Auferstehungstraum Marias wird der Apostel Johannes in eine Wirklichkeit überführen, in der er den Zweck hat, Jesus Gotthaftigkeit zu beweisen. Denn, so sagte Tóibín in einem Interview, Johannes mag irgendwann die Idee gekommen sein, dass eine Geschichte ohne eine Mutter, die ihren toten Sohn beweint und vom Kreuz nimmt, weniger eindrucksvoll geraten könnte, der Mythos zu kraftlos als Grundlage für eine ganze Religion. Johannes, so Tóibín, kannte sich mit griechischem Theater aus, er wird gewusst haben, wie man eindrucksvolle Inszenierungen schafft. Maria dagegen treibt die Bedrängnis durch ihre Wächter in eine geradezu moderne Sprachkritik hinein, die das Potenzial der Verfälschung schon in den Worten angelegt sieht. Der Gebrauch von Worten verändert, verschleiert, verschiebt die Fakten bis hin zu einer verfälschenden Sichtweise, der Maria allerdings in ihrem Bedürfnis nach Trost selbst zu erliegen fürchtet:
"Ich weiß nicht, warum es von Belang sein sollte, dass die Wahrheit wenigstens ein Mal in der Welt ausgesprochen wird. Denn die Welt ist ein Ort des Schweigens, der Himmel ist nachts, wenn die Vögel verschwunden sind, ein einziger schweigender Ort. Worte werden am Himmel der Nacht nicht das mindeste ändern. Sie werden ihn nicht erhellen oder weniger fremd machen. Und auch der Tag hegt seine eigene tiefe Gleichgültigkeit gegen alles Gesagte. Ich sage nicht deswegen die Wahrheit, weil sie die Nacht zum Tage machen kann oder die Tage in ihrer Schönheit tröstend für uns dehnt, die wir alt sind. Ich spreche einfach deswegen, weil ich es kann, weil genug geschehen ist und weil die Gelegenheit dazu vielleicht nie wiederkommen wird. Nicht mehr lange vielleicht, und ich werde wieder anfangen zu träumen, dass ich an dem Tag auf dem Hügel warte und ihn, den Nackten, in den Armen hielt, nicht mehr lange, und dieser Traum wird die Luft erfüllen und rückwärts reisen durch die Zeit und so zu dem werden, was geschah, oder was gesehen sein muss – was geschah, was ich als geschehen weiß, was ich geschehen sah."
"Marias Testament" ist ein überraschend heutiges Buch, ohne sich der Gegenwart anzubiedern. Alles Dekorative ist diesem Text fremd. Mit wenigen Details skizziert Tóibín die Szenerien und konzentriert sich dabei ganz auf die Gedanken seiner Hauptfigur. Dass Maria Schuhe trägt, statt Sandalen, ist beinahe das einzige subtile literarische Mittel, mit dem Tóibín Maria äußerlich in die heutige Zeit versetzt. Gleichzeitig vermeidet er jedes historisierende Ausmalen. Über eine scheinbar schlichte, jedoch hochlyrische Sprache, die von Giovanni und Ditte Bandini auf beeindruckende Weise ins Deutsche gebracht wurde, gelingt ihm eine Zeitlosigkeit, die die Novelle zu weitaus mehr macht als bloß einer weiteren Lesart der biblischen Erzählung. Es geht um die Ohnmacht des Einzelnen vor der Übermacht einer Ideologie oder vor fanatisch in die Welt gebrachten, sogenannten höheren Idealen. Gerade weil Tóibín so nah an seiner Figur bleibt und die bis zum Überdruss erzählte Geschichte aufs Allerwesentlichste entkernt, wird der Text lesbar auf grundsätzliche gesellschaftliche Mechanismen, durch die das Subjekt zugunsten einer gesichtslosen Mehrheit geopfert wird, sei es im Namen eines höheren Guten, einer besseren Gesellschaft oder eines zukünftigen Erlösungsversprechens.
Utopistische Ideale sind Produkte eines männlichen Denkens
Das gesamte 20. Jahrhundert mit seinen mörderischen Ideologien und kollektivistischen Denkweisen klingt in diesem schmalen Buch an, ebenso wie die jüngere, von Terrorismus und religiösem Fanatismus geprägte Zeit. Interessant ist auch die Deutlichkeit, mit der Tóibín utopistische Ideale oder fanatische Ideen als Produkte eines männlichen Denkens herausstellt und das Töten als männlichen Akt zeigt, dem die Sprache jede Art von Legitimation verleihen kann. "Marias Testament" ist bevölkert von Männern, die manipulieren und morden, Männern, die zu fanatischen Anhängern werden, Männern, die sich selbstüberhöhend an Gottes Stelle setzen, Männern schließlich, die den passenden Text produzieren, also die Deutungshoheit beanspruchen und darüber ihre Machtstellung sichern. Die beiden Männer, die Maria bewachen, wirken unter diesen Vorzeichen wie Gefängniswärter, wie Hüter scheinbar unumstößlicher gesellschaftlicher Gesetze. Sie könnten auch Aufseher in Guantanamo sein, Menschenhändler oder Schergen der Stasi. Die Situation selbst erinnert an ein Verhör und was geschieht, an eine Gehirnwäsche, die an Maria vollzogen werden soll:
"Ich stand vom Stuhl auf und entfernte mich von ihnen, als hätten ihre Worte mir Gewalt angetan.
'Er starb, um die Welt zu erlösen', sagte der andere. 'Sein Tod hat die Menschheit vor der Finsternis und der Sünde gerettet. Sein Vater hat ihn in die Welt gesandt, auf dass er am Kreuze leiden möchte.'
'Sein Vater?', fragte ich. 'Sein Vater?'
'Sein Leiden war notwendig', unterbrach er. 'Genauso würde die Menschheit errettet werden.'
'Errettet?', fragte ich und hob die Stimme. 'Wer wurde errettet?'
'Jene, die vor ihm kamen, und jene, die jetzt leben, und jene, die noch nicht geboren sind', sagte er.
'Vor dem Tod gerettet?', fragte ich.
'Für das ewige Leben errettet', sagte er. 'Jeder Mensch auf Erden wird das ewige Leben erfahren.'
'Achso, das ewige Leben!', erwiderte ich. 'Achso, jeder Mensch auf Erden!' Ich sah sie beide an, und ihre Blicke waren verschleiert, und etwas Dunkles erschien in ihren Gesichtern. 'Das war also der Sinn des Ganzen?'
Sie tauschten einen kurzen Blick, und zum ersten Mal spürte ich die Maßlosigkeit ihres Ehrgeizes und die Unschuld ihres Glaubens.
'Wer sonst weiß das noch?'
'Es wird kundwerden', sagte einer von ihnen."
'Er starb, um die Welt zu erlösen', sagte der andere. 'Sein Tod hat die Menschheit vor der Finsternis und der Sünde gerettet. Sein Vater hat ihn in die Welt gesandt, auf dass er am Kreuze leiden möchte.'
'Sein Vater?', fragte ich. 'Sein Vater?'
'Sein Leiden war notwendig', unterbrach er. 'Genauso würde die Menschheit errettet werden.'
'Errettet?', fragte ich und hob die Stimme. 'Wer wurde errettet?'
'Jene, die vor ihm kamen, und jene, die jetzt leben, und jene, die noch nicht geboren sind', sagte er.
'Vor dem Tod gerettet?', fragte ich.
'Für das ewige Leben errettet', sagte er. 'Jeder Mensch auf Erden wird das ewige Leben erfahren.'
'Achso, das ewige Leben!', erwiderte ich. 'Achso, jeder Mensch auf Erden!' Ich sah sie beide an, und ihre Blicke waren verschleiert, und etwas Dunkles erschien in ihren Gesichtern. 'Das war also der Sinn des Ganzen?'
Sie tauschten einen kurzen Blick, und zum ersten Mal spürte ich die Maßlosigkeit ihres Ehrgeizes und die Unschuld ihres Glaubens.
'Wer sonst weiß das noch?'
'Es wird kundwerden', sagte einer von ihnen."
Am Ende betet Maria nicht zum jüdischen Gott Jahwe, sondern zu Artemis, der vielbrüstigen Göttin der Jagd und der Fruchtbarkeit. Artemis ist niemandes Mutter. Diese Hinwendung Marias zur griechischen Gottheit liest sich wie eine Abkehr vom monotheistischen Glauben und gleichermaßen wie eine Abkehr von einem Familienmodell, das Geschlechterrollen und patriarchale Strukturen zementiert. Mit "Marias Testament" hat Tóibín ein großes Buch geschrieben über das Verschwinden des Einzelnen hinter dem übermächtigen Text einer kollektiven Einbildung. "Das war es nicht wert", ist das Fazit, das Tóibín Maria am Schluss ziehen lässt:
"Wenn ihr sagt, dass er die Welt erlöst hat, dann sage ich, dass es das nicht wert war."
Colm Tóibín: "Marias Testament"
Hanser Verlag, 127 Seiten, 14,90 Euro.
Hanser Verlag, 127 Seiten, 14,90 Euro.