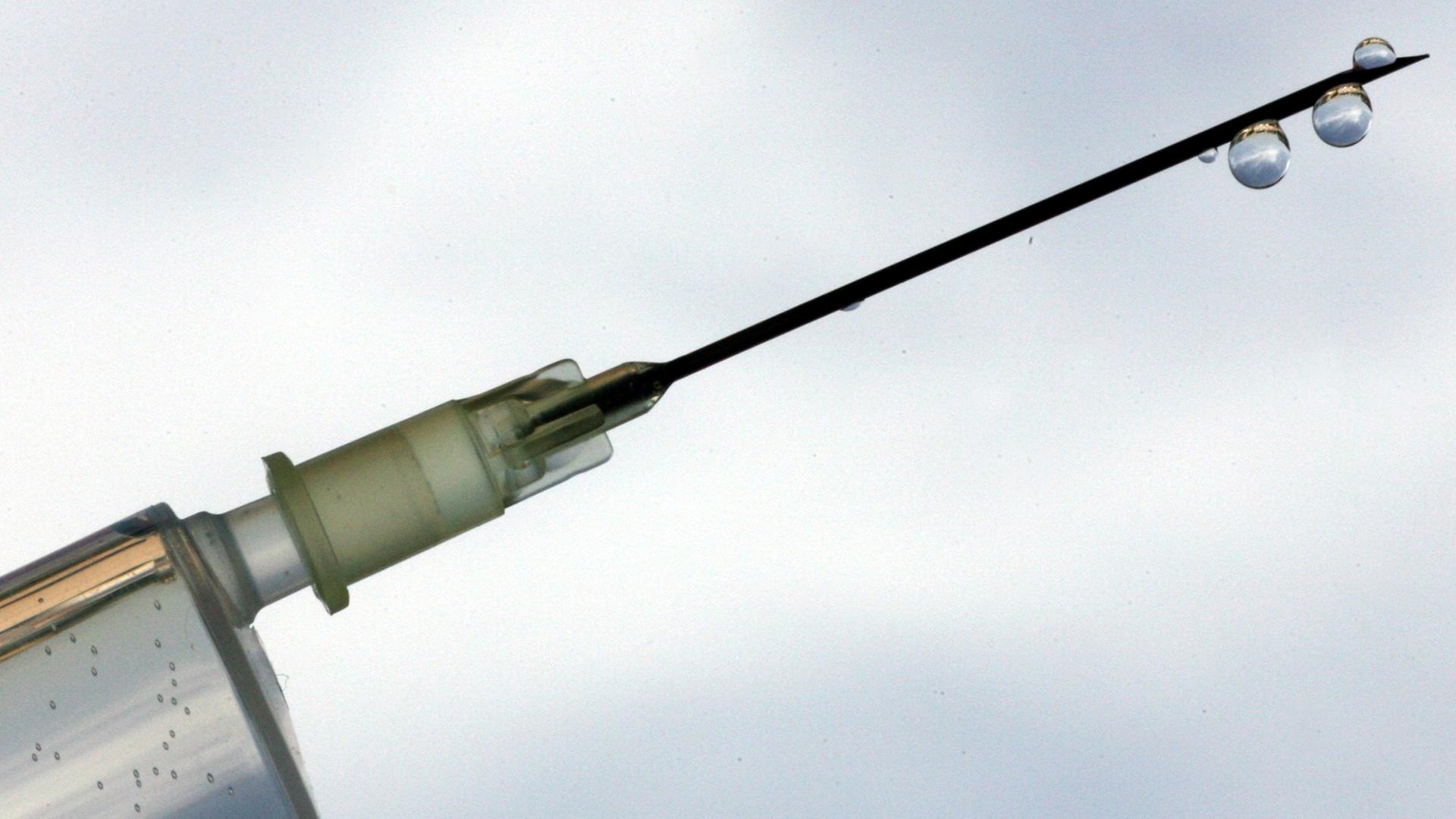"Ich bin überzeugt, dass wir in Westeuropa kein flächendeckendes Doping haben." Der Schweizer Matthias Kamber sieht den Antidoping-Kampf auf einem guten Weg. Er nimmt einen Mentalitätswechsel zu früheren Zeiten wahr - beispielsweise im Radsport: "Man musste dopen, um dazuzugehören. Man musste dopen, um an Titel zu kommen."
Im Kampf gegen das Doping seien auch investigative Journalistinnen und Journalisten hilfreich. Vielfach würden Athleten ihnen vertrauen und von Dopingvergehen erzählen.
Der Fall des russischen Staatsdopings habe im Vorgehen gegen das Doping aber für ein Glaubwürdigkeitsproblem gesorgt. Das mangelnde Durchgreifen der Organe des Sports, wie des IOC, sei ein "Armutszeugnis", so Kamber: "Da hat die Glaubwürdigkeit schon einen massiven Knacks bekommen. Das kann man nicht leugnen." Der Fall Russland wäre aus Kambers Sicht eine Gelegenheit gewesen, um Reformen im Antidoping-Kampf anzugehen, etwa bei der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA.
Am Beispiel des Schweizer Handballers Simon Getzmann sehe man, dass es sensiblere Regeln für das Nachweisen von Doping brauche. Getzmann war positiv getestet worden. In einem aufwändigen Verfahren konnte er nachweisen, dass ein verunreinigtes Schmerzmittel für den positiven Befund verantwortlich war.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Das Dlf-Sportgespräch zum Fall Simon Getzmann:
Sportbetrug Der Doper, der keiner war