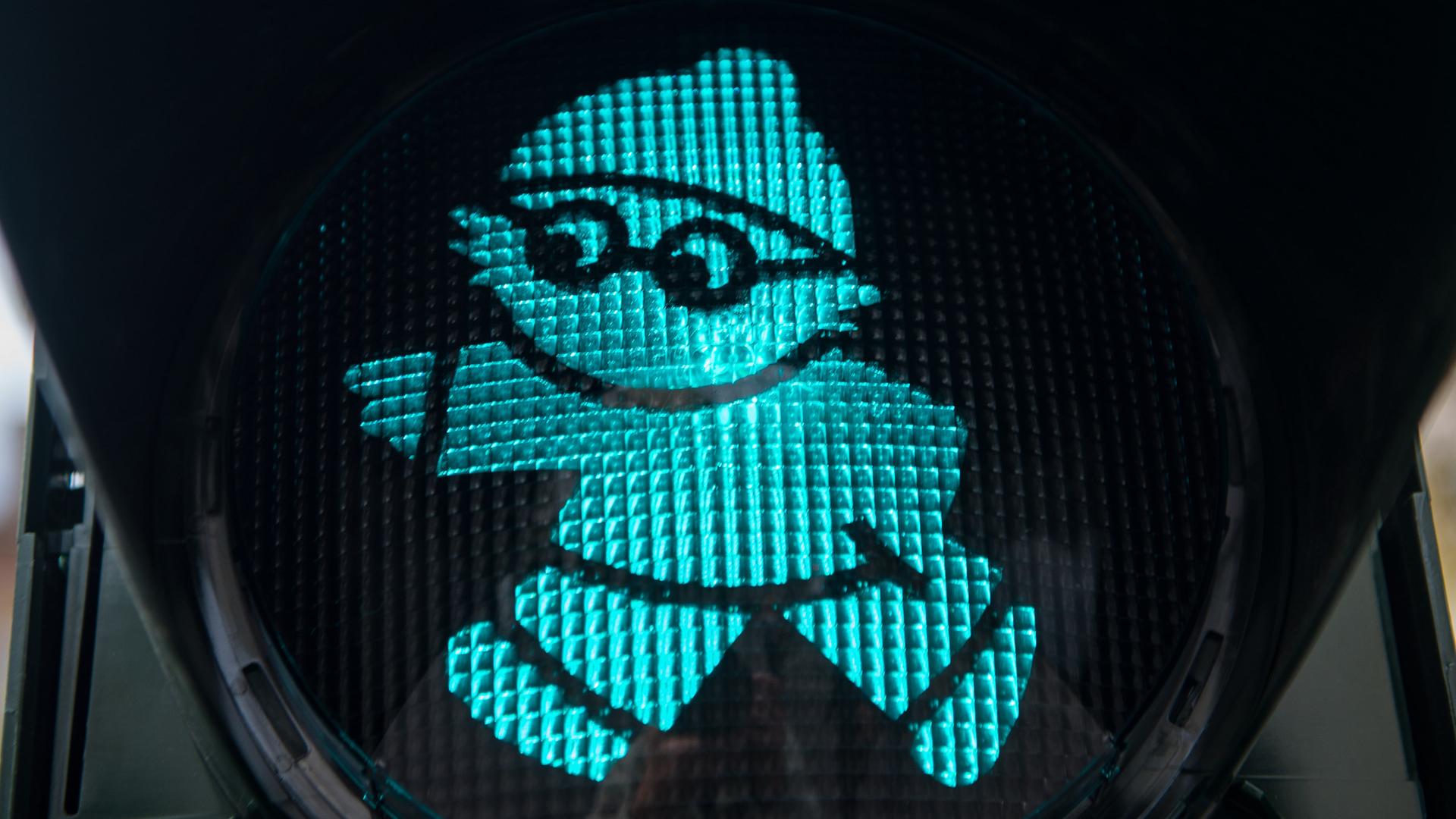Sie war groß angekündigt worden, diese Rede. Und so zählte sie an jenem 26. April 1997 zu den Hauptthemen der Berichterstattung in Deutschland:
„Im wiederaufgebauten Traditionshotel Adlon hat Bundespräsident Roman Herzog vor kurzem mit seiner mit Spannung erwarteten Berliner Rede begonnen, die bereits im Vorfeld als eine Art Ansprache zur Lage der Nation bezeichnet worden ist.“
Herzog: „Was ist los mit unserem Land? Im Klartext: Der Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft, eine unglaubliche mentale Depression – das sind die Stichworte der Krise. Sie bilden einen allgegenwärtigen Dreiklang, aber einen Dreiklang, aber in Moll.“
„Im wiederaufgebauten Traditionshotel Adlon hat Bundespräsident Roman Herzog vor kurzem mit seiner mit Spannung erwarteten Berliner Rede begonnen, die bereits im Vorfeld als eine Art Ansprache zur Lage der Nation bezeichnet worden ist.“
Herzog: „Was ist los mit unserem Land? Im Klartext: Der Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft, eine unglaubliche mentale Depression – das sind die Stichworte der Krise. Sie bilden einen allgegenwärtigen Dreiklang, aber einen Dreiklang, aber in Moll.“
Roman Herzog, seit Mai 1994 Bundespräsident, zuvor lange Jahre Präsident des Bundesverfassungsgerichts – er hatte Deutschlands Wirtschaftsentwicklung mit wachsendem Unbehagen verfolgt: Fast 4,4 Millionen Menschen waren arbeitslos, weitere drei Millionen bekamen Sozialhilfe. Wohl wuchs die Volkswirtschaft real immer noch, aber der Bundespräsident wollte die Deutschen aufrütteln.
Der Politikprofessor Stefan Marschall von der Universität Düsseldorf.
„Wenn man sich die Rede anschaut, dann fällt schon auf, dass da eine sehr starke Dramatisierung zu finden ist. Aus der Perspektive von heute würde man vielleicht noch mal einiges anders sehen.“
Der Politikprofessor Stefan Marschall von der Universität Düsseldorf.
„Wenn man sich die Rede anschaut, dann fällt schon auf, dass da eine sehr starke Dramatisierung zu finden ist. Aus der Perspektive von heute würde man vielleicht noch mal einiges anders sehen.“
Mehr Innovationsfähigkeit, weniger Arbeitslosigkeit gefordert
Viele der Themen, die 1997 auf den Nägeln brannten, sind heute in den Hintergrund gerückt, auch Herzogs Kernthese:
„Innovationsfähigkeit fängt im Kopf an, bei unserer Einstellung etwa zu neuen Techniken, zu neuen Arbeits- und Ausbildungsformen, bei unserer Haltung zur Veränderung schlechthin.“
„Innovationsfähigkeit fängt im Kopf an, bei unserer Einstellung etwa zu neuen Techniken, zu neuen Arbeits- und Ausbildungsformen, bei unserer Haltung zur Veränderung schlechthin.“
Niemand konnte überhören, dass der Bundespräsident liberal dachte. Der Wirtschaftsprofessor Christian Hagist von der Otto Beisheim School of Management, einer Hochschule für Unternehmensführung in Vallendar bei Koblenz:
„Seine Leitlinie ist doch die der Subsidiarität, eines der grundlegenden Leitmotive der Sozialen Marktwirtschaft, dass eben dort, wo der einzelne für sich selbst sorgen kann, er das auch tun soll, und erst wenn das nicht mehr geht, die Gemeinschaft eben auch eintritt. Also, hier sehe ich klares ordnungspolitisches Denken und sehe das in einer guten Tradition der Geschichte der Bundesrepublik und eben auch der Wirtschaftswissenschaften in der Bundesrepublik.“
Subsidiarität hatte sich 1997 auch die christlich-liberale Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben. Kanzler Helmut Kohl gab sich zuversichtlich: Bis ins Jahr 2000 könne man die Arbeitslosenzahlen auf 2,2 Millionen halbieren.
„Ich glaube, wir haben Chancen, das Ziel zu erreichen, wir haben positive Perspektiven zu Beginn des Jahres ’97, die Konjunkturentwicklung steht nach meiner festen Überzeugung auf Aufschwung, die Schwächephase ‘96 ist überwunden.“
„Der Kanzler ist ja ein optimistisches Gemüt von Natur aus.“
Kommentierte der Politologe Arnulf Baring im Deutschlandfunk zwei Tage nach der Herzog-Rede.
„Und hat ja auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass die meisten Probleme, wenn man sie aussitzt auch von selber wieder verschwinden. Ich glaube, dass er sich täuscht, was die gegenwärtige Situation angeht, und seit langem täuscht. Aber ich sehe auch nicht, dass die Opposition das könnte. Im Grunde ist doch das Selbstgefühl des Landes auf einen Zustand fixiert, auf einen Konsens fixiert, der in der Wirklichkeit keine Basis mehr hat, nämlich: auf die Entschlossenheit, einen Sozialstaat zu unterhalten, für den inzwischen die Mittel fehlen.“
„Seine Leitlinie ist doch die der Subsidiarität, eines der grundlegenden Leitmotive der Sozialen Marktwirtschaft, dass eben dort, wo der einzelne für sich selbst sorgen kann, er das auch tun soll, und erst wenn das nicht mehr geht, die Gemeinschaft eben auch eintritt. Also, hier sehe ich klares ordnungspolitisches Denken und sehe das in einer guten Tradition der Geschichte der Bundesrepublik und eben auch der Wirtschaftswissenschaften in der Bundesrepublik.“
Subsidiarität hatte sich 1997 auch die christlich-liberale Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben. Kanzler Helmut Kohl gab sich zuversichtlich: Bis ins Jahr 2000 könne man die Arbeitslosenzahlen auf 2,2 Millionen halbieren.
„Ich glaube, wir haben Chancen, das Ziel zu erreichen, wir haben positive Perspektiven zu Beginn des Jahres ’97, die Konjunkturentwicklung steht nach meiner festen Überzeugung auf Aufschwung, die Schwächephase ‘96 ist überwunden.“
„Der Kanzler ist ja ein optimistisches Gemüt von Natur aus.“
Kommentierte der Politologe Arnulf Baring im Deutschlandfunk zwei Tage nach der Herzog-Rede.
„Und hat ja auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass die meisten Probleme, wenn man sie aussitzt auch von selber wieder verschwinden. Ich glaube, dass er sich täuscht, was die gegenwärtige Situation angeht, und seit langem täuscht. Aber ich sehe auch nicht, dass die Opposition das könnte. Im Grunde ist doch das Selbstgefühl des Landes auf einen Zustand fixiert, auf einen Konsens fixiert, der in der Wirklichkeit keine Basis mehr hat, nämlich: auf die Entschlossenheit, einen Sozialstaat zu unterhalten, für den inzwischen die Mittel fehlen.“
Wiedervereinigung kostete Milliarden
Dieser Sozialstaat ächzte nicht zuletzt unter den Milliardenkosten, die die Wiedervereinigung verursacht hatte. Um das System intakt zu halten, hatte man die Lohnnebenkosten steigern müssen, damit aber wurde Arbeit zu teuer, und immer mehr Unternehmen wanderten ins Ausland ab. Der damalige SPD-Chef Oskar Lafontaine.
„Ich appelliere also noch einmal, innerhalb kürzester Frist zu sagen: Wir senken die gesetzlichen Lohnnebenkosten um zwei Punkte. Die Vorschläge, die dazu gemacht worden sind, sind ja bekannt, und man kann sich innerhalb kürzester Frist darauf verständigen.“
Oskar Lafontaine führte die SPD seit 1995. Die Sozialdemokraten konnten sich auf eine stabile Mehrheit im Bundesrat stützen, und das Kabinett Kohl auf der anderen Seite zeigte nach fünfzehn Jahren deutliche Verschleißerscheinungen. Was von dort noch an Ideen kam – der Bundesrat bremste es oft aus. Und so platzte FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle im Parlament der Kragen.
„Hier werden parteipolitische Ziele verfolgt, aber nicht der Rechtsstaat vertreten, der SPD geht es nicht um die Kumpel, es geht ihr um die nächsten Wahlen in diesem Lande. Und der Demagoge Oskar Lafontaine zündet das Land an und beklagt anschließend, dass es brennt.“
„Ich appelliere also noch einmal, innerhalb kürzester Frist zu sagen: Wir senken die gesetzlichen Lohnnebenkosten um zwei Punkte. Die Vorschläge, die dazu gemacht worden sind, sind ja bekannt, und man kann sich innerhalb kürzester Frist darauf verständigen.“
Oskar Lafontaine führte die SPD seit 1995. Die Sozialdemokraten konnten sich auf eine stabile Mehrheit im Bundesrat stützen, und das Kabinett Kohl auf der anderen Seite zeigte nach fünfzehn Jahren deutliche Verschleißerscheinungen. Was von dort noch an Ideen kam – der Bundesrat bremste es oft aus. Und so platzte FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle im Parlament der Kragen.
„Hier werden parteipolitische Ziele verfolgt, aber nicht der Rechtsstaat vertreten, der SPD geht es nicht um die Kumpel, es geht ihr um die nächsten Wahlen in diesem Lande. Und der Demagoge Oskar Lafontaine zündet das Land an und beklagt anschließend, dass es brennt.“
Reformstau bei Renten, Lohnnebenkosten, Steuern
CDU-Fraktionschef Wolfgang Schäuble allerdings versuchte zu Anfang des Jahres 1997, Erfolge hervorzuheben.
„Wenn Sie jetzt von dieser Pressekonferenz berichten, ich hätte die Botschaft gesagt, die SPD ist schuld am Reformstau – dann waren wir in unterschiedlichen Sälen. Meine Botschaft ist: Es gibt keinen Reformstau, wir haben das allermeiste von dem, was im Januar ‘96 mit Wirtschaft und Gewerkschaften verabredet worden ist, inzwischen umgesetzt. Und es wird auch in nächster Zeit…ich sage Ihnen: Krankenkassenreform kommt, Rentenreform kommt, Gewerbekapitalsteuer wird abgeschafft, dann haben wir alle Substanzsteuern weg.“
Eines allerdings konnte Schäuble nicht vergessen machen: Eine geistige Lähmung hatte sich wie Mehltau über das Land gelegt. Man sah Länder wie die USA oder Frankreich Reformen umsetzen, das Wachstum ihrer Volkswirtschaften zog wieder an. Auch daran erinnerte Roman Herzog 1997 – und er wählte jene Worte, die über den Tag hinaus im Gedächtnis blieben:
„Auch wir müssen hinein in die Zukunftstechnologien, in die Biotechnik, in die Informationstechnologie. Ein großes, globales Rennen hat begonnen, die Welt ist im Aufbruch, sie wartet nicht auf Deutschland. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen! Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger – aber es müssen auch alle mitmachen.“
Die Angesprochenen allerdings reagierten, wie man es nicht unbedingt erwartet hätte. So schilderte der Bonner Korrespondent Rüdiger Paulert:
„So recht fühlte sich in Bonn durch den Appell des Bundespräsidenten heute wohl niemand gemeint. Vielleicht nicht gerade typisch, aber doch irgendwie bezeichnend: die Worte des Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe Michael Glos. Er habe die Rede zwar nicht gelesen, erklärte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Schäuble, aber die Kommentare zur Rede zeigten ihm, dass er sich nicht betroffen fühlen müsse. Zumindest nicht so betroffen wie andere, schob er noch nach.“
Und auch Glos‘ Koalitionspartner, FDP-Chef Wolfgang Gerhardt, lehnte sich vor der Presse zurück:
„Wir haben Themen, die er angesprochen hat, schon seit Wochen in der FDP benannt, wir haben die Reformvorhaben insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland als genauso dringlich bezeichnet, und wir fühlen uns auf unserem Kurs auch durch nahezu wörtliche Ausführungen, die er gemacht hat, gestützt.“
„Wenn Sie jetzt von dieser Pressekonferenz berichten, ich hätte die Botschaft gesagt, die SPD ist schuld am Reformstau – dann waren wir in unterschiedlichen Sälen. Meine Botschaft ist: Es gibt keinen Reformstau, wir haben das allermeiste von dem, was im Januar ‘96 mit Wirtschaft und Gewerkschaften verabredet worden ist, inzwischen umgesetzt. Und es wird auch in nächster Zeit…ich sage Ihnen: Krankenkassenreform kommt, Rentenreform kommt, Gewerbekapitalsteuer wird abgeschafft, dann haben wir alle Substanzsteuern weg.“
Eines allerdings konnte Schäuble nicht vergessen machen: Eine geistige Lähmung hatte sich wie Mehltau über das Land gelegt. Man sah Länder wie die USA oder Frankreich Reformen umsetzen, das Wachstum ihrer Volkswirtschaften zog wieder an. Auch daran erinnerte Roman Herzog 1997 – und er wählte jene Worte, die über den Tag hinaus im Gedächtnis blieben:
„Auch wir müssen hinein in die Zukunftstechnologien, in die Biotechnik, in die Informationstechnologie. Ein großes, globales Rennen hat begonnen, die Welt ist im Aufbruch, sie wartet nicht auf Deutschland. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen! Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger – aber es müssen auch alle mitmachen.“
Die Angesprochenen allerdings reagierten, wie man es nicht unbedingt erwartet hätte. So schilderte der Bonner Korrespondent Rüdiger Paulert:
„So recht fühlte sich in Bonn durch den Appell des Bundespräsidenten heute wohl niemand gemeint. Vielleicht nicht gerade typisch, aber doch irgendwie bezeichnend: die Worte des Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe Michael Glos. Er habe die Rede zwar nicht gelesen, erklärte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Schäuble, aber die Kommentare zur Rede zeigten ihm, dass er sich nicht betroffen fühlen müsse. Zumindest nicht so betroffen wie andere, schob er noch nach.“
Und auch Glos‘ Koalitionspartner, FDP-Chef Wolfgang Gerhardt, lehnte sich vor der Presse zurück:
„Wir haben Themen, die er angesprochen hat, schon seit Wochen in der FDP benannt, wir haben die Reformvorhaben insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland als genauso dringlich bezeichnet, und wir fühlen uns auf unserem Kurs auch durch nahezu wörtliche Ausführungen, die er gemacht hat, gestützt.“
Die Globalisierung schon vor Augen
In der Tat hatte Herzog in seiner Vision eines Deutschlands im Jahre 2020 klassische liberale Ideale proklamiert: Selbständigkeit und Selbstverantwortung der Menschen, lebenslanges Lernen, einen flexibilisierten Arbeitsmarkt. Vor Augen hatte Herzog ein Phänomen, das erst seit ein paar Jahren wirklich breit diskutiert wurde: die Globalisierung. Der Politikwissenschaftler Stefan Marschall:
„Wir haben in den 90er Jahren ja die besondere Situation, dass es so schien, als ob sich das westliche Modell, auch das Modell der Marktwirtschaft global durchgesetzt hätte. Dass wir alle in Freiheit, Frieden und unter den Idealen der westlichen Demokratie leben, dass wir alle Teil einer großen Marktwirtschaft sind, die nur noch global gedacht werden kann.“
Viele allerdings empfanden diese Globalisierung schon 1997 als bedrohlich. Herzog freilich fand seine eigene Antwort: „Wir müssen unsere Jugend auf die Freiheit vorbereiten, auf die Freude der Freiheit. Ich bin überzeugt, dass die Idee der Freiheit die Kraftquelle ist, nach der wir suchen. Die Kraftquelle, die uns helfen wird, den Modernisierungsstau zu überwinden und unsere Wirtschaft und Gesellschaft wieder in Bewegung zu bringen.“
„Wir haben in den 90er Jahren ja die besondere Situation, dass es so schien, als ob sich das westliche Modell, auch das Modell der Marktwirtschaft global durchgesetzt hätte. Dass wir alle in Freiheit, Frieden und unter den Idealen der westlichen Demokratie leben, dass wir alle Teil einer großen Marktwirtschaft sind, die nur noch global gedacht werden kann.“
Viele allerdings empfanden diese Globalisierung schon 1997 als bedrohlich. Herzog freilich fand seine eigene Antwort: „Wir müssen unsere Jugend auf die Freiheit vorbereiten, auf die Freude der Freiheit. Ich bin überzeugt, dass die Idee der Freiheit die Kraftquelle ist, nach der wir suchen. Die Kraftquelle, die uns helfen wird, den Modernisierungsstau zu überwinden und unsere Wirtschaft und Gesellschaft wieder in Bewegung zu bringen.“
Zielvorstellung: zurück zur Vollbeschäftigung
Für den Bundespräsidenten war also Angriff die beste Verteidigung. Ökonom Christian Hagist kann der Herzog-Rede im Ganzen vieles abgewinnen.
„Er hat durchaus richtige Vorhersagen gemacht. Man nehme nur was er beispielsweise sagt über das Informationszeitalter, in dem wir uns jetzt sicherlich alle irgendwo befinden. Er hat, glaube ich, auch richtige Finger in Wunden gelegt wie beispielsweise Bürokratieabbau, der, glaube ich, immer noch ein Riesen-Reformprojekt ist, aber auch eben damals schon war. Er hat auch die Lage richtig beschrieben, die wir heute immer noch haben, dass Unternehmertum, Risikofreudigkeit in Deutschland vielleicht etwas unterausgeprägt sind im Vergleich zu anderen Nationen.“
Auch für Solidarität hatte Herzog plädiert, aber das ging ein wenig unter. Vielmehr müssten Subventionen gekürzt werden, die Löhne dürften nicht mehr so schnell steigen, die öffentliche Verwaltung müsse endlich sparen. Wenn Deutschland aber sein Potential ausspiele, dann könne es sogar wieder Vollbeschäftigung erreichen.
Offenbar wollten viele Deutsche genau das hören. Das Bundespräsidialamt meldete nach einigen Wochen den Eingang von viertausend Briefen zur Rede. Ihr Text wurde fünfzigtausendmal angefordert und – damals noch beachtlich – 26.000 Mal im Internet abgerufen. Gerade einmal zwei Prozent der Zuschriften seien kritisch ausgefallen, bilanzierte das Präsidialamt.
Massive Kritik allerdings war von anderer Seite gekommen: von den Kirchen. Der katholische Limburger Bischof Franz Kamphaus vor Journalisten in Frankfurt:
„Es ist von Solidarität die Rede, aber die Frage ist, was Solidarität heißt. Solidarität kann ja nie nur eine Sache der Starken untereinander sein, sondern Solidarität hat ihre Nagelprobe gerade da, wie sie‘s mit den Armen und Schwachen hält. Wenn man die nicht im Blick hat, dann sollte man diese hehren Begriffe lieber gar nicht in den Mund nehmen.“
„Er hat durchaus richtige Vorhersagen gemacht. Man nehme nur was er beispielsweise sagt über das Informationszeitalter, in dem wir uns jetzt sicherlich alle irgendwo befinden. Er hat, glaube ich, auch richtige Finger in Wunden gelegt wie beispielsweise Bürokratieabbau, der, glaube ich, immer noch ein Riesen-Reformprojekt ist, aber auch eben damals schon war. Er hat auch die Lage richtig beschrieben, die wir heute immer noch haben, dass Unternehmertum, Risikofreudigkeit in Deutschland vielleicht etwas unterausgeprägt sind im Vergleich zu anderen Nationen.“
Auch für Solidarität hatte Herzog plädiert, aber das ging ein wenig unter. Vielmehr müssten Subventionen gekürzt werden, die Löhne dürften nicht mehr so schnell steigen, die öffentliche Verwaltung müsse endlich sparen. Wenn Deutschland aber sein Potential ausspiele, dann könne es sogar wieder Vollbeschäftigung erreichen.
Offenbar wollten viele Deutsche genau das hören. Das Bundespräsidialamt meldete nach einigen Wochen den Eingang von viertausend Briefen zur Rede. Ihr Text wurde fünfzigtausendmal angefordert und – damals noch beachtlich – 26.000 Mal im Internet abgerufen. Gerade einmal zwei Prozent der Zuschriften seien kritisch ausgefallen, bilanzierte das Präsidialamt.
Massive Kritik allerdings war von anderer Seite gekommen: von den Kirchen. Der katholische Limburger Bischof Franz Kamphaus vor Journalisten in Frankfurt:
„Es ist von Solidarität die Rede, aber die Frage ist, was Solidarität heißt. Solidarität kann ja nie nur eine Sache der Starken untereinander sein, sondern Solidarität hat ihre Nagelprobe gerade da, wie sie‘s mit den Armen und Schwachen hält. Wenn man die nicht im Blick hat, dann sollte man diese hehren Begriffe lieber gar nicht in den Mund nehmen.“
Mensch und Wirtschaft, durch den Staat gefesselt
In der Tat erschienen jene Armen und Schwachen in Herzogs Rede vorwiegend als Menschen, die eben nur ihre Einstellung ändern mussten, damit es auch bei ihnen lief. Das galt für die Einzelperson, es galt aber auch für Deutschland als Akteur in der Weltwirtschaft.
Stefan Marschall von der Universität Düsseldorf: „Globalisierung wird hier als Chance begriffen, nicht so sehr als Gefahr, höchstens als Gefahr, wenn man nicht bei ihr mitmacht und dann außen vor bleibt. Was sich dort auch als Motiv immer wieder findet, ist die Idee der Entfesselung. Diese Idee sagt letzten Endes, dass der Staat in vieler Hinsicht kein Beschleuniger ist, sondern die Menschen, die Wirtschaft aber auch die Individuen insgesamt eher beeinträchtigt und fesselt.“
Wer vor dieser liberalen Sicht warnte, der hatte in den 90er Jahren einen schweren Stand. Zu den Warnern zählte der CDU-Politiker Heiner Geißler, hier in einem Deutschlandfunk-Interview kurz nach der Herzog-Rede.
„Wie kann man der Globalisierung der Wirtschaft, die ja unaufhaltsam ist und die auch notwendig ist, dennoch ein Konzept entgegenstellen, das die soziale Frage richtig beantwortet? Nur Phantasten können ja glauben, man könne auf die Dauer Millionen Menschen sozial ausgrenzen, ohne dafür einen politischen Preis bezahlen zu müssen. Es gibt in der Demokratie keine überflüssigen Menschen. Die haben alle eine Stimme, und sie werden die Stimme nutzen.“
Stefan Marschall von der Universität Düsseldorf: „Globalisierung wird hier als Chance begriffen, nicht so sehr als Gefahr, höchstens als Gefahr, wenn man nicht bei ihr mitmacht und dann außen vor bleibt. Was sich dort auch als Motiv immer wieder findet, ist die Idee der Entfesselung. Diese Idee sagt letzten Endes, dass der Staat in vieler Hinsicht kein Beschleuniger ist, sondern die Menschen, die Wirtschaft aber auch die Individuen insgesamt eher beeinträchtigt und fesselt.“
Wer vor dieser liberalen Sicht warnte, der hatte in den 90er Jahren einen schweren Stand. Zu den Warnern zählte der CDU-Politiker Heiner Geißler, hier in einem Deutschlandfunk-Interview kurz nach der Herzog-Rede.
„Wie kann man der Globalisierung der Wirtschaft, die ja unaufhaltsam ist und die auch notwendig ist, dennoch ein Konzept entgegenstellen, das die soziale Frage richtig beantwortet? Nur Phantasten können ja glauben, man könne auf die Dauer Millionen Menschen sozial ausgrenzen, ohne dafür einen politischen Preis bezahlen zu müssen. Es gibt in der Demokratie keine überflüssigen Menschen. Die haben alle eine Stimme, und sie werden die Stimme nutzen.“
Arbeitsmarkt-Reformen unter der Schröder-Regierung
15 Jahre später gründete sich die AfD, noch ein paar Jahre später machte Pegida in Deutschland, machten die Gelbwesten in Frankreich mobil. Und die US-Republikaner begannen, auf der protektionistischen Welle zu reiten. Während Soziologen erfolglos vor solchen Trends gewarnt hatten, konnte Roman Herzog nach dem Ende seiner Amtszeit 1999 beobachten, wie die Politik umsteuerte.
Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Stefan Marschall verweist auf die damals neue rot-grüne Bundesregierung.
„Diese Reformen auf dem Arbeitsmarkt, in der Arbeitsmarktpolitik, die unter Gerhard Schröder dann realisiert wurden, sind sicherlich zu verstehen auch als ein Ausfluss dieser ganzen Debatte, die in den 90er Jahren stattgefunden hat, die auch noch Anfang der 2000er eine Rolle spielte, sodass das Kabinett Schröder sehr viele Punkte auch indirekt angesprochen hat, die von Roman Herzog in seiner Rede thematisiert worden sind.“
Gescheitert allerdings ist Herzog mit dem Ansatz, die „Berliner Rede“ zu einem Leuchtturm in der politischen Debatte zu machen. Wohl gab es fortan jährlich eine solche Rede, zumeist gehalten von den Bundespräsidenten selbst. Immer wieder ging es um Globalisierung, um Bildung, auch um neue Technologien oder um Einwanderung und Integration.
Aber, so bilanzierte Deutschlandradio-Korrespondent Michael Groth 2009: „Vielleicht abgesehen von der ersten, der sogenannten Ruck-Rede Roman Herzogs sind eigentlich wenige Reden in Erinnerung geblieben. Da findet man natürlich viele gute Worte, aber so etwas bleibt nicht haften. Der heutige Anlass, das heutige Thema war konkreter, ich könnte mir vorstellen, dass diese Rede auch etwas mehr Wirkung zeigt als die vorangegangenen.“
Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Stefan Marschall verweist auf die damals neue rot-grüne Bundesregierung.
„Diese Reformen auf dem Arbeitsmarkt, in der Arbeitsmarktpolitik, die unter Gerhard Schröder dann realisiert wurden, sind sicherlich zu verstehen auch als ein Ausfluss dieser ganzen Debatte, die in den 90er Jahren stattgefunden hat, die auch noch Anfang der 2000er eine Rolle spielte, sodass das Kabinett Schröder sehr viele Punkte auch indirekt angesprochen hat, die von Roman Herzog in seiner Rede thematisiert worden sind.“
Gescheitert allerdings ist Herzog mit dem Ansatz, die „Berliner Rede“ zu einem Leuchtturm in der politischen Debatte zu machen. Wohl gab es fortan jährlich eine solche Rede, zumeist gehalten von den Bundespräsidenten selbst. Immer wieder ging es um Globalisierung, um Bildung, auch um neue Technologien oder um Einwanderung und Integration.
Aber, so bilanzierte Deutschlandradio-Korrespondent Michael Groth 2009: „Vielleicht abgesehen von der ersten, der sogenannten Ruck-Rede Roman Herzogs sind eigentlich wenige Reden in Erinnerung geblieben. Da findet man natürlich viele gute Worte, aber so etwas bleibt nicht haften. Der heutige Anlass, das heutige Thema war konkreter, ich könnte mir vorstellen, dass diese Rede auch etwas mehr Wirkung zeigt als die vorangegangenen.“
Finanzkrise als Schattenseite der Globalisierung
Denn an diesem 24. März 2009 sprach ein Kenner über ein brandaktuelles Thema: Bundespräsident Horst Köhler wandte sich der Globalisierung zu – ihren Schattenseiten, die sich gerade in der Weltfinanzkrise gezeigt hatten.
„Meine Damen und Herren! Ich will Ihnen eine Geschichte meines Scheiterns berichten. Es war in Prag im September 2000, ich war neu im Amt als Geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds. Die Entwicklung auf den Finanzmärkten bereitete mir Sorgen, es fehlte der Wille, das Primat der Politik über die Finanzmärkte durchzusetzen. Jetzt sind die großen Räder gebrochen, und wir erleben eine Krise, deren Ausgang das 21. Jahrhundert prägen kann. Ich meine: zum Guten, wenn wir aus Schaden klug werden.“
„Meine Damen und Herren! Ich will Ihnen eine Geschichte meines Scheiterns berichten. Es war in Prag im September 2000, ich war neu im Amt als Geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds. Die Entwicklung auf den Finanzmärkten bereitete mir Sorgen, es fehlte der Wille, das Primat der Politik über die Finanzmärkte durchzusetzen. Jetzt sind die großen Räder gebrochen, und wir erleben eine Krise, deren Ausgang das 21. Jahrhundert prägen kann. Ich meine: zum Guten, wenn wir aus Schaden klug werden.“
Denn, so Köhler wörtlich, zu viele Leute mit zu wenig eigenem Geld hätten riesige Finanzhebel in Bewegung gesetzt. Es sei vor allem um kurzfristige Rendite gegangen.
„Bis heute warten wir auf eine angemessene Selbstkritik der Verantwortlichen, von einer angemessenen Selbstbeteiligung für den angerichteten Schaden ganz zu schweigen. Wir erleben das Ergebnis fehlender Transparenz, Laxheit, unzureichender Aufsicht und von Risikoentscheidungen ohne persönliche Haftung. Wir erleben das Ergebnis von Freiheit ohne Verantwortung.“
„Bis heute warten wir auf eine angemessene Selbstkritik der Verantwortlichen, von einer angemessenen Selbstbeteiligung für den angerichteten Schaden ganz zu schweigen. Wir erleben das Ergebnis fehlender Transparenz, Laxheit, unzureichender Aufsicht und von Risikoentscheidungen ohne persönliche Haftung. Wir erleben das Ergebnis von Freiheit ohne Verantwortung.“
Deutschland verbuchte gerade einen Wirtschaftseinbruch um 5,7 Prozent. Der Globalisierungsrausch war für eine Weile umgeschlagen in Katerstimmung. Köhler forderte eine Ordnung für die Globalisierung, das Weltfinanzsystem müsse feste Institutionen und Regeln bekommen. Ressourcen müssten endlich gerecht verteilt werden.
„Wir brauchen eine Entwicklungspolitik für den ganzen Planeten. Ich stehe dazu: Für mich entscheidet sich die Menschlichkeit unserer Welt am Schicksal Afrikas.“
Einige Jahre später erlebte Europa die ersten Flüchtlingswellen aus dem Maghreb und aus Subsahara-Afrika. Heute liegt Horst Köhlers letzte Berliner Rede dreizehn Jahre zurück – seine Mahnungen sind zumeist verhallt. Der Wirtschaftswissenschaftler Christian Hagist von der Hochschule für Unternehmensführung in Vallendar.
„Wir haben die Milleniumsziele beispielsweise gehabt, die sich die UNO ja 2000 gegeben hat, was die Armutsreduktion angeht. Da hat man ja deutlich gemerkt, dass marktwirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten auch für ärmere Länder durchaus Potential haben, um beispielsweise wirklich krasse absolute Armut zu relativieren. Allerdings muss man sagen, war die letzte Dekade jetzt keine, wo man sagen kann, dass die Globalisierung wirklich ordnungspolitisch gut begleitet wurde.“
„Wir brauchen eine Entwicklungspolitik für den ganzen Planeten. Ich stehe dazu: Für mich entscheidet sich die Menschlichkeit unserer Welt am Schicksal Afrikas.“
Einige Jahre später erlebte Europa die ersten Flüchtlingswellen aus dem Maghreb und aus Subsahara-Afrika. Heute liegt Horst Köhlers letzte Berliner Rede dreizehn Jahre zurück – seine Mahnungen sind zumeist verhallt. Der Wirtschaftswissenschaftler Christian Hagist von der Hochschule für Unternehmensführung in Vallendar.
„Wir haben die Milleniumsziele beispielsweise gehabt, die sich die UNO ja 2000 gegeben hat, was die Armutsreduktion angeht. Da hat man ja deutlich gemerkt, dass marktwirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten auch für ärmere Länder durchaus Potential haben, um beispielsweise wirklich krasse absolute Armut zu relativieren. Allerdings muss man sagen, war die letzte Dekade jetzt keine, wo man sagen kann, dass die Globalisierung wirklich ordnungspolitisch gut begleitet wurde.“
Die Euphorie der Globalisierung ist endgültig vorbei
Hagist verweist etwa auf das Scheitern des TTIP-Abkommens zwischen Europa und den USA oder darauf, dass die EU immer noch mit hohen Agrarsubventionen afrikanische Produzenten aussperrt.
Die weltwirtschaftlichen Probleme, die Horst Köhler 2009 angerissen hat, sind 2022 zumeist immer noch ungelöst. Er selbst wollte sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nun nicht mehr dazu äußern. Seine Ansprache war die letzte offizielle „Berliner Rede“ eines Bundespräsidenten – unter seinen Nachfolgern hieß die Veranstaltung in veränderter Form ab 2013 „Bellevue-Forum“, später „Forum Bellevue“.
Die Präsidenten rissen in ihren Berliner Reden wichtige Punkte an und legten Finger in Wunden – Wirkungen in der Politik konnten sie kaum hinterlassen. Inzwischen laufen die Debatten nach Christian Hagists Beobachtung ohnehin in eine ganz andere Richtung als 2009 oder 1997: die Euphorie der Globalisierung ist endgültig vorbei.
„Ich glaube, da kann man sehen, dass wahrscheinlich auch die Wirtschaftswissenschaft, auch ich persönlich wahrscheinlich ein bisschen zu naiv war. Aber trotzdem, glaube ich, trägt der Gedanke auch der Köhlerschen Rede noch weiter, und wir sollten, gerade um die ärmeren Gesellschaften am Gesamtwohlstand stärker partizipieren zu lassen, genau in diese Richtung weitermarschieren.“
Die Präsidenten rissen in ihren Berliner Reden wichtige Punkte an und legten Finger in Wunden – Wirkungen in der Politik konnten sie kaum hinterlassen. Inzwischen laufen die Debatten nach Christian Hagists Beobachtung ohnehin in eine ganz andere Richtung als 2009 oder 1997: die Euphorie der Globalisierung ist endgültig vorbei.
„Ich glaube, da kann man sehen, dass wahrscheinlich auch die Wirtschaftswissenschaft, auch ich persönlich wahrscheinlich ein bisschen zu naiv war. Aber trotzdem, glaube ich, trägt der Gedanke auch der Köhlerschen Rede noch weiter, und wir sollten, gerade um die ärmeren Gesellschaften am Gesamtwohlstand stärker partizipieren zu lassen, genau in diese Richtung weitermarschieren.“


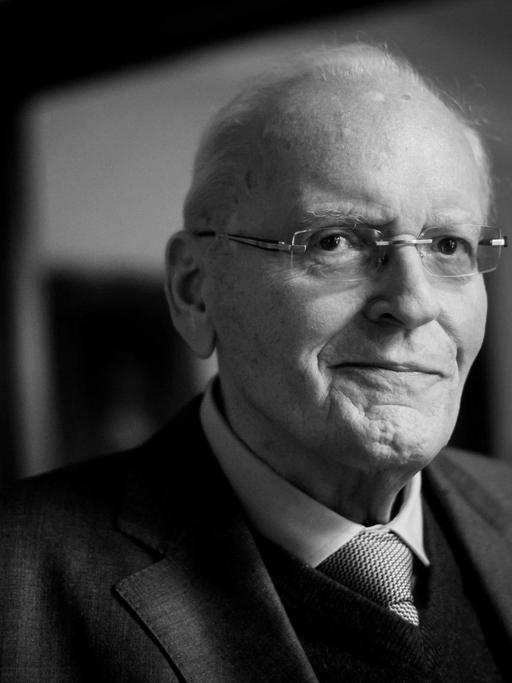


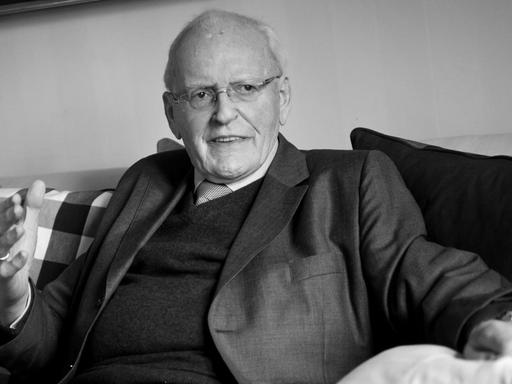
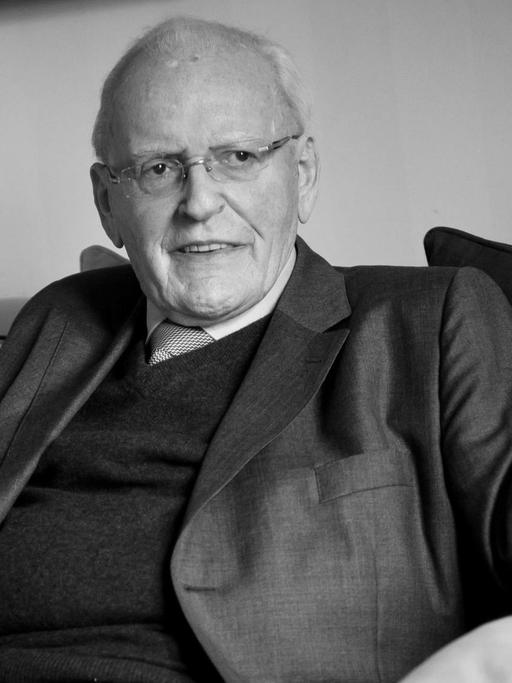







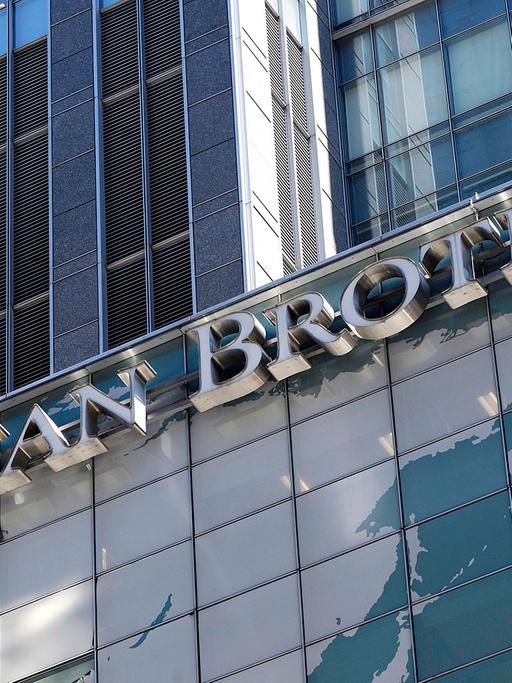














![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)