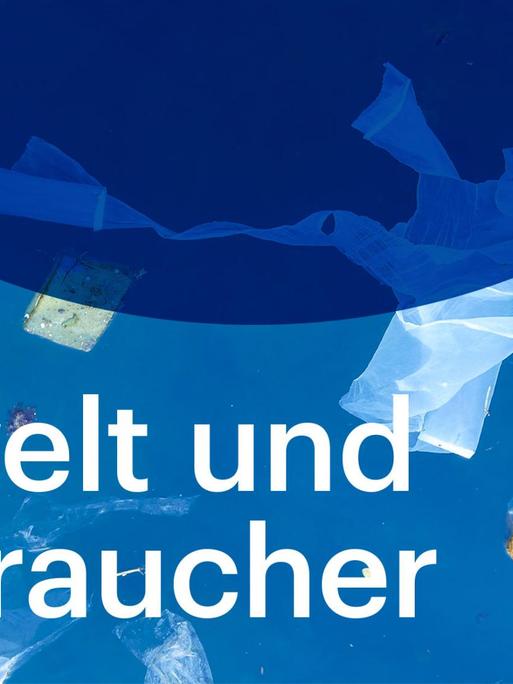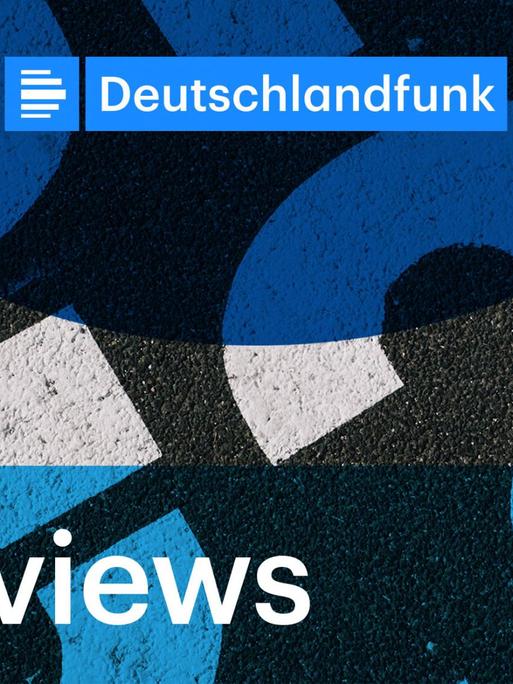Der Klimawandel steht nicht im Fokus der zukünftigen Regierungskoalition. In der dreiseitigen Präambel des frisch vereinbarten Koalitionsvertrags zwischen der Union und der SPD kommt das Klima kein einziges Mal vor. Die Ampelkoalition hatte den Klimawandel da hingegen mehrfach prominent benannt.
Umweltverbände wie Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und der WWF haben sich kritisch zu den Klimaschutzvorhaben im vereinbarten Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD geäußert. Der Grünen-Vorsitzende Banaszak warf der zukünftigen Regierung vor, die ökologische Krise in ihrem Koalitionsvertrag nicht anzugehen.
Was planen Union und SPD im Koalitionsvertrag zum Klima?
Grundsätzlich bekennt sich die neue Koalition zum Ziel, 2045 klimaneutral sein zu wollen. Doch die konkreten Vorhaben im Koalitionsvertrag lassen nicht klar erkennen, wie das gelingen soll. Viele genannte Projekte sind zudem schon von der Ampelkoalition auf den Weg gebracht worden.
Erneuerbare Energien sollen weiter ausgebaut werden, allerdings marktdienlicher. Das Flächenziel für Windkraft bleibt. So auch der CO2-Preis als Hauptinstrument für den Klimaschutz. Auch das Deutschlandticket soll fortgeführt werden.
Union und SPD möchten in begrenztem Umfang auch auf Maßnahmen im außereuropäischen Ausland setzen, indem sie von dort Zertifikate für emissionsmindernde Projekte kaufen. Das ist eine umstrittene Methode, auch weil mit Klimazertifikaten betrogen wird. Erst im vergangenen Jahr war ein Betrugsfall mit Zertifikaten aus China bekannt geworden.
Welche Punkte im Koalitionsvertrag stehen dem Klimaschutz entgegen?
Die Pendlerpauschale wird erhöht, dabei ist sie eine Subvention, die auch fossil betriebenen Verkehr massiv fördert. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert kritisiert, im Verkehrssektor fehlten im Koalitionsvertrag wichtig Maßnahmen, um die Emissionen zu senken. Schlimmer noch, umweltschädliche Subventionen würden erhöht, wie beispielsweise auch beim Agrardiesel.
Die zukünftige Koalition bleibt beim Ausstiegsdatum 2038 für die Kohle. Und dies, obwohl Fachleute einwenden, dass sich Kohlestrom zu dem Zeitpunkt wegen des Emissionshandels nicht mehr rechnen werde.
Union und SPD setzen auf Erdgas
Die Gasförderung in Deutschland soll ausgebaut werden. Das bedeutet aber, Kapazitäten aufzubauen für die Förderung eines Rohstoffs, der in 20 Jahren im Hinblick auf die Klimaneutralität gar nicht mehr genutzt werden soll.
Auch der Grünen-Vorsitzende Banaszak kritisiert das Regierungsprogramm von Union und SPD im Hinblick auf die geplante Sicherstellung der Versorgung mit Gas. Im Koalitionsvertrag steht dazu: „Wir ermöglichen und flankieren langfristige, diversifizierte, günstige Gaslieferverträge mit internationalen Gasanbietern. Die Klimaziele bleiben davon unberührt.“
Diese Sätze im Koalitionsvertrag ergäben hintereinander keinen Sinn, so Banaszak: „Eine konsistente Klimapolitik, die wirklich dafür sorgt, dass wir 2030 unsere Ziele erreichen, kann ich dahinter nicht erkennen“.
Die SPD-Politikerin Saskia Esken verteidigt die Passagen: Die Energieversorgung müsse sichergestellt werden. Bis zu einer vollständigen Versorgung mit erneuerbaren Energien bräuchte es „Brücken und auch für die noch nicht vorhandene Speicherkapazität für die erneuerbaren Energien eben Brückentechnologien“. Dazu gehöre klar Gas, das wesentlich sauberer verbrannt werden könne als früher. Gas-Kraftwerke seien dazu geeignet, auch in Flautensituationen rasch hochgefahren zu werden, das gelte für andere Grundlastkraftwerke nicht.
Umstrittene unterirdische CO2-Speicherung auch für Erdgas
Im Koalitionsvertrag nennen Union und SPD CO2-Abscheidungs- und Speicherungstechnologien (CCS) – also die unterirdische Speicherung von klimaschädlichem Kohlenstoff – als Instrumente zur Erreichung der Klimaneutralität. Geplant ist demnach ein Gesetzespaket, was diese Speicherung ermöglicht.
Dass dieses Verfahren für schwer vermeidbare Emissionen, wie sie beispielsweise in der Zementindustrie entstehen, nötig ist, ist weitgehend Konsens. Die künftige Regierung möchte CCS aber auch für Gaskraftwerke erlauben. Aus Sicht des Thinktanks Agora Energiewende droht das zu einer „Dauersubvention für die Nutzung importierten fossilen Erdgases“ zu werden.
Sollte das Gesetz kommen wie geplant, würde es ohnehin noch etwa zehn Jahre dauern, bis CO2 beispielsweise im Untergrund der Nordsee verpresst werden kann, sagt der Geologe Klaus Wallmann vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, Geomar. Er leitet das Forschungsprojekt "Geostor", bei dem Potential, Kosten und Umweltauswirkungen der unterirdischen CO2-Speicherung im Meeresboden untersucht werden.
Denn neben zeitaufwendigen Prüfungen und Analysen brauche es die Industrieanlagen, an denen CO2 abgeschieden und aufgefangen wird, sowie Pipelines, durch die das Gas transportiert werden kann. Zudem könne auch weniger CO2 gespeichert werden als zunächst angenommen, so Wallmann. Denn die meisten Standorte in der Nordsee, die geologisch geeignet wären, seien schon verplant für andere Nutzungen.
Die CO2- Speicherung an Land lehnt Wallmann aufgrund zweier Risiken – derzeit noch – ab: Zum einen sei das das Risiko für Leckagen, also ungeplante Austritte. Zum anderen sei die Frage, ob das in der Erde verdrängte Grundwasser noch aufsteigen könne – und ob dieses nicht eher leicht versalzt würde.
Emissionshandel ohne Klimageld?
Ab dem Jahr 2027 gilt der Europäische Emissionshandel EU-ETS auch für Gebäude und den Straßenverkehr – der sogenannte neue oder erweiterte EU-ETS 2. Die Folge: Die Preise an der Tankstelle und beim Heizen steigen. Sinn der Abgabe ist es, den klimaschädlichen Ausstoß von CO2 zu verteuern.
Damit Verbraucher nicht zu stark belastet werden, kam die Idee des Klimageldes auf, dass an die Bürger ausgeschüttet werden sollte. Schwarz-Rot will laut Koalitionsvertrag am Europäischen Emissionshandel festhalten – doch von einem Klimageld ist im Koalitionsvertrag nicht die Rede, wie Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ZEW, hervorhebt.
Darunter könne aber die Akzeptanz für den Klimaschutz bei Bürgerinnen und Bürgern leiden. Das Klimageld sei ein mögliches Instrument, Belastungen, die mit der Erhöhung der Preise einhergehen, abzufedern – und darüber auch die Akzeptanz für den Klimaschutz in der Gesellschaft zu erhalten. Besonders belastete Haushalten sollten daher unterstützt werden, beispielsweise mit Förderprogrammen, mit Förderung von Wärmepumpen, von Fernwärme, so Wambach.
Pläne zur Abschaffung des „Heizungsgesetzes“
Das umstrittene Heizungsgesetz – eigentlich: Gebäudeenergiegesetz (GEG) – der Ampel wollen die Koalitionspartner abschaffen und durch eine Reform ersetzen. Das Gesetz, das die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf den Weg gebracht hatte, war vielfach scharf kritisiert worden.
Es sieht unter anderem vor, dass spätestens ab Mitte 2028 die Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie für alle neuen Heizungen in Deutschland verpflichtend sein soll. Umweltverbände sehen das nun angekündigte Ende für das Gebäudeenergiegesetz in seiner jetzigen Form jedoch kritisch. Wie das neue GEG im Detail aussehen soll, ist noch offen.
csh, pto