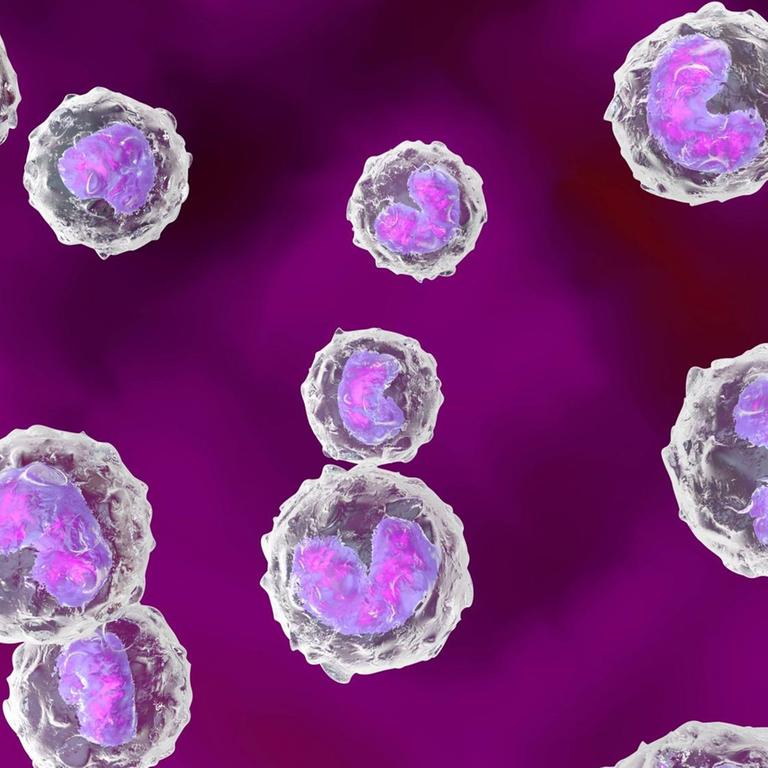Peter Sawicki: Dr. Carroll – eine Reihe von Leuten, darunter Bill Gates und auch Sie, warnen seit Jahren vor einer neuen Pandemie. Ist es richtig, anzunehmen, dass Sie vom Ausbruch des Coronavirus nicht überrascht sind?
Dennis Carroll: Der Ausbruch kommt in der Tat nicht überraschend. Forscher auf diesem Gebiet hatten so ein Virus schon länger auf dem Radar, mehr als 20 Jahre, also auch einige Aspekte wie die Quelle des Ausbruchs, seine Eigenschaften oder wie es sich verbreiten könnte. Nein, das ist nicht überraschend.
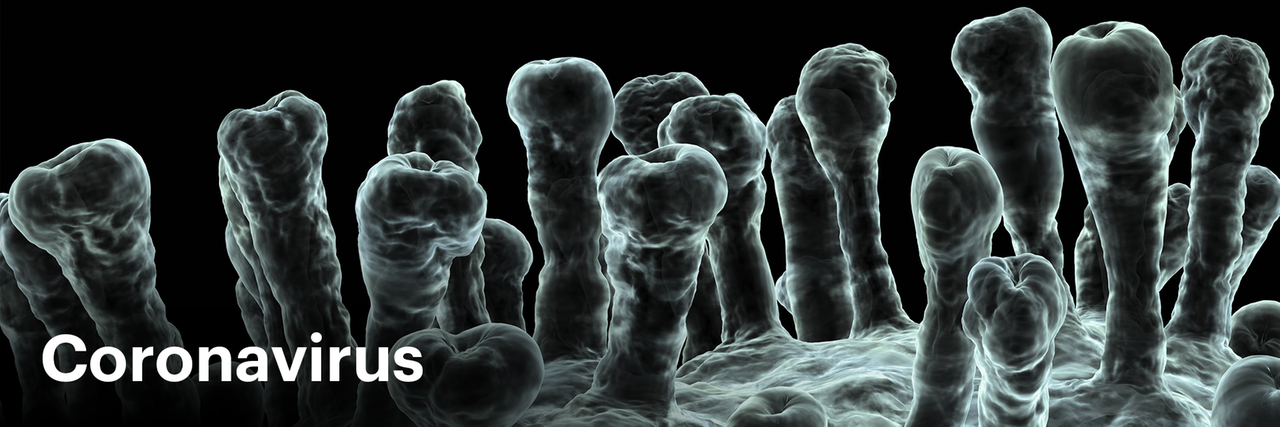
Sawicki: Warum ist das nicht überraschend?
Carroll: Ein derartiger Ausbruch wie jetzt im Fall des Coronavirus ist Teil eines natürlichen Musters. Dieses und alle ähnlichen Viren, die zum Teil zu Pandemien führten, haben zuvor in der Tierwelt existiert. Wir wissen also, dass es dort eine Art Reservoir für Viren wie Corona gibt – und dass sie gelegentlich von Tieren auf Menschen übergreifen. Entweder direkt – oder indirekt, wenn sie etwa von Wildgeflügel auf Hausgeflügel und dann weiter auf Menschen übertragen werden.
Das sind gewöhnliche Ereignisse. Das 21. Jahrhundert ist aber keine gewöhnliche Epoche. Viren greifen in der jetzigen Zeit immer häufiger über. Das liegt vor allem am Bevölkerungswachstum. Wenn wir mal auf die Pandemie von 1918 schauen – damals lebten weltweit 1,8 Milliarden Menschen. Halten wir uns das mal kurz vor Augen: Es hat fast 300.000 Jahre gedauert, bis die Menschheit die Marke von einer Milliarde erreicht hat. Innerhalb von gerade mal 100 Jahren – von 1918 bis heute – sind dann weitere sechs Milliarden dazugekommen. Unsere Ökosysteme können ein solches Bevölkerungswachstum nur unmöglich vertragen, ohne Schäden davonzutragen. Daraus folgt zum Beispiel eine engere Interaktion zwischen Wildtieren und Menschen – weil wir in deren Lebensräume vordringen. Der Fall des Coronavirus ist also Teil eines größeren Schemas. Und solche Gefahren wird es künftig vermehrt geben.
"Die Länder sollten sich untereinander koordinieren"
Sawicki: Sie haben jetzt sehr viele Aspekte erwähnt. Bleiben wir zunächst noch kurz beim Coronavirus. Was ist für Sie das Gefährlichste daran?
Carroll: Das Gefährlichste daran ist nicht das Virus selbst, sondern unser Umgang mit ihm. Die Welt reagiert chaotisch, nicht zuletzt mein Heimatland, die USA. Das ist besonders erschreckend. Jedes Land reagiert unterschiedlich, und selbst innerhalb der Länder ist es so. Das überrascht mich sehr. Seit 20 Jahren untersuchen wir diese Viren. Wir wissen – so lange es keine Impfstoffe und Medikamente gibt – eigentlich auch, welche Hygienemaßnahmen nötig sind. In den letzten 20 Jahren haben wir viel darüber gesprochen, wie wir uns vorbereiten können.
Sawicki: Wie müssten diese Vorbereitungen aussehen?
Carroll: Dass sich zum Beispiel Länder untereinander koordinieren sollten. Das Virus schert sich nicht um Staatsgrenzen, die wir als Menschen willkürlich ziehen. Wir beobachten jetzt die Folge einer großen Fragmentierung der vergangenen Jahre. Der Populismus – in den USA und anderswo – hat traditionelle globale Netzwerke geschwächt. Wenn Sie mich also fragen, was mich überrascht – es ist nicht das Verhalten des Virus. Es ist unser Verhalten.
"Diese Abwertung wissenschaftlicher Befunde ist besorgniserregend"
Sawicki: Heißt das auch, dass die Wissenschaft und ihre Finanzierung vernachlässigt worden sind?
Carroll: Nun ja. Wir sehen immer öfter eine Rhetorik, die Wissenschaft geringschätzt, auch in meinem Land. Selbst als im Januar schon klar wurde und es einschlägige wissenschaftliche Erkenntnisse gab, dass das Virus eine globale Gefahr darstellt, schlugen es politische Führungspersonen einfach in den Wind. Und viele von ihnen tun es weiterhin. Diese Abwertung wissenschaftlicher Befunde ist besorgniserregend. Und unglücklicherweise erschwert sie es, angemessen auf die Gefahr durch das Virus zu reagieren.
Sawicki: Lassen Sie uns über Ihre wissenschaftliche Arbeit sprechen, über Viren, die sozusagen in der Tierwelt lauern und potentiell auf Menschen übergreifen könnten. Wie groß ist diese Gefahr?
Carroll: In unserer Arbeit haben wir es in den vergangenen zehn Jahren geschafft, in diese große dunkle Materie von potentiell gefährlichen Viren einzudringen und einige Zählungen vorzunehmen. Wir glauben, dass es derzeit etwa 1,7 Millionen verschiedene Viren in der Natur gibt, die von 25 Virengattungen abstammen. Davon könnten ca. 600.000 Viren für Menschen potentiell gefährlich sein. Zwar würde davon wiederum nur ein Bruchteil zu ernsthaften Erkrankungen führen. Aber allein dieses Risiko zeigt uns, wie wichtig es ist, eine breit angelegte Datenbank über solche Viren anzulegen und unser Wissen darüber kontinuierlich auszubauen. Denn auch in Zukunft werden Erreger weiter auf Menschen übergreifen, und uns vielleicht noch größere Probleme bereiten.
"Wir brauchen ein großes globales Netzwerk"
Sawicki: Wird dieses Risiko derzeit unterschätzt?
Carroll: Ja, ohne Zweifel. Das ist aber eine weit verbreitete Haltung – egal ob in den USA, in Deutschland oder Indien. Wir neigen als Weltgemeinschaft dazu, Risiken zu unterschätzen. Meistens investieren wir Geld in jene Gefahren, die wir bereits kennen und sehen. Als das Coronavirus in der Natur zirkuliert ist, haben wir uns nicht darum geschert. Als es Menschen befallen hat, haben wir darauf reagiert. Wichtig ist deshalb, dass wir unsere Prioritäten bei Investitionen ändern. Zum einen indem wir etwa Stiftungen stärken. Und indem wir anfangen Risiken zu erkennen, bevor sie übergreifen. ‚Das Virus kennen, bevor es uns kennt‘. So könnte die Devise lauten. Das bedeutet aber, dass wir mehr ins Unbekannte investieren. Und darin sind wir bisher sehr schlecht.
Solche Investitionen wurden in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt. Während meiner Zeit bei der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, der USAID, leitete ich ein solches Forschungsprogramm. Wir hatten ein Budget von 20 Millionen Dollar pro Jahr. Das war vergleichsweise viel, aber grotesk wenig angesichts der Dringlichkeit der Aufgabe. Dahingehend brauchen wir deshalb ein großes globales Netzwerk, um auf künftige Fälle vorbereitet zu sein.
"Gibt es Alternativen für die derzeitige Tierhaltung?"
Sawicki: Sie haben eben angedeutet, dass wir zu weit in die Natur vordringen und damit die Gefahr des Übergreifens von Viren auf Menschen erhöhen. Wie können wir das reduzieren?
Carroll: Nun, wie bereits erwähnt – die Hauptursache ist das rapide Bevölkerungswachstum. Dies wirkt sich verschiedenartig auf Ökosysteme aus. Erstens, indem wir Wohngebiete erschließen und ausbauen. Zweitens, die Landwirtschaft. Sie wirkt sich geradezu zerstörerisch auf Ökosysteme aus. Und drittens ist es das tiefe Eindringen in die Natur auf der Suche nach wertvollen Mineralien und Rohstoffen, was wirtschaftliche Gründe hat. Wenn wir aber mal nur bei Punkt Zwei bleiben – der Landwirtschaft.
Die wichtigste Ursache für das Übergreifen von Viren liegt in der Transformation von Ökosystemen durch eine Änderung der Landnutzung. Deren wichtigster Faktor ist wiederum die Rinderhaltung und -produktion. Hinzu kommt die Herstellung von Nahrungsmitteln für diese Rinder. Eine zentrale Herausforderung ist, die Art und Weise, wie wir unseren Proteinbedarf decken, zu überdenken. In dieser Hinsicht glauben wir, dass im Laufe des 21. Jahrhunderts Afrika südlich der Sahara und Südasien immer stärker in den Fokus rücken werden, auch wegen des Bevölkerungswachstums dort. Wenn wir unseren Proteinbedarf weiter auf die bisherige Weise decken – und hier spielt Rindfleisch eine große Rolle – wird die Gefahr des Virenübergreifens rasant wachsen.
Wir müssen uns nüchtern fragen: Gibt es andere Wege, um den Proteinbedarf zu decken? Gibt es Alternativen für die derzeitige Tierhaltung? Und darüber müssen wir als Weltgemeinschaft ernsthaft nachdenken.
"Wenn die Gefahr erst einmal gebannt ist, wird sie vergessen sein"
Sawicki: Müssen wir lernen, dauerhaft mit der Gefahr von Pandemien zu leben?
Carroll: Nein, das müssen wir nicht zwingend. Das ist eine Frage unserer Lebensweise. Und die können wir ändern. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir mit einer anderen Lebensweise die Gefahr von Pandemien verringern können. Wenn wir uns die Aspekte und Ursachen des Klimawandels anschauen, stellen wir fest, dass auch dies zu einem großen Teil auf die Änderung von Landnutzung zurückzuführen ist. Wir müssen uns also weder an die Gefahr durch Viren gewöhnen, noch an das Szenario des Klimawandels. Nichts davon ist unvermeidbar. Als Weltgemeinschaft hat es ja Diskussionen darüber gegeben, was eigentlich getan werden müsste. Was es bislang nicht gibt, ist der notwendige und weit verbreitete politische Wille, um die Dinge zu tun, die notwendig sind.
Sawicki: Eine letzte Frage. Wenn wir wieder zurückgehen zu den frühen Pandemie-Warnungen. Es gibt sie seit Jahren – doch lange hat kaum jemand zugehört, erst jetzt ändert sich das langsam. Frustriert Sie das?
Carroll: Sagen wir mal so. Im Laufe der letzten 20 Jahre gab es eine Reihe von Vorfällen, die uns als Weltgemeinschaft aufgerüttelt haben. Wenngleich eher aus Angst. Im Jahr 2002 hatten wir die SARS-Pandemie. 2005 grassierte die Vogelgrippe. Danach kam 2009 die Schweinegrippe, und 2014 gab es den großen Ausbruch von Ebola. Jeder einzelne Fall hat unsere Aufmerksamkeit deutlich erhöht, und die Bereitschaft, sich damit zu befassen.
Die Erfahrung zeigt aber auch – wenn diese Themen erst einmal aus den Hauptschlagzeilen der Nachrichtenmedien verschwinden, geht diese Aufmerksamkeit verloren, und auch die finanziellen Zuwendungen werden spürbar weniger. Meine Sorge ist jetzt, dass sich dieses Muster, das wir seit Jahren kennen, wiederholt: Wenn die Gefahr erst einmal gebannt ist, wird sie vergessen sein. Jeder solcher einzelnen Fälle ist eigentlich ein Moment, in dem wir dazulernen können. Dazu benötigen wir aber den politischen Willen und ausreichende Investments, um unsere Lehren zu ziehen. Und zwar nicht während der akuten Krisenzeit, sondern während der Friedenszeit, wenn Sie so wollen. Also in der Phase zwischen viralen Ausbrüchen. In der Vergangenheit haben wir das vermissen lassen. Vielleicht ist der Schock angesichts der jetzigen Krise groß genug, damit sich etwas ändert. Aber wir müssen leider auch damit rechnen, dass die Menschen erneut das Interesse verlieren, sobald die Krise vorbei ist.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.