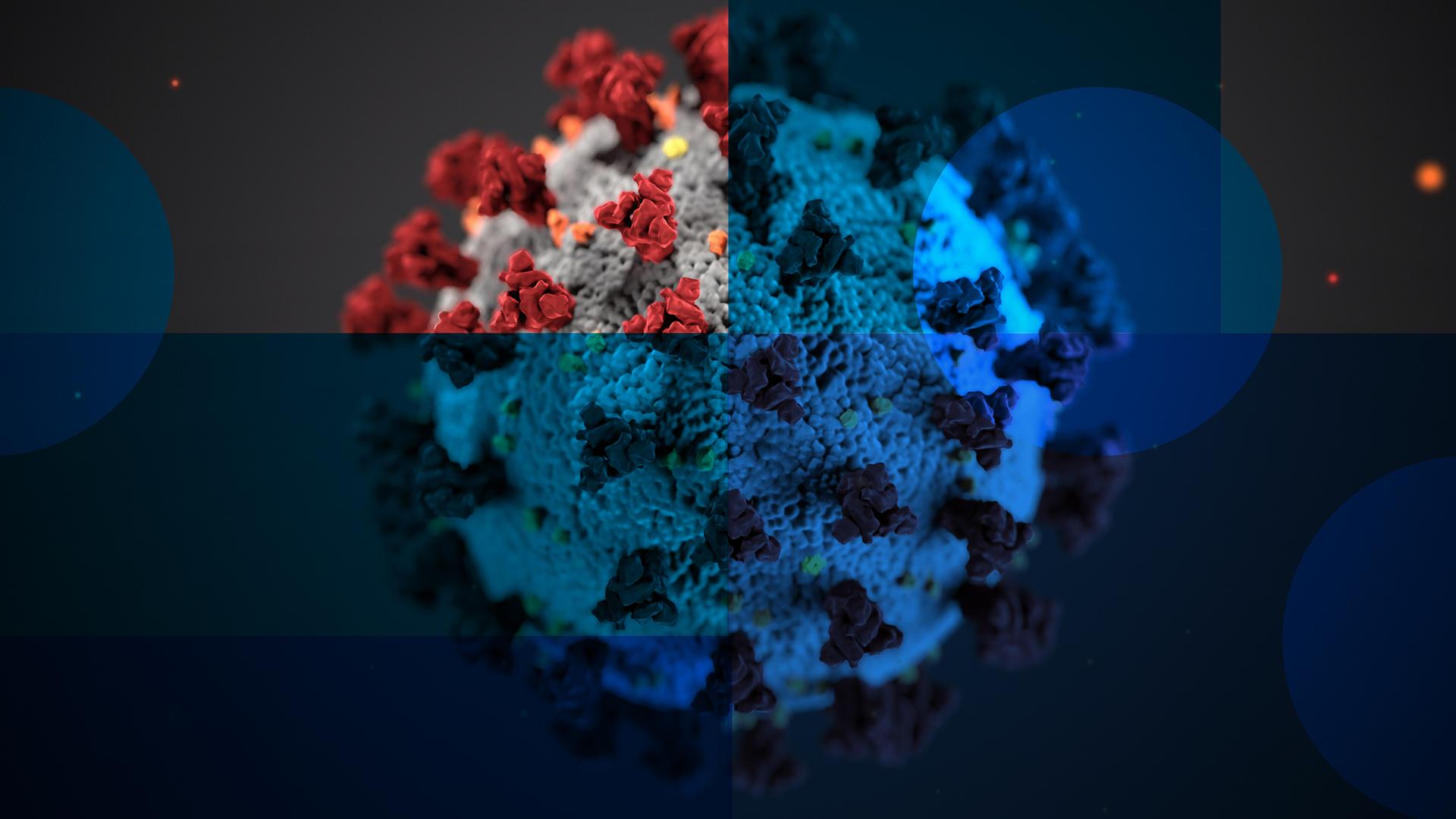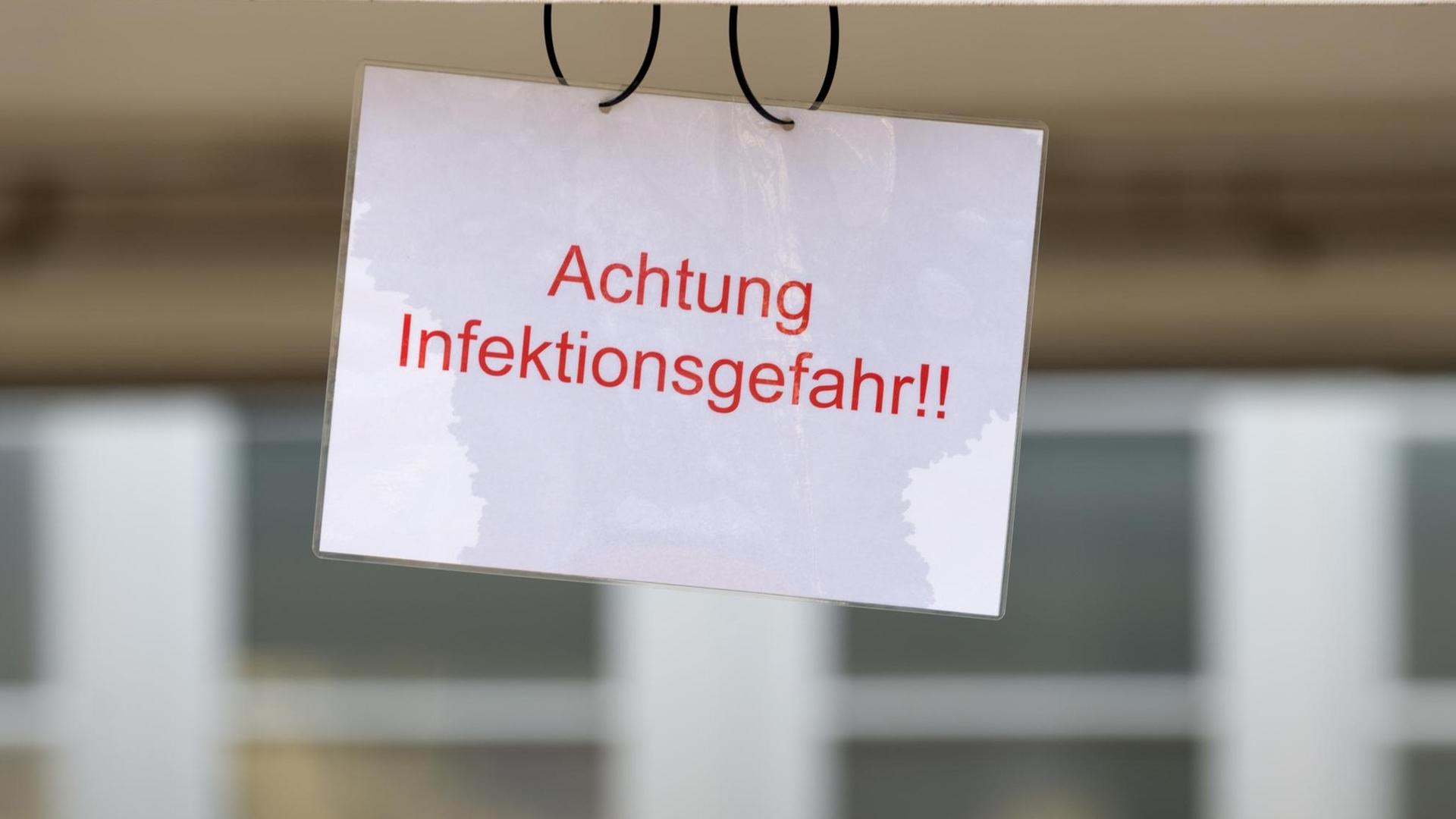
Als Epizentrum der Coronakrise wird Wuhan genannt, weil die Pandemie in der Stadt mit ihren über acht Millionen Einwohnern ihren Ausgang genommen hat. Mehr als 3.000 Menschen sind in der Region bisher gestorben. Am 23. Januar hat die Führung in Peking die Stadt abgeriegelt und Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt. Inzwischen aber scheint das Schlimmste überstanden. Nothospitäler jedenfalls wurden wieder geschlossen. Die Behörden melden inzwischen nur noch wenige neue Infektionen.
Seit den 1950er-Jahren ist in Wuhan ein deutsch-chinesisches Freundschaftskrankenhaus angesiedelt, das ein deutscher Arzt im Jahr 1900 ursprünglich in Schanghai gegründet hatte. Co-Präsident der Klinik ist der Mediziner und Medizinethiker Eckhard Nagel. Er leitet an der Universität Bayreuth das Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften.
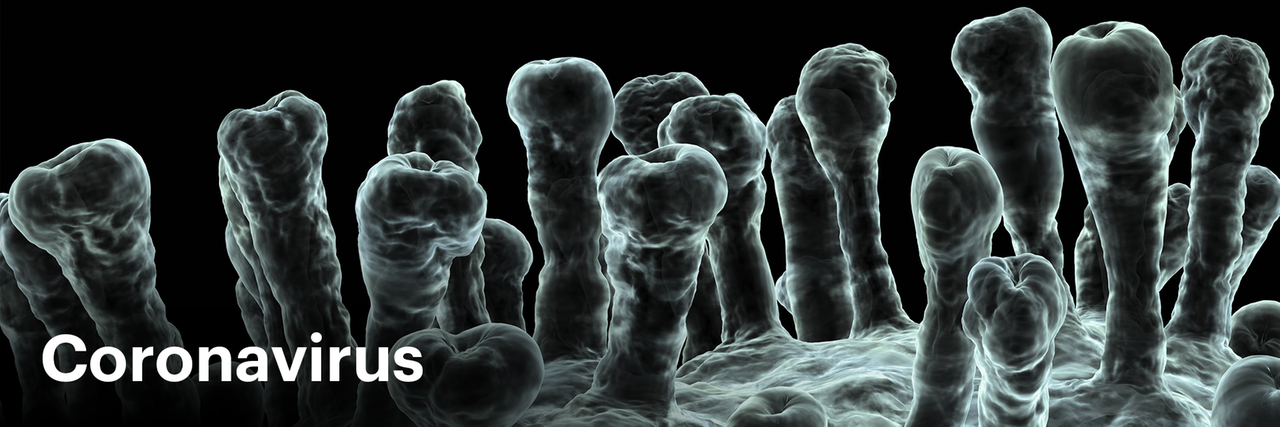
Jasper Barenberg: Herr Nagel, Sie haben mir gestern Abend in unserem kurzen Telefonat erzählt, dass Sie Ende Dezember zum ersten Mal von Kolleginnen und Kollegen in Wuhan von diesen ungewöhnlichen Erkrankungen gehört haben. Seitdem sind Sie bis heute im Grunde im Kontakt mit Kollegen dort. Was passiert, wenn ein Krankenhaus mit Corona-Kranken konfrontiert ist? Was haben Sie in diesen Wochen über dieses Thema gelernt?
Eckhard Nagel: Zuerst einmal, dass natürlich eine Zunahme einer bisher nicht bekannten Infektion, eine Zunahme von schwersten Lungenentzündungen für ein Krankenhaussystem, das in Wuhan im Verhältnis wahrscheinlich zu vielen anderen Orten der Welt sehr gut ausgebaut ist, ganz schnell zu einer Überforderung führen kann. Dazu kommt natürlich dann die Unsicherheit der Menschen. Sie haben auf die acht Millionen Einwohner hingewiesen, die dann alle die Krankenhäuser stürmen. In Wuhan und in China generell gibt es ja keine gute ambulante medizinische Versorgung. Insofern war das natürlich am Anfang ein Kollaps des Systems.
"Man hat beständig gelernt"
Barenberg: Und wie hat es sich dann weiterentwickelt, wenn Sie das doch relativ eng mitverfolgen konnten? Hat sich Ihre Einschätzung der Gefahr, die das Virus darstellt, im Kontakt mit den Kollegen in Wuhan mit der Zeit auch verändert?
Nagel: Auf jeden Fall! Ich glaube, es gibt jedenfalls für mich persönlich kaum eine Zeit, in der ich mich so häufig geirrt habe im Hinblick auf die Einschätzung einer aktuellen Situation. Am Anfang zum Beispiel die Frage, ja, da gibt es ein neu identifiziertes Virus, ist es tatsächlich der Ausgangspunkt dieser Erkrankung. Das habe ich zum Beispiel infrage gestellt. Ich habe auch infrage gestellt, wie die Übertragungswege sein können. Am Anfang hat man sich ja nicht vorstellen können, dass es tatsächlich von Mensch zu Mensch übertragen wird, sondern dass es auch einen Kontakt mit der Tierwelt braucht. Und so weiter und so weiter! Insofern, glaube ich, hat man beständig gelernt, mit den neuen Erkenntnissen umzugehen und sie bestmöglich für die Patientenversorgung einzusetzen. Das gilt zum Beispiel auch für die Frage, wie müssen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses schützen. Auch die haben sich am Anfang natürlich in großer Zahl infiziert und sind ausgefallen, weil man auf diese Situation nicht vorbereitet war.
"Wir uns gut vorbereitet, sehr gut, wie ich finde"
Barenberg: Das ist ja ein wichtiger, vielleicht der entscheidende Unterschied zu Deutschland, der auf der Hand liegt. China wurde ganz unerwartet getroffen mit einem unbekannten Virus. Kliniken in Deutschland hatten in der letzten Zeit jedenfalls ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten und einzustellen auf das, was da möglicherweise kommen mag. Wie wichtig ist das, wenn bei uns jetzt absehbar auch die Zahlen der Patienten steigen?
Nagel: Ich glaube, es ist ganz entscheidend, ein unvorstellbarer Vorteil. Das sieht man ja auch, wenn man jetzt nach Italien schaut oder in Länder, in denen auf einmal die Epidemie wieder so aufgetreten ist, dass die Vorbereitungen, die man vielleicht hier und da schon getroffen hat, nicht ausreichend waren. Dann ist das Ganze tatsächlich eine Katastrophe.
Hier hoffe ich, in Deutschland haben wir uns gut vorbereitet, sehr gut, wie ich finde, in vielerlei Hinsicht. Und wenn jetzt es uns gelingt, die Anzahl der Patientinnen und Patienten kalkulierbar zu halten, dann ist es eine ganz andere Versorgungssituation und natürlich auch eine ganz andere Sicherheit, mit der wir diese Situation überstehen können.
"Viele Krankenhäuser haben im Moment relativ viel Platz"
Barenberg: Sie haben gesagt, am Beispiel Wuhan kann man auch sehen, wie schnell ein an sich gut ausgestattetes Gesundheitswesen überfordert sein kann. Das sind natürlich besondere Bedingungen dort gewesen. Aber auch für Deutschland erwarten ja viele, dass man sich alle Mühe gibt in den Kliniken und Krankenhäusern, aber dass es sehr eng werden wird und dass möglicherweise die Grenze zur Belastbarkeit doch schnell erreicht ist. Wie schätzen Sie das ein, wenn Sie sagen, wir sind sehr gut vorbereitet? Wie schnell, wie kurz ist der Weg zu einer Überforderung?
Nagel: Wir haben ja in Wuhan auch gesehen: Das erste, was man getan hat, ist, möglichst alle Patienten, die jetzt nicht wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus waren, zu entlassen. Das heißt das, was man selektiv nennt, was nicht unbedingt sofort als Behandlung im Krankenhaus vorhanden war, dass man diese Menschen nachhause geschickt hat und dementsprechend Platz geschaffen hat, Raum geschaffen hat.
Ein wichtiger Punkt, den wir auch gelernt haben in den letzten Wochen, ist, dass die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein entscheidender Faktor ist, sowohl was die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, angeht wie auch die Sterblichkeit von Patienten angeht. Das heißt, am Anfang haben die Menschen 12, 18 Stunden Schichten gearbeitet. Das hat zu katastrophalen Folgen auf den Stationen geführt. Man ist jetzt zu sechs bis acht Stunden Schichten übergegangen, und das ist deutlich besser, sowohl für die Angehörigen, für die Mitarbeiter, wie auch für die Patienten.
Diese Dinge haben wir gelernt. Darauf hat man sich in Deutschland vorbereitet. Und ich hoffe jedenfalls, dass die Anzahl der Patienten nicht so groß wird. Das kann man sich ja so schwer vorstellen. Viele Krankenhäuser haben im Moment relativ viel Platz, viele Betten sind "leer". Die Leute warten in einer sehr ungewöhnlichen Art und Weise auf das, was da kommen soll. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, dass die Anzahl der Patienten nicht unübersehbar steigt, sind wir jetzt gut gewappnet auf diese Situation.
"Patienten erleben, dass eine geplante Operation verschoben wird"
Barenberg: Aber, wie eine Medizinerin heute in der "FAZ" sagt, wir wissen nicht, wie groß der Tsunami sein wird.
Nagel: Genau! Das ist ja bei den Wellen ohnehin immer so. Man weiß es nicht ganz genau. Aber es ist eine ganz andere Situation, ob ich mich auf eine solche Welle vorbereiten kann, oder ob sie mich mitten in meinem normalen Alltagsleben trifft. Das ist, glaube ich, der große Vorteil, mit dem wir hier in Deutschland aus der Erfahrung, die in China gemacht worden ist, umgehen können.
Barenberg: Jetzt lese ich heute im Titel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Eckhard Nagel: Ärzte befürchten Mangel an Intensivbetten. Sehr viele Informationen gibt es dazu nicht, wohl aber den Hinweis, dass medizinische Fachgesellschaften jetzt schon Handlungsempfehlungen schreiben für die Situation, wo man entscheiden muss, wer die dann begrenzten Mittel bekommen wird. Wer wird an ein Beatmungsgerät angeschlossen? Bei wem müssen wir darauf verzichten? Das Wort der Triage aus der Katastrophenmedizin ist seit Tagen ja schon in aller Munde. Ist das Personal in den Kliniken auf so eine Situation eingestellt?
Nagel: Nein. Ich glaube, das ist eine Situation, die wir immer schon haben. Die gibt es ja täglich. Es vergeht in meinem Medizinerleben jedenfalls als Chirurg kein Tag, an dem ich morgens gefragt werde, gibt es genügend Intensivbetten, muss unter Umständen ein Patient ausfallen, weil ein anderer noch so schwerkrank ist, dass er nicht wie erwartet verlegt werden kann. Das erleben Patienten dann auch, dass eine geplante Operation zum Beispiel verschoben wird.
Ich bin ja eng in der Transplantationsmedizin tätig. Hier haben wir ständig eine Situation, wo wir nicht genügend Organe für zu viele Patienten haben, und dann müssen wir auswählen. Dann müssen wir eine Struktur, einen Entscheidungsprozess entwickeln, mit dem wir dann die wenigen Organe auf die vielen Patienten verteilen.
Das ist etwas, was jetzt zumindest aus dem, was wir hören in anderen Ländern, bei uns unter Umständen auch sein könnte, und damit da keine Situation entsteht, die wir nicht wollen und die unserem ärztlichen Behandlungsauftrag auch nicht entspricht, nämlich dass wir zum Beispiel nach Alter unterscheiden, oder dass wir nach sozialer Herkunft unterscheiden, deshalb braucht es eine klare Anleitung, wie man in dieser Situation umgeht, und das versuchen gerade die medizinischen Fachgesellschaften hier aufzuschreiben und dann auch so handhabbar zu machen, dass man in der Situation richtig entscheiden kann.
Wichtig dabei zum Beispiel ist nur ein Faktor, dass man nicht alleine entsche3iden muss vor Ort, sondern dass man es immer in einem Team tut. Wir nennen es Sechs-Augen-Prinzip, wo mehrere Leute die Verantwortung tragen, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass nicht alle Patienten behandelt werden können.
"Es wird immer noch überall Fieber gemessen"
Barenberg: Zum Schluss unseres Gesprächs vielleicht noch einen Augenblick zurück nach Wuhan und zu den Kontakten und Gesprächen, die Sie dort führen. Dort scheint tatsächlich aus medizinischer Sicht zunächst mal das Allerschlimmste überstanden. Spiegelt sich das auch in dem, was Sie von den Kolleg*innen dort hören?
Nagel: Auch dort ist es jetzt endlich angekommen. Manche Informationen haben wir früher als die Bewohner in Wuhan, dass man langsam wieder beginnt, die Ausgangssperre aufzulösen. Dabei muss man sagen, dass die Ausgangssperre sehr viel strikter eingehalten worden ist, als wir sie in Deutschland hier erleben – zum Teil gar nicht mit der Möglichkeit, nach draußen zu gehen.
Sie haben darauf hingewiesen: 23. Januar. Über 60 Tage haben hier viele Menschen in ihren Wohnungen ausharren müssen. Sie sind gut versorgt worden. Aber nichts desto trotz: Der Lagerkollaps, von dem jetzt alle sprechen, ist da sicherlich in einer ganz anderen Art und Weise eingetreten, als wir das hier kennen.
Nun wird es so sein, dass jeder angeben muss, wie seine Situation ist, seine gesundheitliche Situation. Das macht man in China heute bei WeChat. Dann kriegt man eine grüne oder eine rote Rückmeldung von WeChat und mit der muss man sich ausweisen. Das heißt, man wird unter Umständen auf der Straße angehalten. Es wird immer noch überall an allen zentralen Punkten Fieber gemessen. Es kann einem auch passieren, dass man kontrolliert wird, völlig unerwartet, und Fieber gemessen wird. Das heißt, man tut gut daran, seine Symptome richtig aufzuschreiben.
Dann beginnt man so langsam zum Beispiel in einer Ambulanz auch wieder zu behandeln, andere Patienten zu behandeln. Normalerweise kommen da bis zu tausend Patienten an einem Tagg; im Moment sind es 25. Auch daran kann man schon sehen, das geht jetzt alles sehr langsam. Wir haben aber darauf hingewiesen, dass Jens Spahn versuchen möchte, bis Ostern eine Struktur zu schaffen, wie man umgehen kann mit dem Leben nach diesem Shutdown, und da können wir von Wuhan natürlich extrem viel lernen, weil in den nächsten Wochen sich zeigen wird, wie man das gut und hoffentlich richtig macht.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.