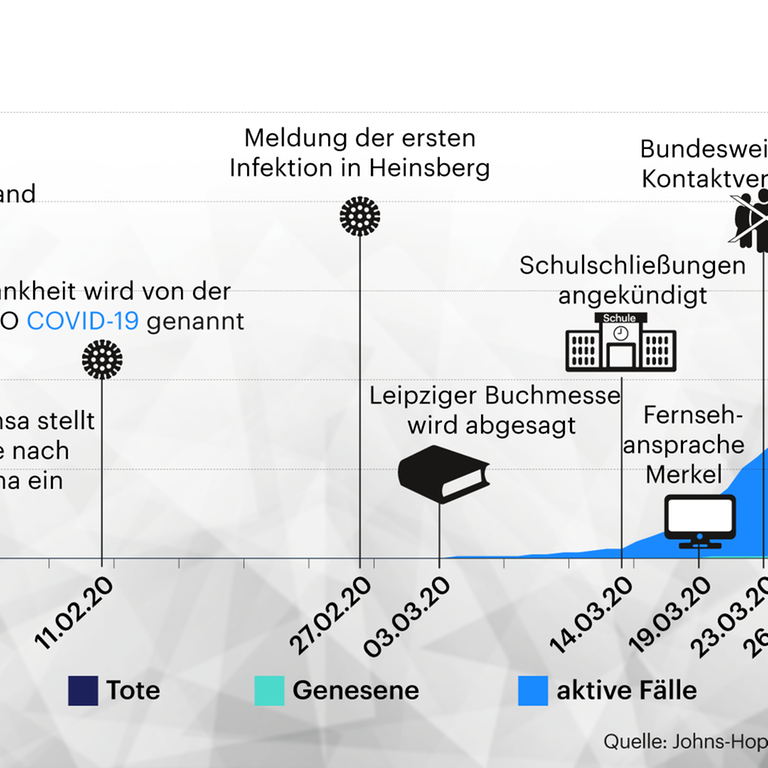In Mathare, einem der Slums in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, sind viel weniger Menschen unterwegs als üblich. Aus Angst vor dem Coronavirus sind viele auf’s Land geflohen. Das ist schlecht für Morris Jones, der am Straßenrand auf seinem Motorrad sitzt und auf Kunden wartet. Der 32-Jährige ist ein "Boda-Boda"-Rider, ein Motorrad-Taxifahrer. Die kenianische Regierung hat zwar alle Arbeitnehmer aufgefordert möglichst von zu Hause zu arbeiten, um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, aber daran kann er sich nicht halten.
"Das ist nun einmal die einzige Arbeit, die ich habe. Und ich muss ja meine Familie ernähren. Mir ist nichts so wichtig, wie meine Familie."
Bliebe er zu Hause, hätten er, seine Frau und ihre beiden Kinder nichts zu essen. Rund 80 Prozent der kenianischen Bevölkerung geht es wie ihm: sie arbeiten im informellen Sektor. Sozial abgesichert sind sie nicht. Morris Jones versucht sich so gut wie möglich an die Hygienevorschriften der Regierung zu halten: Er hat eine Flasche mit Desinfektionsmittel dabei, die er jedem Kunden als erstes hinhält. Und:
"Im Moment nehme ich immer nur einen Passagier mit. Viel zu tun gibt es sowieso nicht. Ich fahre jemanden irgendwo hin und muss dann vielleicht eine ganze Stunde warten, bis ich die nächste Fahrt habe."
Höchstens ein Passagier
Morris verdient also viel weniger als in normalen Zeiten. Denn genauso wie die anderen Boda-Boda-Fahrer quetscht er üblicher Weise auch mal drei Passagiere auf seine Sitzbank. Was er jetzt noch verdient, reicht kaum zum Überleben. Natürlich weiß Morris, dass die Ansteckungsgefahr in seinem Job auch bei nur einem Passagier extrem hoch ist.
"Höchstens einen Passagier mitzunehmen, ist das einzige, was ich im Moment tun kann. Zwei Meter Abstand kann ich einfach nicht einhalten."
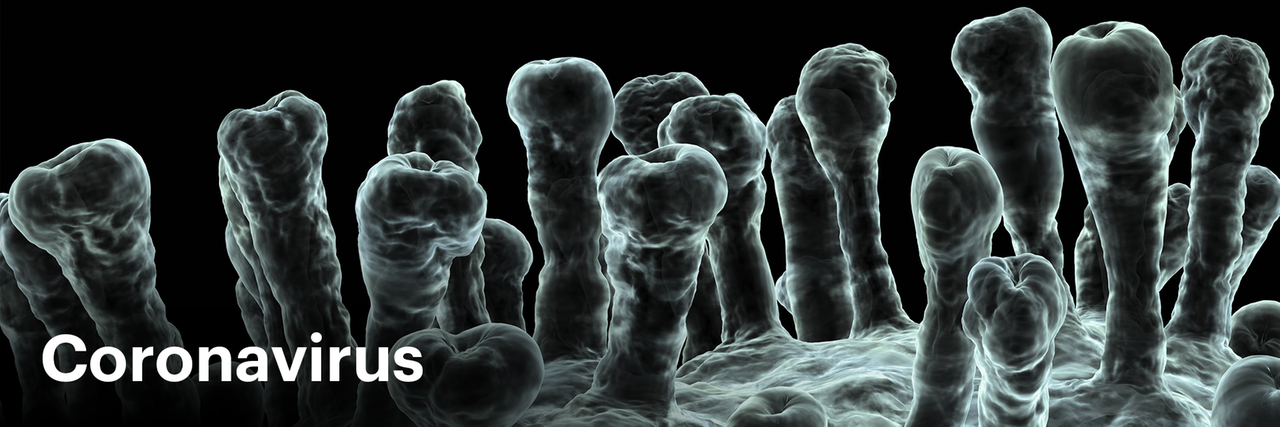
In der kenianischen Hauptstadt leben zwei Drittel der Bevölkerung in Slums: dicht gedrängt in einfachen Hütten, soziale Distanz ist nicht möglich. In den vielen Armenvierteln auf dem gesamten Kontinent ist das ähnlich. Dort können viele Menschen auch die Hygienevorschriften zum Schutz vor dem Coronavirus nicht einhalten: Sie haben zu Hause kein fließendes Wasser, müssen an öffentlichen Wasserstellen anstehen, häufig dicht gedrängt. Seife oder Desinfektionsmittel sind außerdem teuer. Hinzu kommt: Die Ausgangsbeschränkungen, die fast überall auf dem afrikanischen Kontinent erlassen wurden, bringen viele Menschen in Existenznot.
Die Lage ist verzweifelt, denn die weitgehenden Ausgangsbeschränkungen sind schwer durchzuhalten. Aber wer sich nicht daran hält, riskiert nicht nur festgenommen zu werden, sondern kassiert im Zweifelsfall sogar Prügel – und Schlimmeres. Polizei und Militär greifen vielerorts unverhältnismäßig hart durch. In Ländern wie Kenia, Uganda, Simbabwe oder Südafrika haben Sicherheitskräfte Schüsse auf Passanten abgegeben. Es gab sogar Tote. Passanten werden verprügelt, ausgepeitscht, gedemütigt. Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse werden eingesetzt. In Johannesburg ist eine Journalistin dabei ins Kreuzfeuer geraten.
Die Gewaltexzesse wecken dunkle Erinnerungen an Diktaturen und an die Polizeigewalt während der Apartheid. Sie schmälern das ohnehin geringe Vertrauen in die Regierungen und könnten zu massiven sozialen Spannungen führen. Menschen- und Bürgerrechtler wie Sithembiso Khuluse von der südafrikanischen Organisation "Right2Know" sind erschüttert.
"Mehr Angst vor Polizei und Militär, als vor dem Virus"
"Was wir hier erleben, hat nichts damit zu tun, was Präsident Ramaphosa angekündigt hat. Polizei und Militär sind im Einsatz, um der Bevölkerung zu helfen, nicht um sie zu terrorisieren. Aber jetzt sehen wir, wie Soldaten und Polizisten Menschen auf der Straße und sogar auf deren Grundstücken zusammenschlagen. In den wohlhabenderen Vororten ist das kein Problem, aber in den Townships haben viele Menschen mehr Angst vor Polizei und Militär, als vor dem Virus."
Die Angst vor Gewalt, Krankheit und Lebensmittelknappheit hat viele Township-Bewohner schon frühzeitig regelrecht in die Flucht geschlagen. In den drei Tagen zwischen der Ankündigung und dem Beginn des so genannten Lockdowns, sind sie in vollbesetzten Minibustaxen und Bussen in ihre ländliche Heimat gereist. Ein Alptraum mit Blick auf das Ansteckungsrisiko.
Nonhle Mbuthuma lebt an der Küste des ehemaligen Homelands Transkei. Verstreute Rundhütten prägen die Hügellandschaft. Nur wenige Teerstraßen führen in diese entlegene Region. Die Familien leben von dem, was sie auf ihren kleinen Feldern anbauen und von dem Geld, das ihnen Verwandte aus der Stadt schicken. Dass die Städter nun Hals- über Kopf den Heimaturlaub angetreten haben, beobachtet Mbuthuma mit Sorge.
"Nicht leicht, einem Bruder oder einer Schwester zu sagen, dass sie nicht willkommen sind"
"Viele glauben, dass sie hier sicherer sind: Wir haben viel Platz, die Häuser stehen weit voneinander entfernt. Auch zu essen gibt es hier genug. Für uns ist es nicht leicht, einem Bruder oder einer Schwester zu sagen, dass sie nicht willkommen sind. Aber wir haben auch Angst vor dem Virus, dem wie hier fast schutzlos ausgeliefert wären. Wir haben zum Beispiel kein fließendes Wasser. Das wird immer noch aus den Flüssen geholt."
Ständiges Händewaschen ist also nicht möglich, so wie in anderen Gegenden des Kontinents. Und weil die Informationen der Regierung bis hierhin noch kaum durchgedrungen sind, gehen Mbuthuma und ihre Mitstreiter des "Amadiba Crisis Commitee" nun selbst von Rundhütte zu Rundhütte.
"Nachdem wir von dem Virus erfahren haben, haben wir direkt damit begonnen, die hiesige Bevölkerung aufzuklären. Wir verteilen auch Hand-Desinfektionsmittel, die wir selbst besorgt haben. Von der Regierung haben wir noch keine Hilfe erhalten. Dabei wäre es fatal, wenn sich dieses Virus auch hier ausbreiten würde. Wir haben keine Klinik in unmittelbarer Nähe, kein Gesundheitszentrum, nichts. Unsere Dorf-Gemeinschaften könnten einfach ausgelöscht werden."

Das Virus hat den afrikanischen Kontinent erst mit einiger Verzögerung erreicht. Verglichen mit Europa sind die Infektionszahlen zwar immer noch niedrig, aber sie steigen deutlich an. Tedros Ghebreyesus, Leiter der Weltgesundheitsorganisation WHO, warnte schon Mitte März, Afrika müsse sich auf das Schlimmste vorbreiten.
Michel Yao koordiniert die Nothilfe der WHO für Afrika von Brazzaville im Kongo aus.
"Inzwischen haben die meisten Länder Fälle gemeldet. In etwa der Hälfte von ihnen handelt es sich immer noch um sporadische Infektionen, die von außen kamen. Aber in der anderen Hälfte hat die lokale Übertragung begonnen. Wenn die Regierungen darauf nicht prompt und rigoros reagieren, kann das sehr schnell außer Kontrolle geraten. Die Zahl der Erkrankungen wird die Zahl der Behandlungsmöglichkeiten dann rasch übersteigen. Wir haben vielleicht noch ein Zeitfenster von einer Woche, um das zu verhindern."
Michel Yao koordiniert die Nothilfe der WHO für Afrika von Brazzaville im Kongo aus.
"Inzwischen haben die meisten Länder Fälle gemeldet. In etwa der Hälfte von ihnen handelt es sich immer noch um sporadische Infektionen, die von außen kamen. Aber in der anderen Hälfte hat die lokale Übertragung begonnen. Wenn die Regierungen darauf nicht prompt und rigoros reagieren, kann das sehr schnell außer Kontrolle geraten. Die Zahl der Erkrankungen wird die Zahl der Behandlungsmöglichkeiten dann rasch übersteigen. Wir haben vielleicht noch ein Zeitfenster von einer Woche, um das zu verhindern."
Die WHO verschafft sich gerade einen Überblick darüber, wie viele Intensivbetten und Beatmungsgeräte die einzelnen Länder überhaupt haben. Einige von ihnen seien schon damit überfordert, überhaupt die Daten zur Verfügung zu stellen, meint Yao.
"In den meisten Ländern höchstens 50 Intensivbetten"
"Nach allem, was wir bisher gehört haben, gibt es in den meisten Ländern höchstens 50 Intensivbetten. Das wird bei einer steigenden Fallzahl nicht reichen. In den meisten Ländern wird das eine sehr schwierige Situation werden."
Die WHO versucht deshalb zusätzliche Behandlungszentren mit Intensivbetten aufzubauen - so, wie sie das bereits früher bei Ebola-Epidemien auf dem Kontinent gemacht hat. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Infizierten von anderen Kranken räumlich isoliert werden. Der Aufbau dieser Zentren ist ein Wettlauf gegen die Zeit - und das unter erschwerten Bedingungen. Denn die meisten Länder haben ihre Grenzen geschlossen und internationale Flüge verboten. Frachtflüge sind zwar erlaubt, aber die WHO kann trotzdem nicht so schnell handeln, wie sie möchte: Früher nutzte sie auch Passagierflüge, um Laborausrüstung, Schutzkleidung oder Testkits zu transportieren. Weil jetzt nur noch die Frachtflüge bleiben, dauert alles länger. Vieles, was Leben retten kann, steckt jetzt lange fest, vor allem Laborausstattung und Schutzkleidung. Michel Yao:
"Wenn sich die Situation noch verschärft, werden viele Länder die Unterstützung von medizinischem Personal oder die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen brauchen. Und während die Gesundheitssysteme schon durch die COVID-19 Fälle überlastet werden, gehen ja andere Epidemien und Krankheiten weiter. In einigen Gegenden kämpfen wir immer noch mit einer Masern-Epidemie, und die Malaria-Erkrankungen hören auch nicht auf. Wir müssen die Behandlungskapazitäten also auf jeden Fall aufstocken. Deshalb appellieren wir seit zwei Wochen an die afrikanischen Länder, dass sie trotz der Grenzschließungen einen humanitären Korridor offenhalten, damit Unterstützungsteams und Nachschub in die Länder gebracht werden können."
Die WHO versucht deshalb zusätzliche Behandlungszentren mit Intensivbetten aufzubauen - so, wie sie das bereits früher bei Ebola-Epidemien auf dem Kontinent gemacht hat. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Infizierten von anderen Kranken räumlich isoliert werden. Der Aufbau dieser Zentren ist ein Wettlauf gegen die Zeit - und das unter erschwerten Bedingungen. Denn die meisten Länder haben ihre Grenzen geschlossen und internationale Flüge verboten. Frachtflüge sind zwar erlaubt, aber die WHO kann trotzdem nicht so schnell handeln, wie sie möchte: Früher nutzte sie auch Passagierflüge, um Laborausrüstung, Schutzkleidung oder Testkits zu transportieren. Weil jetzt nur noch die Frachtflüge bleiben, dauert alles länger. Vieles, was Leben retten kann, steckt jetzt lange fest, vor allem Laborausstattung und Schutzkleidung. Michel Yao:
"Wenn sich die Situation noch verschärft, werden viele Länder die Unterstützung von medizinischem Personal oder die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen brauchen. Und während die Gesundheitssysteme schon durch die COVID-19 Fälle überlastet werden, gehen ja andere Epidemien und Krankheiten weiter. In einigen Gegenden kämpfen wir immer noch mit einer Masern-Epidemie, und die Malaria-Erkrankungen hören auch nicht auf. Wir müssen die Behandlungskapazitäten also auf jeden Fall aufstocken. Deshalb appellieren wir seit zwei Wochen an die afrikanischen Länder, dass sie trotz der Grenzschließungen einen humanitären Korridor offenhalten, damit Unterstützungsteams und Nachschub in die Länder gebracht werden können."
Zentraler Ansprechpartner auf dem Kontinent ist das Afrikanische Zentrum für Krankheitskontrolle und Vorsorge ‚Africa CDC‘. Dort laufen die Daten aus den über 50 Ländern zusammen, dort werden die Maßnahmen so weit wie möglich koordiniert, Informationen ausgetauscht, gemeinsame Strategien geplant. Das Zentrum unterstützt Staaten, die noch keine Testmöglichkeiten haben und bildet Laborpersonal aus. Wöchentlich informiert Direktor John Nkengasong über Fortschritte und Bedarf.
"Der Höhepunkt der Infektionen steht noch bevor, daran besteht kein Zweifel. Genaue Vorhersagen für den gesamten Kontinent sind schwierig, aber wir gehen davon aus, dass viele Länder gegen Ende des Monats über zehntausend Fälle verzeichnen. Ein Vorteil könnte sein, dass unsere Bevölkerung jung ist: 70 Prozent der Afrikaner sind jünger als 30 Jahre. Das könnte bedeuten, dass weniger Menschen an dem Virus sterben. Aber es ist keine Garantie. Wir wissen noch nicht, wie sich das Virus auf Menschen auswirkt, die mangelernährt oder HIV-positiv sind, Tuberkulose oder Malaria haben."
Vorbildliches Krisenmanagement in Südafrika
Auch aus diesem Grund haben Länder wie Südafrika, in dem die meisten Infektionsfälle des Kontinents bekannt sind, sehr früh und sehr drastisch reagiert. Die Zeit der Ausgangsbeschränkungen wird für Massenscreenings genutzt, vor allem in den dicht besiedelten Armenvierteln. Dieses Krisenmanagement sei vorbildlich, betont Nkengasong.
"Es freut mich sehr, dass Südafrika eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, zu denen etwa mobile Labors gehören. Mitarbeiter gehen von Tür zu Tür und testen die Menschen und isolieren jene, die positiv sind. So soll das sein."
"Es freut mich sehr, dass Südafrika eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, zu denen etwa mobile Labors gehören. Mitarbeiter gehen von Tür zu Tür und testen die Menschen und isolieren jene, die positiv sind. So soll das sein."
Aber auch Südafrika stößt an seine Grenzen: Die Labors kommen bislang mit der Arbeit nicht nach, Reagenzmittel sind knapp. Rund 60.000 Menschen sind bislang getestet worden, mehr als in anderen Ländern des afrikanischen Kontinents, aber wesentlich weniger als in Europa. Nun sollen Diagnosegeräte für Tuberkulose auch für Corona-Schnelltests eingesetzt werden. Bis Ende des Monats will das Land in der Lage sein, jeden Tag über 30.000 Tests auszuwerten, so der ehrgeizige Plan. Denn obwohl die Fallzahlen langsamer steigen, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Maßnahmen greifen, warnt Südafrikas Gesundheitsminister Zweli Mkhize davor, dass es für eine Entwarnung viel zu früh sei.
Die Ruhe vor einem verheerenden Sturm
"Bislang haben wir nach zu eng definierten Kriterien getestet: Jene, die sich mit Symptomen an uns gewandt haben oder aus Risikoländern zurückgekehrt sind. Das heißt, dass wir das wahre Ausmaß der Krise noch gar nicht kennen. Dazu müssen wir Hunderttausende testen. Und wir müssen die Aufklärungskampagnen weiter verstärken. Nächsten Monat beginnt die Grippesaison. Viele Menschen werden die Symptome nicht von einer COVID-19-Infektion unterscheiden können. Es besteht die Gefahr eines Ansturms auf unsere Krankenhäuser und Kliniken, durch den sich das Virus weiterverbreiten kann. Das bedeutet, dass der derzeit eher geringe Anstieg von Fällen lediglich die Ruhe vor einem verheerenden Sturm sein könnte."
Während Südafrika mit aller Kraft versucht, diesen Sturm noch abzuwenden, sind ihm ärmere, von Krisen geprägte Staaten des Kontinents, hilflos ausgeliefert. Etwa das Nachbarland Simbabwe. Dort hätten Ärzte sogar kurzfristig mit einem Streik auf ihre verzweifelte Situation aufmerksam gemacht, erzählt Tawanda Zvakada, Vorsitzender des Verbands der Krankenhausärzte.
"Wir haben schon lange vor dieser Krise von der Regierung gefordert, uns wenigstens mit dem Nötigsten auszustatten. Es fehlt an allem: Mundschutzen, Brillen, Kitteln. Inmitten dieser Pandemie jedoch ohne Schutzkleidung zu arbeiten, grenzt an Selbstmord. Deshalb sind derzeit nur jene von uns im Einsatz, die entsprechend ausgestattet sind. Es mangelt auch an sauberem Wasser, Medikamenten und Beatmungsgeräten. Wenn man sieht, was dieses Virus in Industriestaaten angerichtet hat, dann können wir uns ausmalen, was passiert, wenn es auch unsere Nation mit aller Wucht trifft."
Ein Schreckensszenario, das auch überall dort droht, wo Kriege die Infrastruktur zerstört haben und Millionen von Menschen auf der Flucht sind. Beispiel Somalia: Das Land ist seit rund 30 Jahren im Krieg, die islamistische Shabaab-Miliz kontrolliert viele Regionen. Mehr als zweieinhalb Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Das Gesundheitssystem ist komplett privatisiert, jede Behandlung kostet Geld. Ulrike Last arbeitet für die Hilfsorganisation Handicap International in Somalia.
Einfluss der Coronakrise auf die Sicherheitslage
"Und es ist jetzt so, im Ernstfall einer Gesundheitskrise in einer Familie, dass viele Familien in Somalia selber schon eine Triage zuhause machen, weil sie überlegen müssen: Können wir die Behandlung von der Großmutter, von dem Großvater, von unserem Kind überhaupt bezahlen? Und das ist natürlich eine große Befürchtung, wenn jetzt der Coronavirus kommt: Können wir es uns überhaupt leisten, den oder diejenige zum Krankenhaus zu bringen? Und dann eventuell noch die Behandlung vor Ort?"
Oder im Sahel. Dort hat sich die Sicherheitslage in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert, durch Angriffe islamistischer Terrorgruppen und durch die Gewalt zwischen verfeindeten Volksgruppen. Allein in Burkina Faso sind rund 800.000 Menschen auf der Flucht, 12 Millionen von Hunger bedroht. Sam Mednick ist freie Journalistin für "The New Humanitarian" und zurzeit in Burkina Faso.
"Die Frage ist, welchen Einfluss die Coronakrise auf die Sicherheitslage haben wird. Werden die bewaffneten Gruppen die Situation ausnutzen? Islamistische Gruppen haben immer davon profitiert, wenn Staaten nicht in der Lage sind der Bevölkerung die grundlegendsten sozialen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Mit der Corona-Krise wird es für sie sehr leicht sein die Rechtmäßigkeit des burkinischen Staates in Frage zu stellen. Sie brauchen nur zu sagen: Der Staat garantiert noch nicht einmal eine Basis-Gesundheitsversorgung!"
Die Coronakrise verschärft die ohnehin schon vorherrschende Not: medizinisch und wirtschaftlich. Humanitäre Hilfe zu leisten ist also jetzt besonders wichtig. Und auch besonders schwer, weil die Grenzen fast überall geschlossen und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Simone Pott ist Sprecherin der deutschen Welthungerhilfe.
"Das ist eine große Herausforderung in den letzten zwei Wochen gewesen. Aber es wird sich eventuell auch noch fortsetzen. Zum einen, weil viele Kollegen, also auch internationale Kollegen, gar nicht in Länder zurückkamen, in die sie zurückwollten, weil sie vielleicht gerade im Urlaub oder auf einem Training waren."
Viele Wirtschaftswege funktionieren nicht mehr
Hinzu kommt, dass in immer mehr Ländern auch Reisen zwischen den Regionen einschränken. Auch lokale Mitarbeiter kommen dann nicht mehr in die Gebiete, in denen ihre Hilfe gebraucht wird.
Eine weitere Schwierigkeit: Die Beschaffung von ausreichend Nahrungsmitteln und Hilfsgütern. Denn viele der normalen Wirtschaftswege funktionieren wegen der Coronakrise nicht mehr.
"Oftmals werden ja Nahrungsmittel zum Beispiel vom Welternährungsprogramm aufgekauft und dann in die Länder geliefert. Das muss aber eben in den Häfen, zum Beispiel, wenn große Container ankommen - das muss ja alles auch entladen werden, auf Lastwagen weiter weitertransportiert werden. Diese ganzen Transportketten leiden im Moment natürlich auch."
Eine weitere große Sorge ist, dass die Spendenbereitschaft von Privatleuten sinkt und Regierungen an der Entwicklungshilfe sparen, weil auch wohlhabende Länder nun in eine Rezession rutschen. Zwar hat die EU-Kommission Entwicklungsländern weltweit gerade Finanzhilfen von mehr als 15 Milliarden Euro versprochen. Hilfe in der Coronakrise bekommt der Kontinent momentan vor allem von großen Stiftungen, etwa der des Chinesen Jack Ma oder des Amerikaners Bill Gates. Aber auch afrikanische Milliardäre greifen tief in die Tasche: Von Aliko Dangote in Nigeria über Strive Masiyiwa in Simbabwe bis zu Patrice Motsepe und der Oppenheimer-Familie in Südafrika, um nur einige Namen zu nennen. Allen ist klar, dass der Kontinent sich inmitten dieser Pandemie nicht auf Hilfe von außen verlassen kann, sondern selbst Kräfte mobilisieren muss. Viele Bürger hoffen, dass dieser Elan und die grenzüberschreitende Kooperation auch noch nach der Coronakrise erhalten bleiben, um andere Probleme des Kontinents ebenso beherzt anzupacken.