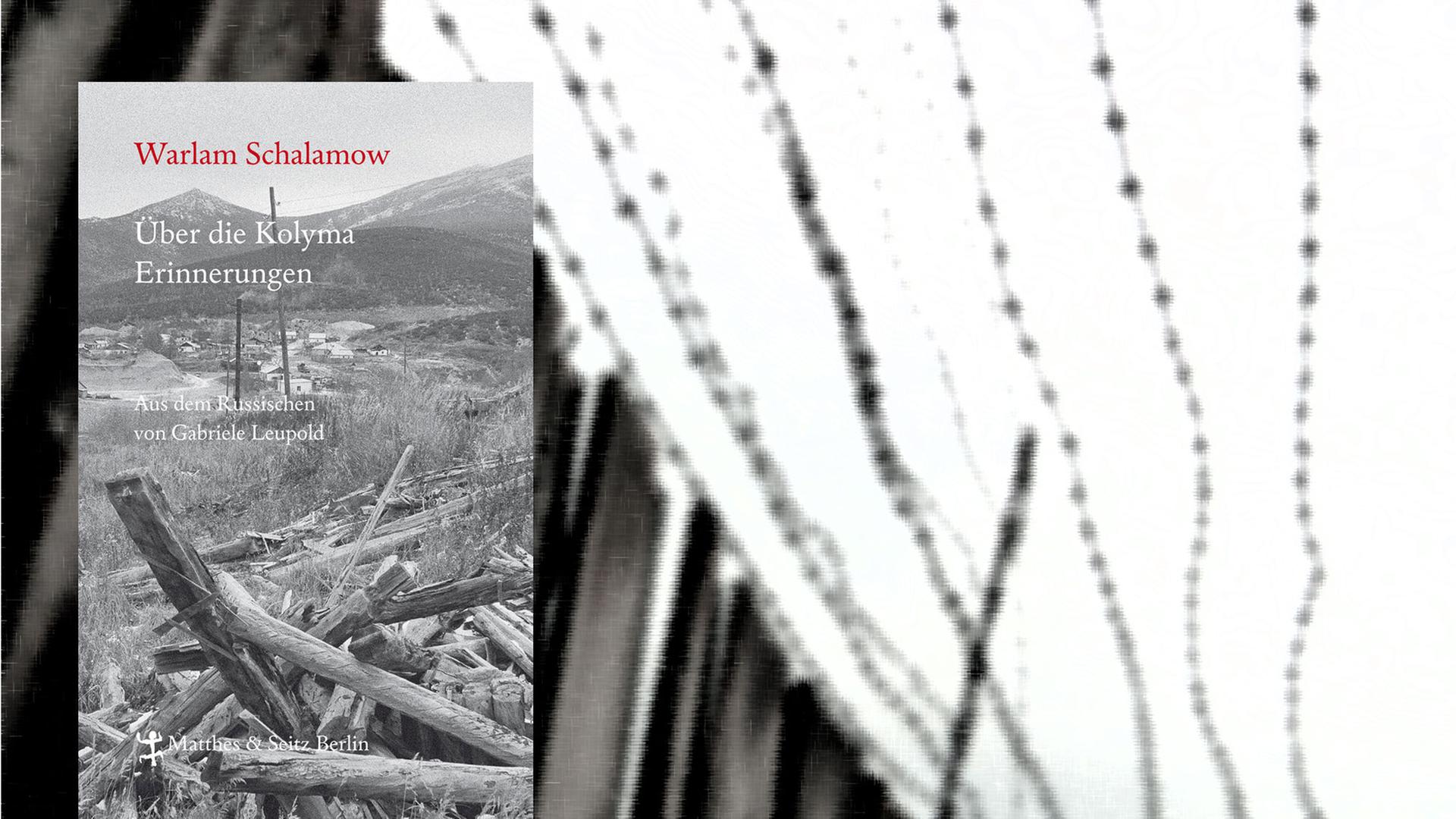Sie tragen dicke, aber zerlöcherte Jacken, Mützen und zerschlissene Stiefel. Doch trotz winterlicher Kleidung geht es für sie ums nackte Überleben angesichts der unbarmherzigen Kälte, der willkürlichen Schikanen ihrer Bewacher und des nagenden Hungers:
Warlam Schalamow war zur Zeit des Stalinismus' fast 20 Jahre im Gulag inhaftiert. Nach seiner Entlassung schrieb er seine "Erzählungen aus Kolyma", also jener lebensfeindlichen Region in Sibirien, wo er, wie so viele, in Gefangenschaft bei schwerster Zwangsarbeit dahinsiechte. Für den Theaterabend "Am Kältepol" hat der russische Regisseur Timofej Kuljabin sechs dieser Erzählungen ausgewählt. In beinahe protokollarischem Ton, aber gerade durch die Einfachheit so eindringlich, beschreibt Schalamow Menschen, die Tote ausgraben, um deren Kleider habhaft zu werden; die Hunde schlachten, um zu essen zu haben; oder die wochenlang neben verendeten Mithäftlingen schlafen, die Seelen so stumpf wie ihre erfrorenen Füße taub sind.
Live-Übertragung per Kamera
Schalamow beschreibt ein Elend, das man sich als deutscher Theaterbesucher, satt und warm im Zuschauersessel sitzend, in seiner ganzen Entsetzlichkeit wohl nie auch nur annähernd zutreffend auszumalen vermag. Die Wucht der klaren und, ja auch kalten Sprache von Schalamow trifft einen dennoch. Theater aber ist nicht nur eine Sache des Hörens, sondern auch des Sehens. Und so muss sich die Regie das Undarstellbare doch irgendwie ausmalen. Kuljabin trennt dafür die Text- von der Bildebene. Links auf der Bühne ein Lesetischchen, an dem sechs Schauspielerinnen abwechselnd Platz nehmen, um die sechs Erzählungen mikrophonverstärkt vorzutragen. Rechts ein uneinsehbarer Container, in dessen Innerem die übrigen das Erzählte stumm nachspielen. Per Live-Kamera wird das Geschehen auf einer Leinwand über der Bühne übertragen.
Um eine Eins-zu-Eins-Bebilderung zu vermeiden, die leicht dazu führen könnte, dass die Aufführung zum Rührstück verkommt, hat Kuljabin zu verschiedenen Mitteln der Verfremdung gegriffen. Da ist zum einen natürlich die rein weibliche Besetzung, während bei Schalamow ausschließlich von männlichen Strafgefangenen die Rede ist. Zum anderen sind Erzählung und Darstellung selten genau deckungsgleich. Ist zum Beispiel von einem Häftling die Rede, der einen Holzstamm schleppt, sieht man in der Aufnahme aus dem Container eine Schauspielerin mit dem Stamm auf den Schultern, aber reglos auf der Stelle stehend, die langsam vor Erschöpfung in die Knie sackt.
Kraft durch Schlichtheit im Text
Zudem gibt es eine überwachungsartige Kamera an der Decke des Containers, die immer wieder Totalen aus dessen Innerem zeigt, in denen man das Making-Of der Spielszenen sieht: den Live-Kameramann beim Filmen oder die Bühnenarbeiter, die Requisiten herein- und heraustragen. Doch trotz aller Verfremdung und Verschiebungen zwischen Text und Bild: Kuljabins theatralische Phantasie bleibt illustrativ. Es wäre zu hart, ihm vorzuwerfen, dass seine Inszenierung Elendskitsch produziert. Aber leider: in die Richtung tendiert der Abend sehr wohl. Wäre da nicht der Text, der in seiner Schlichtheit Kraft entwickelt.
Fast möchte man die Augen schließen und nur zuhören. Erfreulich, dass Kuljabin komplett auf den emotionalen Geschmacksverstärker Musik verzichtet hat und auf der auditiven Ebene allein auf den Vortrag der Schauspielerinnen setzt, die sich gestalterisch stark zurücknehmen. In den seltenen Dialogen deuten sie unterschiedliche Charaktere durch behutsame Stimmlagenwechsel allenfalls an. Ansonsten herrscht ein nüchterner Tonfall vor, der dem Text gut bekommt. Die Bilder aber, die der Abend dazu liefert, fallen dahinter leider weit zurück.