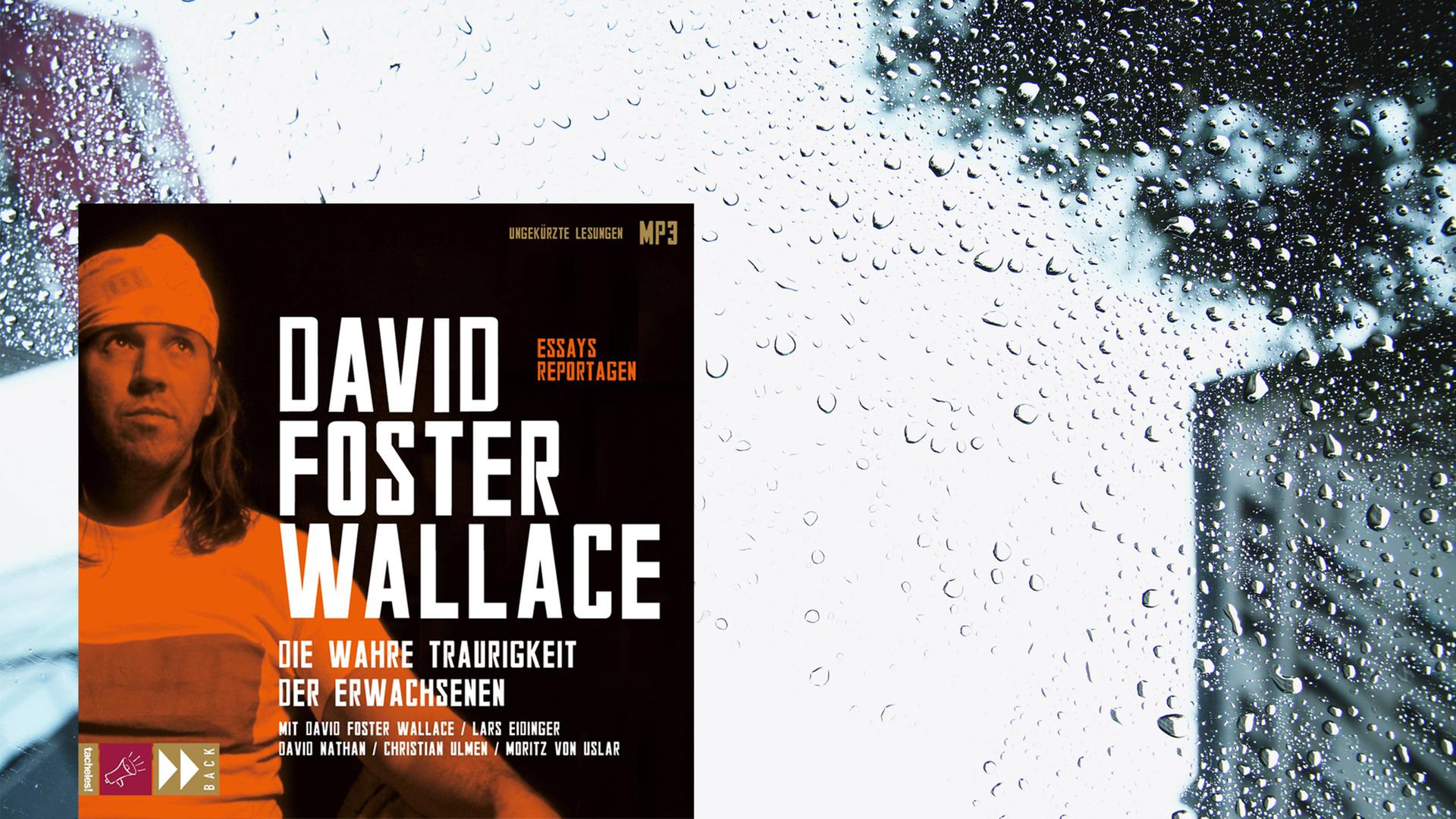Wahrheit und Heuchelei und die Furcht vor den echten Menschen. Nichts trieb David Foster Wallace mehr um. Das wird nach über tausend Seiten Lektüre seiner gesammelten essayistischen Texte und Reportagen überdeutlich. Bis auf ein paar frühe Rezensionen, die aufzunehmen dem literarischen Profil von Wallace auch noch ganz gut getan hätte, ist hier alles da. Wie etwa die Texte, die er über Tennis geschrieben hat. Als jemand, der selbst als Jugendlicher lange auf hohem Niveau gespielt hat, war für ihn der Sport Gegenstand mehrerer autobiografischer Beobachtungen, Meditationen, aber auch der Erforschung von Strategien und Schlägen berühmter Spielerinnen und Spieler wie Tracy Austin oder Roger Federer. Sein Forschungsinteresse galt dabei fast immer dem Versuch, das Spiel zu transzendieren. Nicht, um sich in metaphysischen Erwägungen zu verlieren, sondern um in vermeintlichen Banalitäten, ein einfachen Gesten und Handlungen etwas über das sich selbst gerade nicht bezweifelnde Ich herauszufinden. Eine absolute Präsenz, auf dem Platz etwa, erzeugen große Tennisspieler dadurch, so Wallace, dass sie allen Ablenkungen widerstehen und in ihrem Kopf einfach nichts mehr geschieht. Alle Bewegungsabläufe sind tausendmal einstudiert und laufen wie automatisiert. Das Selbst wird abgeschaltet, der Verstand überbrückt und ein erleuchteter Sieger scheint geboren. So jedenfalls entwirft Wallace 1992 in einem kurzen Text für einen Moment das Bild, dem er, wie er immer wieder betont, selbst so gar nicht entspricht. Eine kurze Zeit lang sei er durchaus erfolgreich gewesen, aber auch nur, weil er, der "ungroße Sportler", wie er sich nennt, die tückischen Winde auf den Tennisplätzen von Bloomington, Illinois, besser einschätzen und für sein ansonsten nicht sonderlich versiertes Spiel ausnutzen konnte. Folglich kann er in Bezug auf sich selbst auch nur von Versagen und Scheitern erzählen, schlimmer noch, von sich als Heuchler, der nur so tut, als könne er etwas. Aber genau daraus leitet er indirekt seine Aufgabe als Schriftsteller ab.
"Eine Standarderfahrung beim Umgang mit der Wahrheit ist, dass sie ein grausames Paradox birgt. Möglicherweise sind wir Zuschauer, denen die göttliche Gabe der Sportler versagt geblieben ist, die Einzigen, die die Erfahrung dieser Gabe wahrhaft sehen, in Worte fassen und zum Leben erwecken können. Und die Menschen, die diese Gabe sportlicher Genialität empfangen haben und sie umsetzen können, sind notgedrungen blind und stumm ihr gegenüber - und das nicht, weil Blindheit und Stummheit der Preis der Gabe wären, sondern weil sie ihr Wesen ausmachen."
Hier auf Tennis bezogen, zugleich ganz so, als hätte Wallace die Texte des Literaturtheoretikers Paul de Man über Blindheit und Einsicht geradezu verinnerlicht, um sie sogleich moralisch zu überhöhen. Wenn Wallace sich 2006 dann in einer ausführlichen Kontemplation Roger Federer widmet, geht er gar von einer "fast schon religiösen Erfahrung" aus. Man muss Federers Spiel nur lange genug zuschauen und es wird sich, so Wallace, diese gültige Wahrheit herausstellen. Wahrheit setzt Wallace dabei immer wieder nicht nur mit einem relativen Nichts gleich, sondern auch mit einer Leichtigkeit, die eigentlich nicht erkennbare Anstrengung, Mühelosigkeit meint, um dann diesen Wahrheitskomplex auch noch schön zu nennen. Für Wallace mischt sich das alles nicht einfach, sondern erscheint geradezu folgerichtig als metaphysische Wahrheit: Die Leere im Kopf, anstrengungslose Konzentration oder besser: reine Anwesenheit und dann die Schönheit, die, von außen gesehen, daraus resultiert.
Die Helden und der Tod
Nun darf man das Insistieren auf solchen Kategorien nicht missverstehen als moralisches Schwadronieren. Denn natürlich weiß Wallace auch, dass er sich etwa mit seiner Federer-Huldigung in popkulturellen und erzählerischen Kontexten bewegt. Wallace beschreibt die Attitude von Helden. Helden, die durch Film und Fernsehen in Handlungsrahmen verfügbar sind, die auf "kreative Weise an den Tod gekoppelt" sind.
"Die Tatsache, dass uns unablässig nahegelegt wird, uns mit Figuren zu identifizieren, für die der Tod keine ernst zu nehmende kreative Option ist, hat meiner Meinung nach ihren Preis. Wir als Publikum und Individuen, Sie da drüben und ich hier hüben, verlieren jedes Gespür für Eschatologie, ergo für Teleologie, und leben in einem Augenblick, der paradoxerweise keine intrinsische Bedeutung oder ein absehbares Ende mehr hat und recht buchstäblich ewig dauert. Wenn wir die einzigen Tiere sind, die im Voraus wissen, dass sie irgendwann sterben müssen, sind wir wahrscheinlich auch die einzigen Tiere, die sich voller Fröhlichkeit auf die anhaltende Leugnung dieser unleugbaren und bedeutsamen Wahrheit einlassen. Wenn die Leugnungen der Wahrheit durch die Unterhaltungsbranche immer wirksamer, allgegenwärtiger und verführerischer werden, besteht die Gefahr, dass wir irgendwann vergessen, was da geleugnet wird. Das ist beängstigend. Denn an einem gibt es für mich nichts zu rütteln: Wenn wir vergessen, wie man stirbt, vergessen wir, wie man lebt."

1988 ist dieser Text in einer Literaturzeitschrift erschienen und liest sich einerseits wie ein Abstract für den großen Roman "Unendlicher Spaß" und andererseits wie eine dann doch noch gestrichene Passage aus der Rede "Das hier ist Wasser" von 2005, die den hier zu besprechenden Band beschließt und mit der Wallace posthum auch noch mal bei einem ganz neuen Publikum als tragikomischer Ratgeber in Sachen Lebenskunst reüssierte. Dass Leben eine Übung im Sterbenlernen ist, haben schon viele andere Schriftsteller und Essayisten festgestellt. So betulich Wallace da bisweilen wird, wo er moralisiert, so scharfkantig, dicht gemixt und vor allem unendlich sicher in Tempo und Rhythmus der Prosa und in der Wahl der richtigen (und zugleich manchmal unmöglichen) Wörter steht das alles da. Sprachlich erzeugt Wallace so eine ungeheure Nähe, der man sich nur schwer entziehen kann und die so unterhaltsam ist, dass man das Drama des selbsternannten Heuchlers auf Wahrheitssuche bereitwillig in die Kulisse schiebt.
Wahrheit in einer verkommenen Welt
Doch gerade die nun vorliegende, umfassende Sammlung, in der die bekannten Stücke über den grotesken Horror von Karibikkreuzfahrten, die Wohlstandsobszönitäten eines riesigen Hummerfestivals oder die Tristesse einer Pornoproduktion ebenso vorkommen wie etliche, vor allem frühe Texte, die auch im Original erst nach Wallace’ Tod in Buchform publiziert wurden, - gerade in dieser backsteindicken Gesamtschau wird die starke Moralität seines Schreibens eindrücklich. Ob Roger Federer wirklich aus Fleisch und Blut ist, wie komisch man Kafka eigentlich lesen kann, wie eine ebenso besserwisserische wie kluge wie auch höchst unterhaltsame und endlos lange Rezension eines Wörterbuchs gelingt oder wie man erbarmungslos genau und immer noch, nicht erst seit Trump, überaus aktuell das ebenso rechtsradikale wie populäre Talkradio in den USA analysiert: Immer geht es darum, wieviel Wahrheit in einer durch und durch verkommenen Welt noch möglich ist. Lange Zeit zumindest, nicht bis zum Ende seines kurzen Lebens, hat Wallace die Literatur für eine Möglichkeit gehalten, in diesem Dilemma als eine Art Sonde zu dienen. Er vertraute auf ihre …
"... so lebenswichtige wie schwindende Funktion, uns an die unendlichen Zugriffsmöglichkeiten der Literatur zu erinnern, sie lassen Hirne pochen wie Herzen, sie rechtfertigen die Vermählung von Denken und Fühlen, Abstraktion und gelebtem Leben, transzendenter Wahrheitssuche und alltäglicher Plackerei, Vermählungen, die in unserer glücklichen Ära der technischen Verstopfung und des Unterhaltungsmarketings anscheinend zunehmend nur noch in der Fantasie möglich sind."
Was Wallace 1990, als er das schreibt, nicht hindert, im selben Text, der sich um David Marksons experimentellen Roman "Wittgensteins Mätresse" dreht, seine furchteinflößenden Fähigkeiten in formaler Logik zu demonstrieren. Er beweist nicht nur seine beeindruckenden Kenntnisse der Weltliteratur, um diesem nur Insidern bekannten Autor zu huldigen, sondern natürlich auch, dass er Wittgenstein in- und auswendig kennt. Aber gerade in diesem Spagat, zeigt Wallace auch die Pole vor, zwischen denen er selbst oszilliert. Er erzählt, wie sein Vater, ein Philosophie-Professor ihm erklärte, dass Wittgenstein mit sich selbst hoffnungslos zerstritten war.
"Wittgenstein war nämlich ein schräger Asketiker. Er verleugnete seinen Körper und ließ seine Sinne hungern -, allerdings nicht, um - wie die meisten mönchischen Persönlichkeiten - schlicht eine konsequente Versorgung des Geists zu genießen. Anscheinend fuhr er darauf ab, sein Selbst zu leugnen, indem er in seinen Essays über philosophische Wahrheit die Dinge leugnete, die ihm am meisten bedeuteten."
Die Fülle der Leere, die Bedeutung des Schweigens umkreist auch Wallace in großer Beredsamkeit. Da hinein steigert sich nicht zuletzt der gesamte letzte Teil von "Unendlicher Spaß", dem Roman, an dem Wallace um die Zeit dieses Essays über Markson eben auch schrieb. Dass Wallace alles andere als ironisch dachte und auch seine Texte weit weg von irgendwelchen Ironiepostulaten der Postmoderne wissen wollte, ist lange Zeit geflissentlich übersehen worden. Doch auch das - die Ernsthaftigkeit, die moralische Aufladung und die vehemente Abgrenzung zur Ironie - lässt sich in den Essays explizit nachlesen, insbesondere dann, wenn es ums Fernsehen und die Unterhaltungsindustrie geht. Dass hier ein TV-Junkie schreibt, muss nicht unbedingt als Widerspruch gesehen werden. Wallace hat schlicht über all das geschrieben, was ihn permanent durch die Mangel gedreht hat. Und der Tücke der Ironie misst er unter seinen und den Plagen der westlichen Konsumgesellschaft eine ganz besondere Rolle zu.
Angst vor der Lächerlichkeit
"Ich möchte Sie davon überzeugen, dass Ironie, schweigende Pokerfaces und Angst vor der Lächerlichkeit entscheidende Züge der US-amerikanischen Kultur sind (zu der topaktuelle Literatur nun mal gehört) und eine eindeutige Beziehung zum Fernsehen haben, dessen schaurig-schönes Händchen meine Generation an der Gurgel packt. Ich möchte geltend machen, dass Ironie und Spott unterhaltsame Effekte sind, die gleichzeitig Erfüllungsgehilfen all der Verzweiflung und Stagnation in der Kultur der USA sind und für ambitionierte Schriftsteller besonders schreckliche Probleme aufwerfen. Meine beiden großen Prämissen sind, dass erstens in der jüngeren Vergangenheit ein bestimmtes, hauptsächlich von jungen Amerikanern produziertes Subgenre popkulturell reflektierter postmoderner Literatur entstanden ist, das ernsthafte Anstrengungen unternimmt, eine Welt zu verändern, in der es nur um den Schein, den Massenanreiz und das Fernsehen geht; und dass zweitens die Fernsehkultur einen Punkt erreicht hat, an dem sie gegen solche Veränderungsversuche gefeit scheint. Mit anderen Worten: Das Fernsehen vereinnahmt und neutralisiert heute jeden Versuch, jene Haltung des passiven Unbehagens und Zynismus aufseiten des Publikums zu überwinden oder auch nur infrage zu stellen, die das Fernsehen braucht, um - bei einer Dosierung von mehreren Stunden täglich - psychologisch und kommerziell wirksam zu sein."
In dem umfangreichen Essay "E Unibus Pluram" über Fernsehen und Literatur in den USA taxiert Wallace die Ironie als fiese Mittlerin zwischen Wahrheit und Heuchelei. Ausweglos scheint es, gegen sie rebellieren zu wollen. Und doch macht er in jedem Roman, jeder Erzählung und nahezu jedem Essay nichts anderes. Alles zugleich.
Aufrichtige Schnappatmung
"Natürlich wären diese Antirebellen veraltet, bevor sie die erste Zeile zu Papier gebracht hätten. Literarische Totgeburten. Zu aufrichtig. Eindeutig verklemmt. Rückständig, drollig, naiv, anachronistisch. Vielleicht geht es genau darum. Vielleicht sind sie genau deswegen die nächsten echten Rebellen. Soweit ich das beurteilen kann, riskieren echte Rebellen Missfallen. Die alten postmodernen Aufrührer riskierten Aufschreie und Schnappatmung: Erschütterung, Ekel, Entrüstung, Zensur, Anklagen wegen Sozialismus, Anarchismus, Nihilismus. Heute sehen die Risiken anders aus. Die neuen Rebellen könnten Künstler sein, die Gähnen, Augenverdrehen, cooles Grinsen, Ellbogenknuffe und die Parodien begabter Ironiker riskieren, das 'Ach, wie banal!'. Die Vorwürfe der Sentimentalität und des Melodrams riskieren. Der übertriebenen Gutgläubigkeit. Der Schwäche. Der Bereitschaft, sich von Gaffern und Schaulustigen verleiten zu lassen, die mehr Angst davor haben, Blicken ausgesetzt zu werden und sich lächerlich zu machen, als ohne Verfahren zu einer Haftstrafe verurteilt zu werden."
Doch Heuchelei war für Wallace unausweichlich. In seiner Reportage über John McCain im Vorwahlkampf der Republikaner für die Präsidentschaft im Jahr 2000 fragt sich Wallace einmal, was eigentlich der Unterschied sei zwischen Heuchelei und Paradox. Er ist damals für das Rolling Stone Magazine eine Woche lang im Wahlkampfbus mitgefahren und McCains Mantra, dass er, wenn er Präsident würde, immer, aber auch wirklich immer die Wahrheit sagen würde, auch wenn sie ihm politisch schadet, hat Wallace natürlich als möglicherweise heuchlerisch hinterfragt. Letztendlich kommt er zu einem anderen Schluss. Doch zunächst werden seitenlang alle Eventualitäten, insbesondere aus der Perspektive potentieller Wähler ausgelotet, um dann hellsichtig die Angst vor dem eigenen Zynismus ebenso wie vor der eigenen Leichtgläubigkeit der Möglichkeit gegenüber zu stellen, dass McCain wirklich so ist. Die Frage, ob man dem Politiker glauben kann, hängt dann auch weniger von seinen als von den eigenen Überzeugungen ab. In Bezug auf sich selbst hat Wallace diese Entscheidung nie gewagt, sondern sich einer Armee von Paradoxien gegenüber gesehen und das ausgefochten, ohne Aussicht auf ein Ende. Im Selbstbetrug erkennt Wallace das eigene Andere. Der Kampf, der Leben heißt, endet für ihn in der größtmöglichen Verfehlung von Authentizität. Mit dem Dauerfeuer seiner Prosa erzeugt Wallace Nähe und eine unheimliche Gleichzeitigkeit, eine unendliche Dehnung, in der Vergangenheit und Zukunft nur Illusionen der Gegenwart sind, eine leere Form der Zeit.
Das Heuchlerparadox
"Das Heuchlerparadox lautete: Je mehr Zeit und Mühe man investierte, um vor anderen Leuten als beeindruckend oder attraktiv dazustehen, desto weniger beeindruckend oder attraktiv fühlte man sich - man war ein Heuchler. Und je mehr man sich als Heuchler fühlte, desto mehr versuchte man, ein beeindruckendes oder liebenswertes Image zu vermitteln, damit andere Leute nicht herausfanden, was für ein hohler Heuchler man im Grunde war."
Dieses Zitat aus der späten Erzählung "Good Old Neon" passt auch zu Wallace’ Essays, von denen er in seinen letzten Jahren nur noch wenige geschrieben hat. Die Wahrheitssuche ist aktuell wie eh und je, aber die Geschwindigkeit und Dichte seiner Prosa ist heruntergefahren. Das lässt sich an den Erschütterungen spüren, die sich ihm nach den Anschlägen von 9/11 über Fernsehbilder vermitteln, mehr aber noch über die Reaktionen der Nachbarn im fernen Mittleren Westen: ein paar ältere Damen, deren Gebete und ihr "geradezu erschreckender Mangel an Zynismus" ihn darauf stößt, dass die Anschläge eigentlich ihm gelten, vielmehr seiner Lebensweise im Spagat zwischen Wahrheitssuche, Ironie und Heuchelei als der dieser Damen. Der Absage an diese Lebensweise gilt dann auch, was Wallace 2005 den Absolventen des Kenyon College in seiner unter dem Titel "Das hier ist Wasser" bekanntgewordenen Rede gesagt hat.
"Die sogenannte 'wirkliche Welt' der Männer, des Geldes und der Macht läuft wie geschmiert dank dem Öl aus Angst, Verachtung, Frustration, Gier und Selbstverherrlichung. Unsere heutige Kultur hat der spezifischen Nutzung dieser Kräfte außerordentlichen Reichtum, Komfort und individuelle Freiheit zu verdanken. Nämlich die Freiheit für jeden von uns, Herrscher seines winzigen, schädelgroßen Königreichs zu sein, allein im Mittelpunkt der Schöpfung. Diese Art Freiheit hat vieles, was für sie spricht. Aber es gibt natürlich verschiedene Formen der Freiheit, und die kostbarste wird in der großen, weiten Welt des Siegens, Leistens und Blendens selten erwähnt. Die wirklich wichtige Freiheit erfordert Aufmerksamkeit und Offenheit und Disziplin und Mühe und die Empathie, andere Menschen wirklich ernst zu nehmen und Opfer für sie zu bringen, wieder und wieder, auf unendlich verschiedene Weisen, völlig unsexy, Tag für Tag. Die Wahrheit im Vollsinn des Wortes dreht sich um das Leben vor dem Tod. Sie dreht sich um die Frage, wie man dreißig oder sogar fünfzig Jahre alt wird, ohne sich die Kugel zu geben."
David Foster Wallace: "Der Spaß an der Sache"
Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrich Blumenbach und Marcus Ingendaay
Kiepenheuer & Witsch, Köln. 1089 Seiten, 36 Euro.
Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrich Blumenbach und Marcus Ingendaay
Kiepenheuer & Witsch, Köln. 1089 Seiten, 36 Euro.