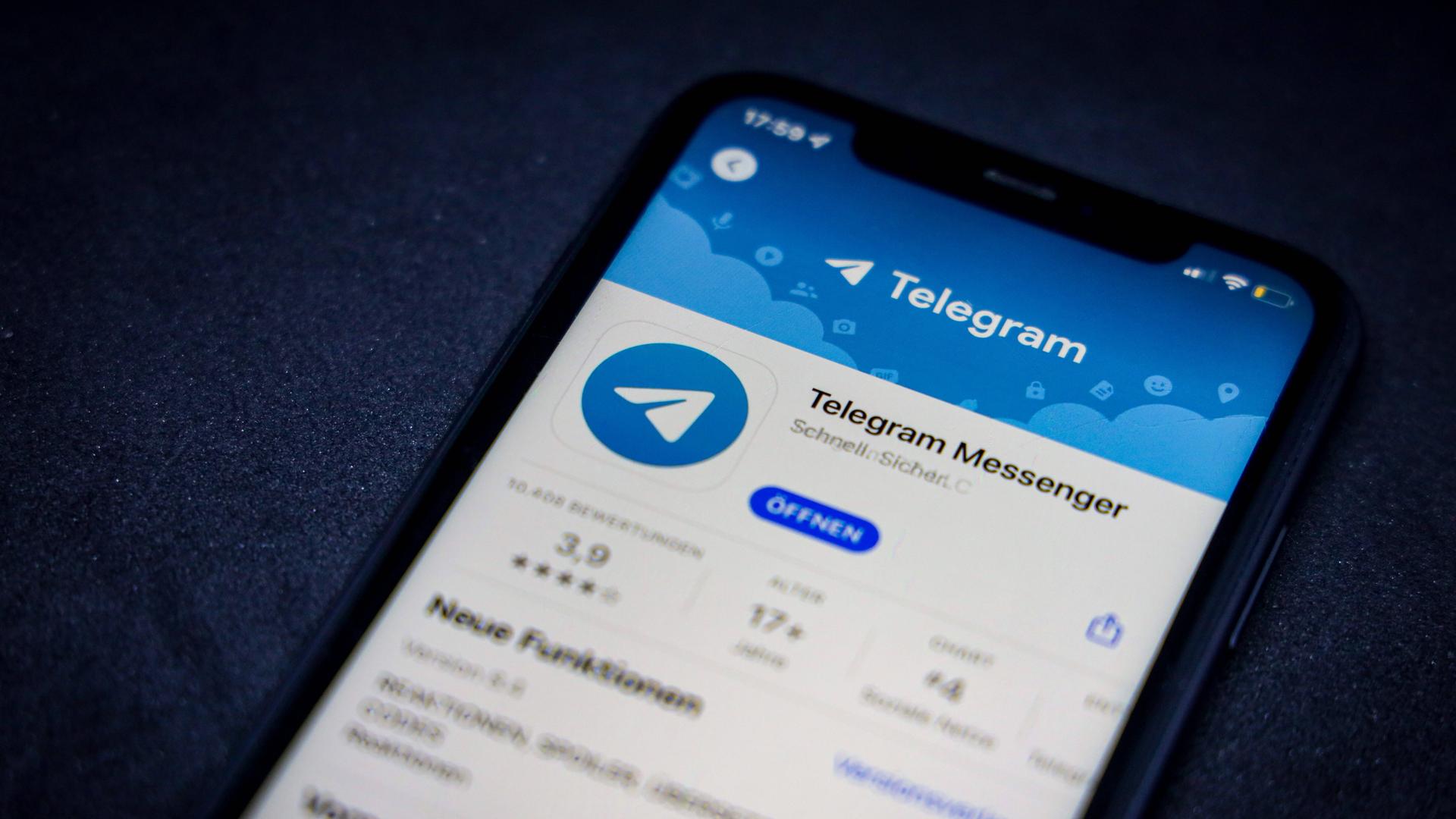NetzDG auf deutscher, Digital Services Act auf europäischer Ebene - politische Initiativen gegen Hass im Netz gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Aber was bringen sie? Nur wenig, wie ein Blick in die digitale Wirklichkeit zeigt, Tag für Tag. Das hat auch die Bundespolitik erkannt. Und will nachbessern. Und Marco Buschmann wolle auch wirklich etwas tun gegen den Hass im Netz, hiervon ist Ulf Buermeyer überzeugt. Davon zeugten auch die Pläne, mit denen sich der Bundesjustizminister nun „hervorgetan“ habe, wie Buermeyer lobt.
Der Jurist ist Vorsitzender und Mitgründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), einem Verein, der selbst über sich sagt, die „Grund- und Menschenrechte mit rechtlichen Mitteln verteidigen“ zu wollen. Was dem Verein bei seinem Kampf bisher gelungen sei: Seine Ideen sind in den aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung eingeflossen, so Buermeyer im Interview mit dem Deutschlandfunk.
Nun legt das GFF nach mit einem eigenen Gesetzentwurf, also einem Vorschlag, wie Buschmanns Ministerium bei den eigenen Gesetzesplänen nachlegen könnte. Besonders großen Nachbesserungsbedarf sieht der Verein in der Frage der Accountsperren. Man sehe, wie diese „noch etwas lieblos behandelt“ würden, erklärt Buermeyer.
Lob und Kritik für Gesetz gegen digitale Gewalt
Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat am 12. April dieses Jahres erste Eckpunkte zu seinem Gesetz gegen digitale Gewalt vorgelegt. Für die Pläne hat es Lob, aber auch Kritik von Netzaktivisten gegeben.
An den „Spielregeln des demokratischen Diskurses“ werde das Gesetz nichts ändern, stellt das Bundesjustizministerium gleich zu Beginn seines Entwurfs klar. „Was heute geäußert werden darf, darf auch künftig geäußert werden“, heißt es hierzu weiter in dem sechsseitigen Papier. Auch ändere sich nichts an der „grundsätzlichen Freiheit zur anonymen Meinungsäußerung“.
Stattdessen sollten „die rechtlichen Möglichkeiten Privater verbessert werden, gegen Verletzungen ihrer Rechte im digitalen Raum vorzugehen“. Soll heißen: Das Gesetz will es Opfern von Hassrede und anderen Angriffen im Internet leichter machen, dagegen vorzugehen. Und setzt dabei auf eine Ausweitung von Auskunftsansprüchen.
Heißt: Betroffene könnten dann künftig Nutzungsdaten wie die IP-Adresse verlangen, um den Ursprung von möglicherweise rechtswidrigen Angriffen im Netz zu ermitteln.
GFF: Accountsperren wichtiger als Auskunftsansprüche
Doch Ulf Buermeyer von der Gesellschaft für Freiheitsrechte bezweifelt, dass das etwas ändern würde. Die Erfahrung zeige, dass Strafverfolgungsbehörden oft daran scheitern, mit einer IP-Adresse "Personen zu identifizieren, die einen strafbaren Tweet abgesetzt haben“. Außerdem könnte durch eine Ausweitung der Auskunftsansprüche eine neue Form der Vorratsdatenspeicherung entstehen, warnt Buermeyer.
Der GFF-Entwurf setzt stattdessen auf Accountsperren, die richterlich veranlasst werden müssten – und nicht nur, so wie bisher, von den Plattformen selbst. Buermeyer spricht von einer „datenschutzfreundlichen Alternative zu Auskunftsverfahren“, die auch gegenüber anonymen Accounts wirksam sei.
Zu starker Eingriff in die Meinungsfreiheit?
Aber was würde das für die Meinungsfreiheit bedeuten? Einen tiefen Eingriff in dieses Grundrecht erkennt etwa der Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun. Außerdem könnten Accountsperren mit einem neuen Account umgangen werden, warnt Jun gegenüber dem Deutschlandfunk.
Dieses Problem sieht auch Ulf Buermeyer. Aber es gehe mit den Sperren vor allem darum, große Accounts aus dem Netz zu nehmen: reichweitenstarke Accounts, die Hass verbreiten und dabei noch weitere User anstacheln würden. Diese Accounts zeitweise oder irgendwann dauerhaft zu sperren, habe seiner Meinung nach sehr wohl einen Effekt.
„Wir können nicht nur auf die Meinungsfreiheit schauen“, meint Buermeyer. „Die wird zwar natürlich eingeschränkt durch eine solche Accountsperre.“ Auf der anderen Seite sei da aber der Hass im Netz, der bereits viele andere Menschen zum Schweigen gebracht habe.
Medienanwalt Jun: Sorgfältige Abwägungen sind nötig
„Je mehr Reichweite ein Account hat, umso stärker ist dadurch aber auch legale Meinungsäußerung betroffen, sodass sorgfältige Abwägungen nötig sind“, gibt Medienanwalt Jun zu bedenken: „Große Hasskampagnen beginnen zwar oft mit Großaccounts, aber häufig - wie im Fall Kuban - mit noch legalen Inhalten."
Der CDU-Politiker Tilman Kuban hatte jüngst auf Twitter eine Kita kritisiert und dabei deren Kontaktdaten öffentlich gemacht. In der Folge hatte die Kita erklärt, Opfer von Beleidigungen, Hass und Hetze geworden zu sein.
Und ab wann darf gesperrt werden?
Ein weiterer Vorschlag der GFF: Für eine Accountsperrung soll bereits ein einmaliger Verstoß ausreichen können – und nicht erst mehrfache Verstöße, so wie es das Eckpunkte-Papier des Bundesjustizministeriums aktuell vorsieht. Schon die erste Straftat müsse Anlass geben können für eine Accountsperre, fordert Buermeyer im Deutschlandfunk.
„Hier sollte man zwischen Verstößen differenzieren“, ergänzt Matthias Kettemann, Professor für Innovation und Internet-Governance an der Uni Innsbruck: „Volksverhetzungen müssen anders behandelt werden als 'einfache' Persönlichkeitsverletzungen; Antisemtische oder rassistische Äußerungen sollten stärker sanktioniert werden als 'einfache' Beleidigungen“, so Kettemann gegenüber dem Deutschlandfunk.
Strafrecht alleine helfe aber seiner Meinung ohnehin nicht: Wichtig sei außerdem, dass mehr Mittel zur Verfügung gestellt würden für Beratungsstellen und vor allem für kollektive Rechtsdurchsetzung, unterstreicht Kettemann. Auch wäre es sinnvoll, eine umfassende Studie zu Digitaler Gewalt zu beauftragen.