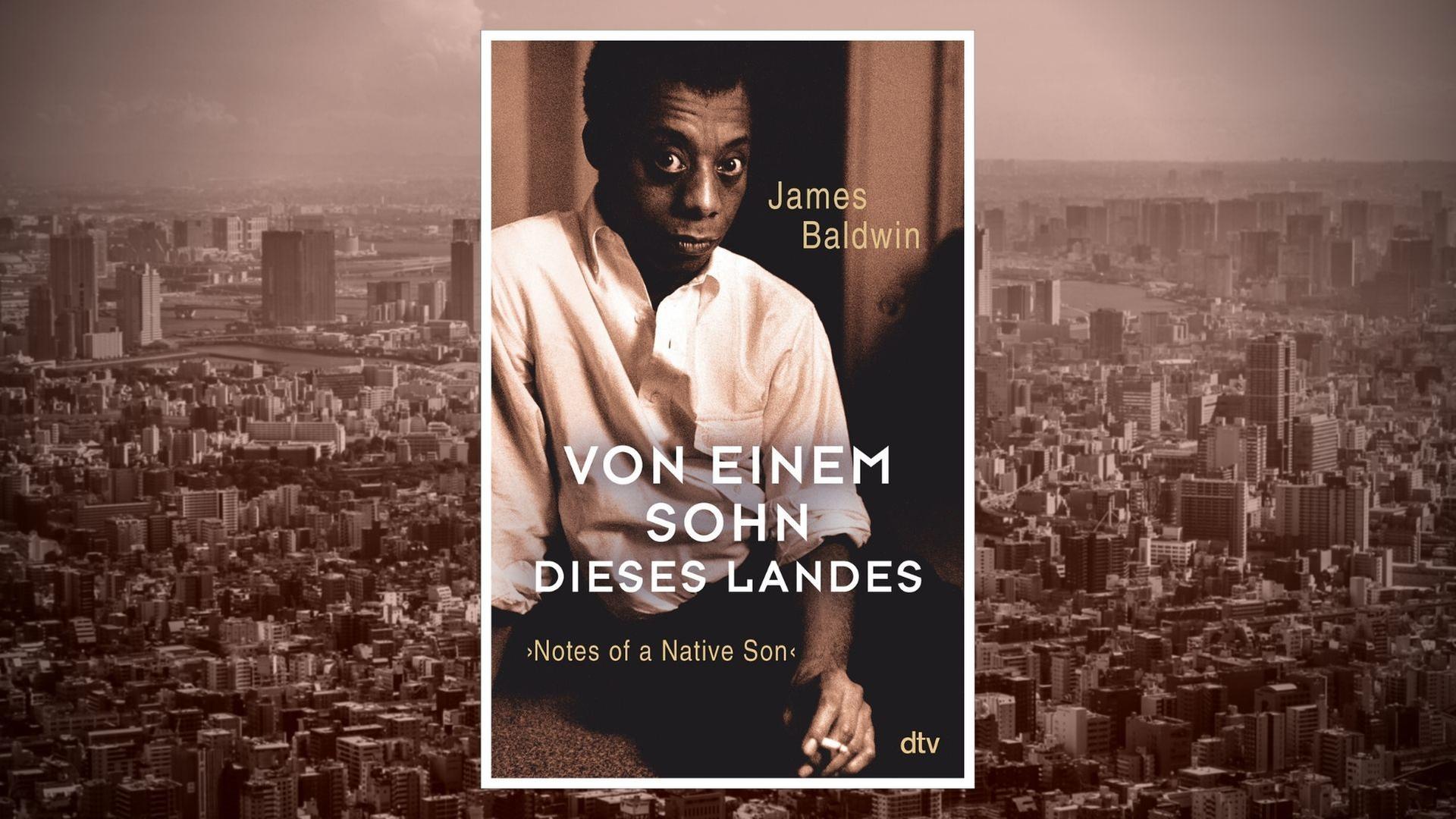
James Baldwin versteht sich auf Lakonie. Bei aller gedanklichen Strenge, mit der er die gesellschaftlichen Verhältnisse analysiert, nimmt er die eigene Person nie übermäßig ernst. Seine Anmerkungen, die dem Essayband „Von einem Sohn dieses Landes“ voranstehen, liefern ein funkelndes Selbstporträt. 1955 ist er 31 Jahre alt, aus Harlem gebürtig, in Paris ansässig, und Verfasser eines Romans in einem prunkenden Gospelsound über die Befreiung eines jungen Laienpredigers von seinem übermächtigen Vater. Das Buch hatte ihm eine gewisse Prominenz verschafft. Mit lässigem Understatement behauptet er jetzt:
„Was meine Interessen angeht: Ich weiß nicht, ob ich welche habe, es sei denn, mein dekadenter Wunsch, eine 16-mm-Kamera zu besitzen und Experimentalfilme zu drehen, geht als ein solches durch. Ansonsten esse und trinke ich gern – ich bin der melancholischen Überzeugung, dass ich kaum je genug zu essen hatte (weil es unmöglich ist, genug zu essen, wenn man sich fragt, wo die nächste Mahlzeit herkommt) –, diskutiere gern mit Menschen, die nicht allzu anderer Meinung sind, und lache gern.“
Ohne jedes Pathos gelingt es dem Autor, seine Herkunft, die er in mehreren Texten ausführlicher erläutern wird, zumindest anzureißen. In dem Haushalt, in dem er groß wurde, herrschte Armut und beständige Sorge um den Lebensunterhalt, womit er sich seine Unersättlichkeit erklärt. Als eine weitere Eigenschaft nennt er die Leidenschaft für gesellige Diskussionen: „Ich mag keine Menschen, die mich mögen, weil ich schwarz bin, und ich mag auch keine Menschen, die denselben Zufall zum Anlass nehmen, mich zu verachten.“
Mysterium der Hautfarbe als Erbe aller Amerikaner
Das Verhältnis zur Hautfarbe und die damit verknüpfte Gewalt versteht Baldwin als einen unbewältigten Komplex der USA, und welche dramatischen Verwicklungen daraus folgen, ist ein Leitmotiv seiner Essays. Vor allem den weißen Lesern, die diese Verstrickungen beständig leugnen, will er einen Spiegel vorhalten. Baldwin konzipierte „Von einem Sohn dieses Landes“ eher widerwillig auf Anraten seines Schulfreundes Sol Stein, mittlerweile Lektor bei Beacon Press, wo das Buch dann herauskam. Er sei noch zu jung, seine Memoiren vorzulegen, gab er zu bedenken. Aber sein Freund hatte den richtigen Instinkt, denn der Band diente James Baldwin im Nachgang seines literarischen Debüts zur Selbstvergewisserung. Gleichzeitig kann er auf theoretischer Ebene Probleme verhandeln, die er später auf Figuren und Handlungsstränge übertragen sollte.
Das Ergebnis ist eine Art Grundsatzschrift, ein Manifest. Baldwin denkt über die Frage der Identität nach und analysiert den Effekt rassistischer Zuschreibungen. Immer wieder deckt er typische Mechanismen wie Abspaltungen und Projektionen auf: Der Anblick des schwarzen Körpers löse Verunsicherung aus, weil er die weißen Amerikaner mit den verdrängten Gräueltaten konfrontiere. Im besten Falle wirke die schwarze Frau verführerisch, ja, sie sei sogar der Inbegriff von Sex, während der schwarze Mann immer beweisen müsse, dass er nicht bedrohlich sei. Das eigene Geburtsrecht einzuklagen, begreift der Schriftsteller, der als schwuler Schwarzer ein besonderes Gespür für Ausgrenzung besaß, als die wesentliche Aufgabe eines Künstlers.
Entstanden waren die Texte ursprünglich zwischen 1948 und 1955 für die großen liberalen Zeitschriften „The New Leader“, „Partisan Review“, „The Reporter“ und „Harper’s Magazine“. Wie in seinem ersten Roman geht James Baldwin in beinahe jedem Essay von einem privaten Erlebnis aus, um dann die partikulare Erfahrung zu etwas Beispielhaftem umzuformen. Der Gebrauch der Ersten Person Singular markiert seine Zeugenschaft:
„Ich liebe Amerika mehr als jedes andere Land auf der Welt, und aus genau dem Grund nehme ich mir heraus, es unablässig zu kritisieren. Ich habe wahrscheinlich viele Verantwortungen, aber keine größere als diese: standhaft zu bleiben, wie Hemingway sagt, und meine Arbeit zu tun. Ich will ein aufrichtiger Mensch sein und ein guter Schriftsteller.“
Geschliffene Ironie und die Wucht des Alten Testaments
Baldwins Schlichtheit ist entwaffnend. Sich auf Hemingway zu berufen, den damals berühmtesten lebenden amerikanischen Schriftsteller, der kurz vor dem Nobelpreis stand, deutet an, wie ernst er seinen Beruf nimmt. Vereinnahmen lässt sich James Baldwin nie, auch nicht, als er 1957 mit Martin Luther King und später mit Malcolm X Freundschaft schließt und zu einer Schlüsselfigur der Bürgerrechtsbewegung wird. Selbstbewusst reiht er sich ein in die Riege der großen Essayisten von Ralph Waldo Emerson über Henry David Thoreau bis zu Frederick Douglass.
Für die Texte, die seine Jahre in Paris zum Gegenstand haben, ist der Einfluss des Romanciers Henry James zentral, dessen eleganter Periodenbau bei Baldwin nachklingt. Baldwin besitzt die Gabe der Klarheit, seine Syntax ist wohlgeordnet und rhythmisch, er schlägt einen raschen, eindringlichen Beat an. Der Autor mag emotional noch so involviert sein, seine Sprache bleibt präzise. Geschliffene Ironie und der Rückgriff auf Quellen wie das Alte Testament, die seine frühen Prägungen als charismatischer Prediger verraten, halten sich die Waage.
„Dieser Fels versehrte die Hand, an ihm brachen alle Werkzeuge. Irgendwo dort war aber ein Ich: Ich spürte, wie es herauswollte aus der Gefangenschaft. Die Hoffnung auf Erlösung – Identität – hing davon ab, ob man imstande war, den Felsen zu entziffern und zu beschreiben.“
Baldwin zitiert mehrere Gospels, in denen das biblische Motiv des Felsens vorkommt, unter dem man sich verbergen will, der einen aber zurückweist. Er deutet den Felsen als Teil seines Erbes, das er bewältigen muss, um nicht zerstört zu werden. Genauso sorgfältig wie jeder einzelne Text ist der Band insgesamt komponiert. „Von einem Sohn dieses Landes“ besteht aus drei Teilen. In der ersten und zweiten Abteilung sind je drei Essays versammelt, in der dritten vier.
Im ersten Teil wird die Frage nach dem Selbstverständnis der schwarzen Amerikaner am Beispiel des Klassikers „Onkel Toms Hütte“ von 1852 und der Filmadaption von Georges Bizets Oper „Carmen“ mit ausschließlich schwarzen Darstellern gestellt. Außerdem rechnet Baldwin mit dem bahnbrechenden Roman von Richard Wright „Sohn dieses Landes“ ab, der ihn zu seinem eigenen Buchtitel inspirierte.
Im zweiten Teil beschreibt er das Ghetto von Harlem, wie er es in seiner Kindheit erlebte und erzählt von einer ernüchternden Reise seines Bruders nach Atlanta. Dieser Abschnitt mündet in den Titelessay, einem seiner berühmtesten Texte, der vom Tod des Vaters handelt und um ein friedlicheres Verhältnis mit ihm ringt. Der dritte Teil dreht sich um Baldwins Zeit in Europa – die amerikanische Frage wird in Brechungen zurückgeworfen und bekommt noch einmal eine andere Färbung.
Schärfung seiner Autorschaft durch Antagonismus
Interessant ist, dass Baldwin sein junges Autor-Ich Ende der 1940er Jahre durch Antagonismus schärft. Denn es fällt auf, wie streng er mit Harriet Beecher Stowes Bestseller gegen die Sklaverei „Onkel Toms Hütte“ ins Gericht geht. Es handle sich um ein pamphletistisches, sentimentales und schlichtweg schlechtes Buch, das seinen Lesern bequeme „Tugendschauer“ beschere, urteilt er strikt.
Im selben Atemzug nimmt Baldwin dann Richard Wright ins Visier. Wright, das muss man wissen, war in New York Baldwins Mentor gewesen, hatte ihm ein Stipendium verschafft und ihn ermutigt, ihm nach Paris zu folgen. Wrights Roman „Ein Sohn dieses Landes“ von 1940, der allgemein als eine der kompromisslosesten Darstellungen von Rassismus in der schwarzen Literatur galt, setze die Einteilung in wertvolle und weniger wertvolle Menschen auf einer anderen Ebene fort, schreibt Baldwin nun. Wrights Held Bigger, der auf die gewalttätige Umgebung nur mit Gewalt reagieren kann und zum Mörder wird, akzeptiere eine Theologie, die ihm ein würdiges Leben verweigere.
Noch pointierter formuliert Baldwin seine Kritik im zweiten Text dieser Abteilung, was einem Vatermord gleichkommt. Bisher sei die Geschichte des schwarzen Amerikas nur in der Musik erzählt worden, heißt es hier, weil dies eine verkraftbare, gefühlvolle Form sei. Zwar zollt er dem älteren Kollegen durchaus Respekt und gesteht ihm zu, als erster das wirkmächtige Bild des furchteinflößenden Schwarzen literarisch vermittelt zu haben. Dennoch hält er den Roman für missglückt: „Was in seiner Situation und in der Darstellung seiner Psyche fehlt – was seine Situation verfälscht und seiner Psyche die Fähigkeit nimmt, sich zu entwickeln –, ist irgendein aufschlussreiches Verständnis von Bigger als einer schwarzen Realität oder einer schwarzen Rolle.“
Bigger sei ganz einfach ein Ungeheuer, und das bestätige nur sämtliche Vorurteile weißer Amerikaner, stellt Baldwin fest. Scharfzüngig analysiert er Wrights Verrat der eigenen Kultur. Und so eingängig seine Argumentation auch ist: Er scheint zugleich aus dem Schatten einer übermächtigen paternalistischen Figur heraustreten zu müssen. Wer seine Beweisführung im Einzelnen nachvollziehen will, sollte Wrights Roman allerdings kennen. Dasselbe gilt für Baldwins kritische Anmerkungen zu Otto Premingers Film „Carmen Jones“ von 1955.
Der vergessene Stolz des Vaters
Unmittelbarer erschließen sich jene Essays, in denen James Baldwin seine eigene Geschichte auffächert. 1924 als uneheliches Kind in Harlem geboren, erhielt er seinen Nachnamen von seinem Stiefvater David, einem Baptistenprediger, den seine Mutter drei Jahre nach James Geburt heiratete. Dass er nicht dessen leiblicher Sohn war, erfuhr er erst als Jugendlicher; dennoch bezeichnete er ihn immer als seinen Vater. Und an dessen Imago arbeitet er sich in dem Titelessay „Von einem Sohn dieses Landes“ ab. Die Familie Baldwin hatte in den Dreißigerjahren große Mühe, über die Runden zu kommen, und alle Kinder mussten etwas zur Haushaltskasse beitragen. James übernahm die Versorgung der jüngeren Geschwister, wickelte, fütterte und betreute sie. Sein Vater stirbt 1943, als Harlem von blutigen Aufständen erschüttert wird. James Baldwin ist neunzehn Jahre alt.
„Ich hatte meinen Vater nicht sehr gut gekannt. Unser Verhältnis war schlecht gewesen, unter anderem, weil wir beide auf unterschiedliche Art dem Laster von Stolz und Halsstarrigkeit frönten. Als er tot war, wurde mir klar, dass ich kaum je mit ihm gesprochen hatte. Als er schon lange tot war, wünschte ich mir, ich hätte es getan.
Sein Stiefvater sei bei aller Neigung zur Brutalität ein sehr gutaussehender, tiefschwarzer, imposanter Mann mit einem bezwingenden Charme gewesen, der ihn immer an Fotografien afrikanischer Clan-Chefs erinnert habe, erzählt Baldwin in seinem berührenden Porträt. Der Schriftsteller erkennt retrospektiv, dass David Baldwin an Paranoia litt. Äußerlich war ihm der eher kleine, drahtige James, der sich selbst immer als hässlich wahrnahm und wegen seiner hervorstehenden Augen vom Vater gehänselt wurde, unterlegen. Die einzige Waffe, die der Junge besaß, war sein Geist – Intelligenz, Wissbegier, eine schnelle Auffassungsgabe. Obwohl David seinen Ziehsohn eines Tages fragt, ob er lieber schreiben als predigen wolle, was James bejahte, blieb das Verhältnis kämpferisch. Doch während der Beerdigung steigt ein anderes Bild in James Baldwin auf.
„Dann stimmte jemand eins der Lieblingslieder meines Vaters an, und schlagartig saß ich auf seinem Schoß in der riesigen, heißen, vollbesetzten Kirche, zu der wir anfangs gegangen waren. In meiner zornigen Jugend hatte ich vergessen, wie stolz mein Vater früher auf mich gewesen war. Als Kind hatte ich offenbar schön gesungen, und mein Vater hatte vor der Gemeinde gern mit mir angegeben. Ich hatte vergessen, wie er aussah, wenn er zufrieden war, aber jetzt erinnerte ich mich, wie er am Ende meiner Soli immer vor Freude lächelte.“
Beschreibungen von grausamer Ausgrenzung
Immer wieder betont James Baldwin die Notwendigkeit, die fatalen Verwerfungen der amerikanischen Gesellschaft durch Zuwendung und Liebe überwinden zu müssen. Genauso eindrucksvoll wie die Schilderungen seiner Kindheit sind die Beschreibungen von grausamer Ausgrenzung. In New Jersey wird Baldwin nach einem Kinobesuch in einem Diner die Bestellung verwehrt, was er bereits ein Jahr lang immer wieder erduldet hat. Schwarze werden nicht bedient. Als er denselben Satz in einem anderen Restaurant hört, ergreift ihn ein vernichtender Hass, und er schleudert der Kellnerin einen Wasserkrug entgegen.
„Über zwei Dinge, die beide schwer zu fassen waren, kam ich nicht hinweg, und das eine war, dass man mich hätte umbringen können. Aber das andere, dass ich bereit gewesen war, einen Mord zu begehen. Ich sah nicht sehr klar, das allerdings sah ich: dass mein Leben, mein Leben in Gefahr war, und zwar nicht durch etwas, das man mir antun könnte, sondern durch den Hass in meinem Herzen.“
Es ist kein Zufall, dass Baldwin daraufhin seine Verantwortung als Brotverdiener seiner Familie abgibt, sich dem Schreiben zuwendet und schließlich nach Frankreich übersiedelt. Dort wird er auf ganz andere Weise mit der Unvereinbarkeit von kulturellen Codes konfrontiert. Eine beinahe komödiantische Schlagseite entwickelt dies in dem Essay „Gleichheit in Paris“. Weil er um die Weihnachtszeit unter Heimweh litt und sich nach Vertrautem sehnte, hatte er einem flüchtigen Bekannten, einem Amerikaner, ein Zimmer in seinem Hotel vermittelt. Baldwins Laken wurden in dem schmuddeligen Etablissement nur unregelmäßig gewechselt, also borgte er sich die Bettwäsche des neuen Freundes. Am Weihnachtsmorgen steht die Polizei im Zimmer seines Bekannten und inspiziert schließlich auch Baldwins bescheidene Unterkunft.
„Dann trat er an mein Bett, und einen winzigen Moment, bevor er die Tagesdecke anhob, durchfuhr mich die schreckliche Erkenntnis, wonach er suchte. Wir betrachteten das Laken, und ich las zum ersten Mal, in den flammendsten scharlachroten Lettern, die ich jemals gesehen habe, den Namen des Hotels, aus dem es gestohlen worden war. Zum ersten Mal kam mir das Wort gestohlen in den Sinn. Natürlich hatte ich, als ich das Bett bezog, das Hotelmonogramm gesehen, es hatte mir nur nichts gesagt. Traurig und wortlos nahm der Beamte das Laken vom Bett, legte es unterm Arm zusammen, und wir gingen die Treppe hinunter. Ich begriff, dass ich festgenommen war.“
Tagelang muss James Baldwin unter misslichen Bedingungen im Kommissariat ausharren, er wird in eine Zelle gesperrt, lernt seinen Mitgefangenen kennen, hofft stündlich auf Aufklärung. Erst, als ein Insasse entlassen wird und fragt, ob er jemand für ihn verständigen solle, kommt ihm eine rettende Idee. Für einen amerikanischen Anwalt in Paris hatte er verantwortungsvolle Botengänge erledigt, der könne doch für ihn bürgen. Und so passiert es dann auch. Die Verhandlung ist eher ein Witz und führt unter den Staatsanwälten zu großer Heiterkeit. Dennoch lehrt ihn diese Erfahrung Demut.
"Ich aber bin in Afrika und sehe die Eroberer kommen“
In der Schweiz wird er wiederum auf sein Äußeres zurückgeworfen, wovon der ebenso eindringliche letzte Essay „Ein Fremder im Dorf“ handelt. In das abgelegene Leukerbad, wo Baldwin mit seinem Freund und Geliebten Lucien Happersberger 1953 Zuflucht findet und endlich seinen Roman beenden kann, hatte es noch nie einen Schwarzen verschlagen. Die Kinder rufen es ihm im Chor hinterher – ihre Wortwahl ist der Zeit entsprechend drastisch, was Miriam Mandelkow in ihrer äußerst nuancierten Übersetzung glücklicherweise beibehält, denn nur so lässt sich die Vehemenz der Fremdheitserfahrung nachvollziehen. Und wieder nimmt Baldwin dies zum Anlass, um über die komplexe Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen nachzudenken.
„Von der Warte der Macht aus betrachtet können diese Menschen nirgendwo auf der Welt Fremde sein; genau genommen haben sie die moderne Welt erschaffen, ob sie es nun wissen oder nicht. Noch die Ungebildetsten unter ihnen sind auf eine mir verwehrte Weise mit Dante, Shakespeare, Michelangelo, Aischylus, Da Vinci, Rembrandt und Racine verwandt; die Kathedrale von Chartres sagt ihnen etwas, was sie mir nicht sagen kann. Vor wenigen Jahrhunderten erstrahlten diese Menschen in vollem Glanz – ich aber bin in Afrika und sehe die Eroberer kommen.“
Ausgerechnet in der gleißenden Schweizer Berglandschaft beginnt Baldwin, Bessie Smith zu hören, und erst der Blues vermittelt ihm den Ton seines Romans, führt ihn zurück auf das, was ihn ausmacht. An der Lage der Schwarzen in den USA habe sich zwischen der Erstveröffentlichung seines Essaybandes 1955 und der zweiten Ausgabe 1984 kaum etwas verändert, stellt der Autor im Vorwort zur Neuausgabe resigniert fest. Nur die Angst der Unterdrücker um den Verlust ihrer Privilegien habe zugenommen. Eine Erkenntnis, die auf das heutige Europa zutrifft: Teilhabe derjenigen zuzulassen, die bisher ausgegrenzt waren, ist eine der großen Aufgaben unserer Gegenwart. Allein das macht die Lektüre der Essays ebenso zwingend wie bereichernd. Denn weiß wird die Welt, so stellt James Baldwin im letzten Satz lakonisch fest, ohnehin nie wieder sein.
James Baldwin: „Von einem Sohn dieses Landes“
Aus dem amerikanischen Englisch von Miriam Mandelkow.
Mit einem Vorwort von Mithu Sanyal.
Dtv Verlag, München, 240 Seiten, 22 Euro.
Aus dem amerikanischen Englisch von Miriam Mandelkow.
Mit einem Vorwort von Mithu Sanyal.
Dtv Verlag, München, 240 Seiten, 22 Euro.

