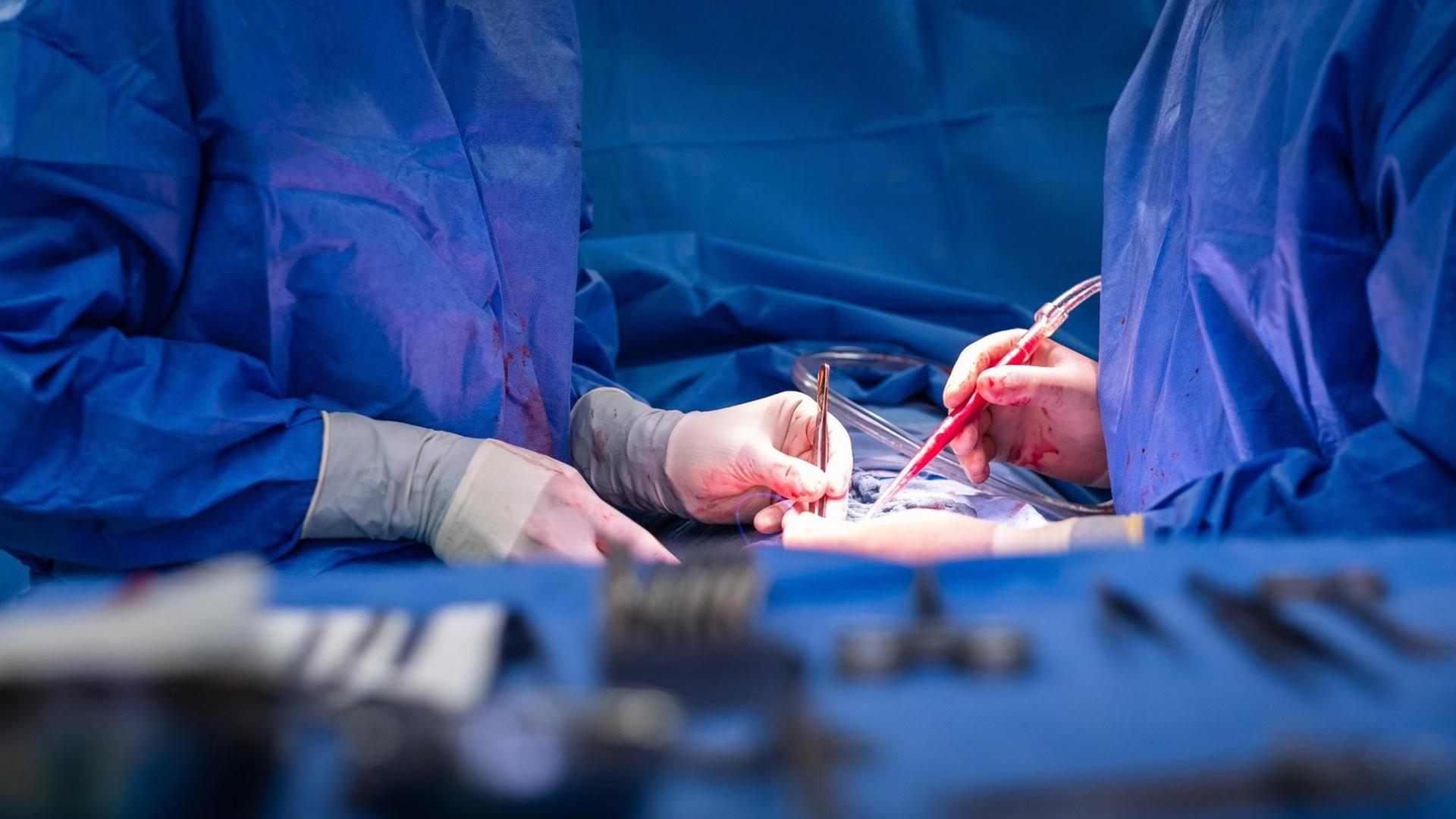
Wenn Axel Fischer, der Chef des kommunalen Krankenhaus-Verbundes München Klinik, über das Thema Krankenhaus-Finanzierung redet, dann muss er aufpassen, dass er nicht sehr schnell schlechte Laune bekommt: "Immer mehr ist das ja zu einem Riesen-Monster geworden. Das Ganze DRG- oder Abrechnungssystem, das ist ja heutzutage ein Bürokratiemonster, das du kaum mehr durchschauen kannst."
DRG – das ist die Abkürzung für die englischen Wörter Diagnosis Related Groups, auf Deutsch wird oft auch über Fallpauschalen gesprochen. In den Augen des Klinik-Chefs Fischer sind sie jedenfalls ein Monster, das dringend gezähmt und verändert werden muss. Ein Monster, das dem kommunalen Klinik-Verbund mit rund 7.000 Mitarbeitern, den Fischer leitet, vergangenes Jahr mehr als 13 Millionen Euro Verlust gebracht hat.
Verschiedene Meinungen über Krankenhausfinanzierung
Es gibt aber auch Klinik-Chefs, die ganz anders über das Finanzierungssystem der deutschen Krankenhäuser urteilen: "Wir haben die Medizin in Deutschland dadurch erheblich verbessert", sagt Mate Ivančić. Er leitet die private Krankenhauskette Schön Klinik. Die Kette ist mit rund zehneinhalbtausend Mitarbeitern an 29 Standorten in Deutschland und Großbritannien die Nummer fünf der privaten Krankenhausbetreiber in Deutschland.
Gut 13 Millionen Euro Gewinn stehen in der Bilanz, die das Familienunternehmen fürs erste Halbjahr 2021 vorgelegt hat. Dass die Fallpauschalen aber nicht nur ordentlich Geld in die Kassen seiner Krankenhauskette spülen, sondern dass sie auch die Medizin in Deutschland erheblich verbessert haben, lässt sich nach Ansicht des Klinik-Chefs beispielsweise an einer Entwicklung ablesen:
"Wir sind schneller in der Behandlung geworden. Durch diese schnellere Behandlung ist auch eine höhere Qualität entstanden. Wenn Sie schauen, wie viele Menschen früher mit Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder mit Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und wie viele Menschen dann verstorben sind. Da haben wir große Schritte nach vorne gemacht."
Tatsächlich ist die Zeitdauer, die Patienten im Krankenhaus bleiben, seit Einführung der Fallpauschalen um etwa ein Drittel geschrumpft – von im Schnitt rund zehn Tagen auf gut sieben Tage. Das habe aber nicht nur Vorteile für die Patienten, sagt Christine Maurer. Die pensionierte Ärztin arbeitet als ehrenamtliche Patientenfürsprecherin am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, und sie sieht Handlungsbedarf beim Bezahlungssystem:
"Das Problem ist, dass man Patienten ganz individuell behandeln muss. Dazu brauche ich Zeit. Wir sind heute in einer Situation, wo Sie Tumordiagnosen übers Telefon bekommen. Und dann stehen Sie allein da und wissen gar nicht mehr, wie Sie es packen sollen. Das kann es nicht sein."
Das Fallpauschalen-System
Um zu verstehen, warum es ganz verschiedene Meinungen über die Krankenhausfinanzierung gibt, muss man einen Blick in die Vergangenheit werfen. Bis vor knapp 20 Jahren erhielten die Kliniken ihr Geld über sogenannte "tagesgleiche Pflegesätze" und "Sonderentgelte". Das hieß, vereinfacht: Je länger ein Patient auf Station war, desto mehr Geld brachte er einem Krankenhaus. Das war nach Ansicht der politischen Entscheidungsträger ein falscher Anreiz. Sie haben deshalb Fallpauschalen eingeführt, die es auch in vielen anderen Industrieländern schon seit vielen Jahren gibt.
Im Fallpauschalen-System fließt, je nach Diagnose, eine fixe Summe Geld. Eine Blinddarm-OP mit der Code-Nummer G23A beispielsweise bringt knapp dreieinhalbtausend Euro. Die korrekte Fallpauschale zu suchen und vor allem ja keine Abrechnungsmöglichkeit ungenutzt zu lassen, sei inzwischen ein riesiges Beschäftigungsprogramm in Krankenhäusern, sagt der Chef der München Klinik, Axel Fischer – und auch beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, der die Abrechnungen kontrolliert: "Und das sind Tausende. Tausende kümmern sich da deutschlandweit drum. Tausende oftmals ehemalige Ärzte oder Ärzte, die ausgeschieden sind. Pflegekräfte, MTA, wie auch immer. Genau: die machen das - anstatt Medizin."
Ziel ist es dabei vor allem, möglichst viele Fälle abzurechnen. Doch das ist nach Ansicht vieler Kritiker ein Irrweg. Eine Reihe von Organisationen, darunter Attac, aber auch die Gewerkschaft Verdi, haben sich zu einem Bündnis mit dem Namen "Krankenhaus statt Fabrik" zusammengetan. Das Bündnis glaubt, belegen zu können, dass in deutschen Kliniken deutlich mehr operiert oder auch geröntgt wird, als für die Patienten gut ist. So sei nach Daten des Statistischen Bundesamtes die Zahl der Kniegelenks-OPs innerhalb von zwölf Jahren um rund die Hälfte gestiegen, die Zahl der Hüft-OPs um rund ein Viertel.
Falsche wirtschaftliche Anreize?
Gewinn gemacht werde damit vor allem von Kliniken, die sich auf bestimmte Eingriffe spezialisieren, so die Kritik. Häuser, die die Grundversorgung übernehmen, die sich weniger lohnt, würden in Defizite getrieben. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat sich dem Bündnis "Krankenhaus statt Fabrik" zwar nicht angeschlossen. Die Internistin und MB-Vorsitzende Susanne Johna teilt aber viele seiner Einschätzungen. Es sei Tatsache, dass in den meisten Kliniken den Ärzten auf subtile Weise vermittelt wird: Mehr ist besser.
"Und das führt dazu, dass ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen das auch gar nicht mehr anders kennen, und insofern ein Stückweit einfach davon beeinflusst sind, wenn sie immer wieder verglichen werden mit anderen, wenn sie immer wieder konfrontiert werden mit: Warum werden denn von Ihnen weniger Herzkatheter-Untersuchungen indiziert als von anderen Ärzten in einer vergleichbaren Klinik? Dann kriegen Sie das gar nicht mehr aus dem Kopf raus. Und da gibt's eben insofern auch Beeinflussung."

Der frühere Klinikarzt und heutige Chef der privaten Krankenhauskette Schön Klinik, Mate Ivančić, widerspricht hier seiner Kollegin entschieden. Wenn in Deutschland heute mehr operiert werde als früher, dann weil es mehr Patienten gebe, die eine OP brauchen, sagt er. Außerdem könne man, etwa bei hochbetagten Menschen, heute OPs vornehmen, die vor 20 Jahren für sie noch zu riskant waren. An den finanziellen Anreizen durch das Fallpauschalen-System liege die höhere Zahl von OPs jedenfalls nicht:
"Ich kenne keine Daten, die das belegen. Dass wir sagen: Seit Einführung des DRG-Systems hat es in bestimmten Indikationsgebieten eine besondere, überproportionale Zunahme von Operationen gegeben. Diese Daten kenne ich nicht. Was wir im internationalen Vergleich sehen, das war aber in Deutschland unabhängig vom Fallpauschalen-System auch vorher so, dass wir doch ein Land sind, das auf die Einwohnerzahl gerechnet viele Wirbelsäulenoperation bekommen, viele Endoprothesen bekommen. Da sehe ich aber keinen Zusammenhang, zumindest sind mir keine Daten dazu bekannt, dass das mit dem Fallpauschalen-System zusammenhängt."
Sorgt die Bezahlung nach Fallpauschalen dafür, dass in den Kliniken wirtschaftliche Anreize gesetzt werden, die nicht gut für die Patienten sind? Susanna Johna, die Chefin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, ist davon überzeugt. Der Chef der privaten Krankenhauskette Schön Klinik, Mate Ivančić, sieht dafür keine Belege.
Breite Kritik an den Bundesländern
Eines aber sei sicher, sagt der Wirtschaftsprofessor Andreas Beivers von der Münchner Fresenius Universität: Die deutschen Krankenhäuser müssen möglichst viele Fälle abrechnen, um eine Finanzlücke zu schließen, die ihnen die Bundesländer eingebrockt haben. Die Länder haben eigentlich die Pflicht, Investitionen etwa für Neubauten oder Geräte abzudecken. Doch sie kommen dieser Pflicht nicht nach. Deswegen müssen die Kliniken dieses Loch mit Einnahmen aus den Behandlungen stopfen.
"Das würde ich sagen, ist empirisch bewiesen. Das ist, glaube ich, unstrittig unter den Gesundheitsökonomen im System. Und genau daran will man ja anknüpfen, zu sagen: Wie müssen wir jetzt ran, dass Kliniken nicht gezwungen sind, vor allem stationär zu behandeln, damit sie ihre Kosten und ihre Vorhalte-Leistungen finanzieren können."
Zu den überraschenden Sachverhalten im vermeintlich sehr korrekten Deutschland gehört es, dass die Bundesländer ihren gesetzlich festgeschriebenen Finanzverpflichtungen gegenüber den Kliniken seit vielen Jahren schlicht und einfach nicht nachkommen. Das ist kein Befund, den sich etwa die Krankenhausgesellschaft aus eigenem Interesse ausdenkt.
Der Bundesrechnungshof kam vor gut einem Jahr in einem Bericht zu dem Ergebnis, dass die Länder ihre Investitionsverpflichtung bei der Krankenhausfinanzierung "seit Jahren nur unzureichend" erfüllen. Die Förderung stagniere "auf gleichbleibend niedrigem Niveau", kritisierte der Rechnungshof. Die Länder stehen dabei unterschiedlich da. Bayern etwa gehört mit einer Förderquote von rund 60 Prozent zu den Spitzenreitern.
Für den Chef des kommunalen Krankenhausverbundes München Klinik, Axel Fischer, ist die vergleichsweise hohe Förderquote trotzdem problematisch: "Es bringt mir da auch nichts, wenn ich mich eigentlich freue, dass ich 60 Prozent jetzt meiner Bauten gefördert kriege. Also ich freue mich trotzdem, weil Bayern ist ja sowieso im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr hoch in der Förderung. Aber eigentlich müsste ich sagen: Es steht doch drin in der Krankenhausfinanzierung: Zu hundert Prozent."
Auch der Chef des AOK-Bundesverbandes Martin Litsch ärgert sich, dass die Bundesländer schlicht und einfach nicht das tun, wozu sie gesetzlich eigentlich verpflichtet sind: "Die Länder sind für die Finanzierung der Investitionen verpflichtet, aber die finanziellen Mittel sind über die Jahre immer kleiner geworden. Und wir haben heute nur noch drei Prozent unterm Strich für Investitionen, und wir brauchen mindestens acht Prozent. Das kann nicht funktionieren."
Klinikchef: "Wir haben zu viele Krankenhäuser"
Irgendwie funktioniert es allerdings dann doch. Aber nur deswegen, weil die Krankenhäuser die von den Kassen bezahlten Fallpauschalen einsetzen, um Löcher in ihren Budgets zu stopfen – Löcher, für die die Länder die Verantwortung tragen. Um hier gegenzusteuern, müssten die Bundesländer aber nicht nur ihren Finanzierungsverpflichtungen endlich nachkommen, findet der Chef der München Klinik, Axel Fischer. Er nimmt die Länder auch bei der Krankenhausplanung in die Pflicht, für die sie ebenfalls zuständig sind. Doch da gibt es in Fischers Augen zu wenig Planung und zu viel Festhalten an Strukturen aus früheren Jahrzehnten, als Landräte und Bürgermeister gerne immer wieder neue Kliniken eingeweiht haben.
Was den Klinikchef zu einer klaren Diagnose bringt: "Wir haben zu viele Krankenhäuser. Wir machen zu viel Medizin in Deutschland - Punkt." Fischer kennt das Argument, dass die dicht bestückte Krankenhauslandschaft der Grund gewesen sei, warum Deutschland vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist. Aber der Chef des Klinik-Verbunds, der im Frühjahr 2020 die ersten Covid-Patienten in Deutschland behandelt hat, kommt zu einem ganz anderen Ergebnis:
"Das ist doch ein Witz, die Aussage. Wir haben das doch nicht geschafft wegen 2000 Krankenhäusern. Sondern die haben wir geschafft, weil wir gewarnt waren wegen Bergamo. Wir haben gewusst, wenn wir nichts machen, so Lockdown, dann könnte es schlecht werden. Und dann haben wir es geschafft, weil wir alles mal runtergefahren haben. Und dann haben wir gemerkt, wie viel Kapazitäten im System noch da sind. Wir waren am Anschlag damals. Wir hatten zur Hochphase knapp 200 Patienten zur gleichen Zeit, 60 auf Intensiv. Das war irre. Aber die Kliniken neben uns, irgendwelche Spezialkliniken, die waren leer gestanden. Da hat uns aber keiner geholfen von denen. Da kann jetzt keiner sagen: Mensch, Gottseidank haben wir so viele Kliniken in München. Das ist doch lächerlich."
Bundesärztekammer: Planung von Krankenhäuser "neu denken"
Auch die Bundesärztekammer fordert von der nächsten Bundesregierung, sie müsse sowohl die Bezahlung als auch die Planung der Krankenhäuser "neu denken". Dieser Forderung schließt sich der Chef der München Klinik gerne an. Es gehe um eine zentrale Frage: "Wie ist der Bedarf in welcher Region? Und dann zu schauen, wie viele Betten brauche ich? Das ist mal ein Punkt eins." Die Krankenkassen waren in den vergangenen Jahren oft auf Konfrontationskurs zu Klinik-Chefs wie Axel Fischer. Vor sechs Wochen jedoch hat der AOK-Bundesverband mit der Allianz kommunaler Großkrankenhäuser, zu der auch die München Klinik gehört, ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht.
Der Vorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, ist selbst überrascht, dass ein solches Zweckbündnis zusammengekommen ist: "Das finde ich auch ein starkes Zeichen an die Koalition, dass man uns hier sozusagen sowohl die, die zahlen, als auch die, die Leistungen erbringen, beim Wort nimmt und hier wirklich an die Strukturen rangeht. Und die, sage ich mal, Krankenhäuser, die wir nicht brauchen, tatsächlich auch nicht weiter finanzieren."
Welche Kliniken gebraucht werden, und welche nicht, darüber lässt sich allerdings streiten. Der Chef der privaten Krankenhauskette Schön Klinik, Mate Ivančić, wünscht sich bei der Debatte darüber vor allem eines: "Der wichtigste Kernpunkt wäre aus meiner Sicht, dass wir klare Qualitäts-Zu- und Abschläge definieren müssten, und sagt: Krankenhäuser, die eine gute medizinische Qualität erbringen an ihren Patienten, die sollen Zuschläge bekommen. Und Krankenhäuser, die keine gute medizinische Qualität anhand anerkannter, wissenschaftlich anerkannter Parameter erbringen, die sollen Abschläge hinnehmen."
Forderung nach neuen Abrechnungskriterien
Der Chef des kommunalen Krankenhausverbundes München Klinik, Axel Fischer, ist bei etlichen Themen mit dem Privat-Klinik-Chef Ivančić nicht einer Meinung. Bei der Forderung nach einer Bezahlung, die sich nach Qualität richtet, und nicht nur nach der Menge, stimmt er Ivančić aber zu. Doch Fischer sieht große Defizite bei der Messung der Qualität. Diese Defizite habe es zu seiner Zeit als Arzt gegeben, bevor er ins Management gewechselt ist, und die gebe es heute noch:
"Ich sage Ihnen eins: Ich war sechs Jahre Arzt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich war. Null. Ich habe keine Ahnung. Die Leute, die ich operiert habe - Knieprothesen eingebaut und Hüftprothesen - Wie ging es denen? War ich besser als ein anderer? Oder ging es denen jetzt schlecht danach? Ich habe es nie erfahren. Ich habe keine Qualität messen können. Die haben mich danach nicht mehr angerufen. Wir haben es nicht nachgehalten, ich weiß es nicht."
Der Chef der Krankenhauskette Schön Klinik, Mate Ivančić, sieht aber viel Bewegung bei dem Thema: "Wir versuchen schon in vielen Studien, viele Patienten einzuschließen und bestellen die zur ambulanten Nachkontrolle nach Monaten wieder ein, weil wir auch der festen Überzeugung sind, dass diese medizinischen Ergebnisqualitäts-Parameter, die mir Aussagen geben, wie geht es einem Patienten nach sechs oder zwölf Monaten - das ist unsere feste Überzeugung, wird irgendwann auch in die Krankenhausvergütung mit einfließen."
Wenn man sich in der Krankenhauslandschaft umhört, sagen einem viele Profis, dass die Qualität bei der Bezahlung künftig eine größere Rolle spielen sollte. Man hört aber auch viele Einwände. Etwa den Einwand, dass eine Geburtsstation oder eine Notaufnahme natürlich optimale Qualität liefern müssen – sie müssen aber auch rund um die Uhr verfügbar sein, und zwar nicht allzu weit von den potenziellen Patientinnen und Patienten entfernt. So wie auch eine Feuerwehrstation verfügbar sein muss, egal, ob es gerade brennt oder nicht.
Qualität fängt schon bei der Diagnose an
Und neben dem Argument, dass nicht nur die Qualität zählt, sondern auch die Vorhaltung, gibt es auch den Einwand, dass die Qualität gar nicht so leicht zu messen sei. Bei einem 60-jährigen, ansonsten gesunden Patienten ist es leichter, einen guten Erfolg etwa bei einer Hüft-OP zu erzielen als bei einem 80-jährigen stark übergewichtigen Diabetiker mit Bluthochdruck. Der Gesundheitsökonom Andreas Beivers ist zwar zuversichtlich, dass sich solche Faktoren bei der Messung der Qualität immer besser herausrechnen lassen – er sieht aber noch ein weiteres Problem:
"Wir wollen natürlich auch das Ergebnis messen, das heißt, wie gut geht es den Patientinnen und Patienten nach der OP? Aber was bringt mir alleine die Ergebnisqualität, wenn ich sage, jemand hat jetzt eine tolle gute Hüfte bekommen oder künstliches Hüftgelenk, und die Operation ist super, wenn es aber nie gebraucht hätte, eigentlich? Also wir Ökonomen würden sagen, wir diskutieren immer am Ende der Wertschöpfungskette - ist es gut gelaufen? - aber fragen uns viel zu wenig: Braucht er sie eigentlich?"
Auch bei den Diagnosen sei mehr Qualitäts-Bewusstsein nötig. Denn eine unsaubere Diagnose kann eine Operation auslösen, die die dann zwar gut verläuft – die aber eigentlich überflüssig war. Bei der Diskussion über eine Neuordnung der Krankenhaus-Finanzen ist es also ein bisschen wie bei den russischen Babuschka-Puppen: Immer, wenn man denkt, ein Lösungsansatz sei gut durchdacht, tut sich ein neues Problem auf. Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, hat dabei vor allem einen Wunsch an die nächste Bundesregierung: "Bitte macht Planung und Finanzierung zusammen. Keinesfalls das in zwei verschiedenen Bereichen unabhängig voneinander machen. Das wird schiefgehen."
Reform des Krankenhausfinanzierung dürfte schwierig werden
Die Vorschläge der Ärztegewerkschaft für eine Reform des Vergütungssystems zeigen dabei, dass eine solche Neuregelung alles andere als einfach wird. Der Marburger Bund wünscht sich eine Kombination: Die Personalausgaben jedes einzelnen Krankenhauses sollen eine Rolle spielen – aber auch die Kosten für die Vorhaltung etwa von Geräten. Denn diese Vorhaltekosten sind bei einer Klinik, die sich auch um Notfälle und Geburten kümmert, anders als bei einer Klinik, die sich etwa auf Hüft-OPs spezialisiert. Dann wünscht sich der Marburger Bund ein Pauschalensystem für Sach- und Betriebskosten. Außerdem sollten endlich die Länder ihrer Pflicht nachkommen, die Investitionen der Krankenhäuser zu erstatten. Und schließlich müssten die Krankenhäuser viel enger mit Arztpraxen und ambulanten Pflegediensten verzahnt werden.
Die pensionierte Ärztin Ursula Wandl, die am Münchner Uniklinikum rechts der Isar ehrenamtlich als Patientenfürsprecherin arbeitet, ist zwar keine Aktivistin des Marburger Bundes, aber etlichen seiner Forderungen kann sie sich anschließen: "Es muss auf jeden Fall Sorge dafür getragen werden, dass das Personal vorhanden ist und dass das Personal gut ausgebildet ist, und dass auch die nächste Generation der Mediziner wieder zurückgeführt werden in ein Denken, nämlich: Tätigkeit am Menschen. Also es ist die Menschlichkeit ein bisschen verloren gegangen."
Und vor allem dürfe es nicht sein, dass Patienten aus Kostengründen möglichst schnell entlassen werden und dann alleine dastehen: "Es müsste ein System geben, dass kein Mensch die Klinik verlassen darf, wenn nicht sichergestellt ist, wie das sogenannte Auffangsystem zu Hause funktioniert."

Der Chef des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, verfolgt aufmerksam die verschiedenen Forderungen zu einer Reform der Klinikfinanzierung. Er hat dabei festgestellt: Kommunale Klinik-Träger, die nach dem Willen der Politik einen Sicherstellungsauftrag erfüllen sollen, haben oft andere Interessen als private Träger, die nach dem Willen ihrer Eigentümer vor allem möglichst viel Gewinn machen sollen. Die Arztpraxen rund um Krankenhäuser haben oft andere Interessen als die jeweiligen Kliniken. Krankenkassen haben nicht immer die gleichen Interessen wie Ärzte und Krankenhäuser. Die Bundesländer haben andere Interessen als der Bund.
Auf die Frage, wie schwierig – auf einer Skala von eins bis zehn – eine Neuordnung der Krankenhausfinanzierung werden könnte, gibt er deshalb diese Antwort: "Also ich würde das schon ziemlich nah an der Zehn einordnen. Also nicht vielleicht Zehn, aber eine Acht hat es auch verdient. Weil wir einfach sehr komplexe Interessenkonstellationen haben." Auf SPD, Grüne und FDP kommt also auch in diesem Bereich einiges zu. "Das System der Fallpauschalen zur Krankenhausfinanzierung wollen wir weiterentwickeln", heißt es im Sondierungspapier der künftigen Regierungskoalition.





