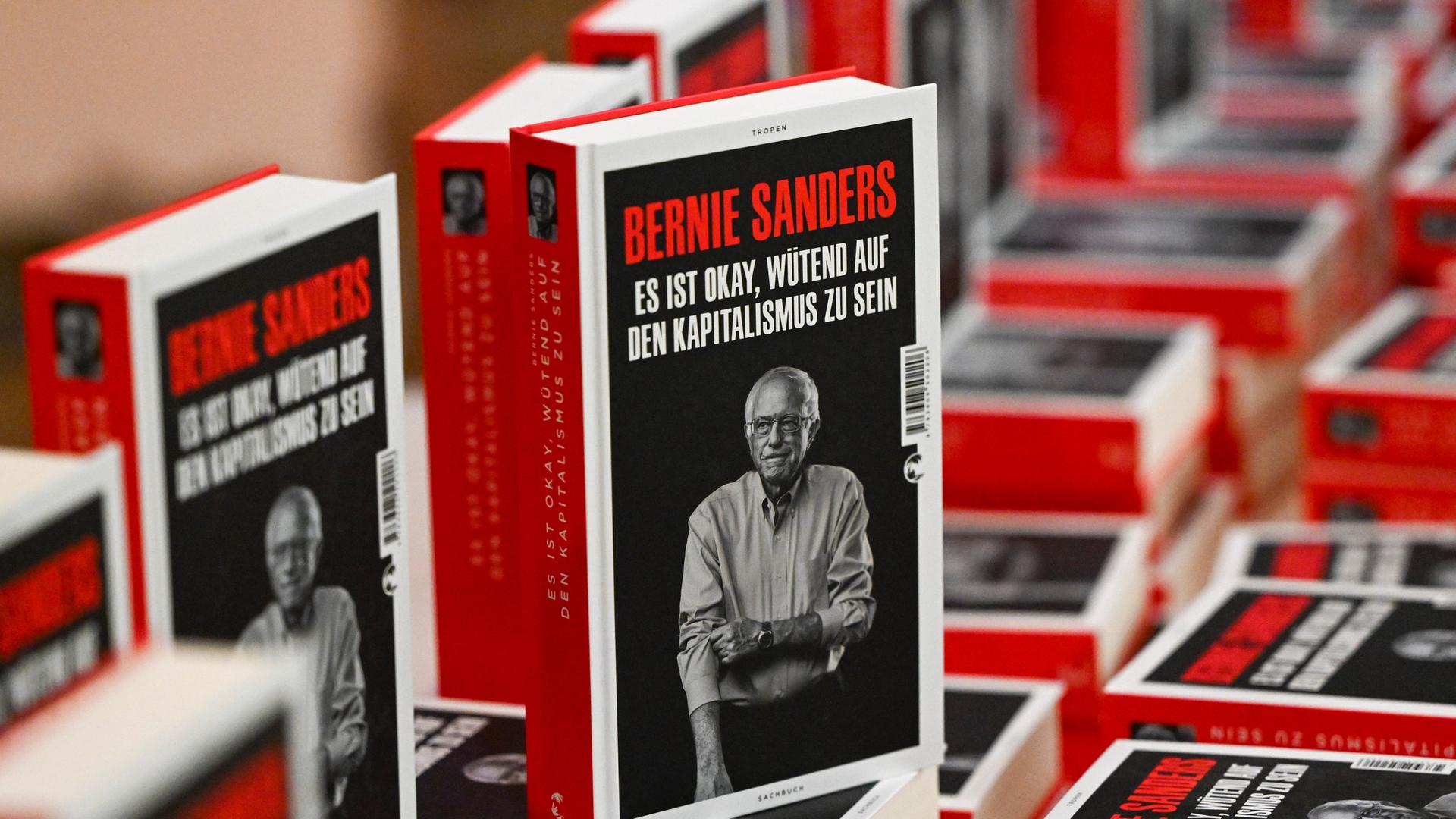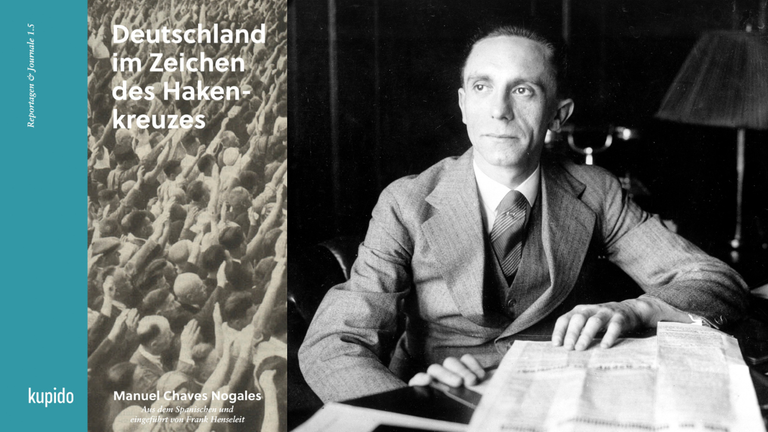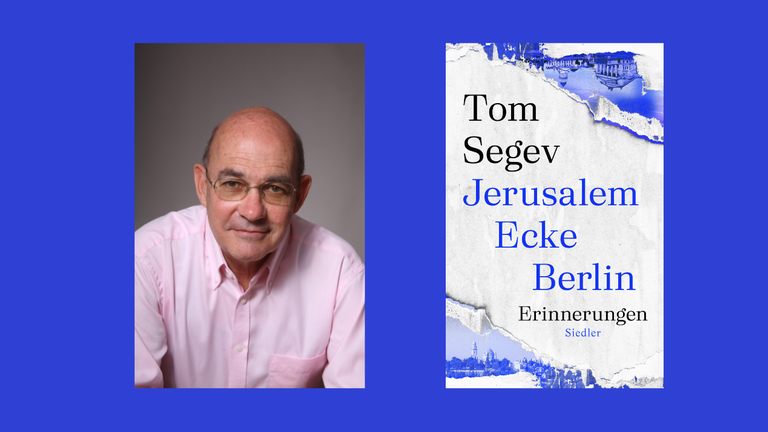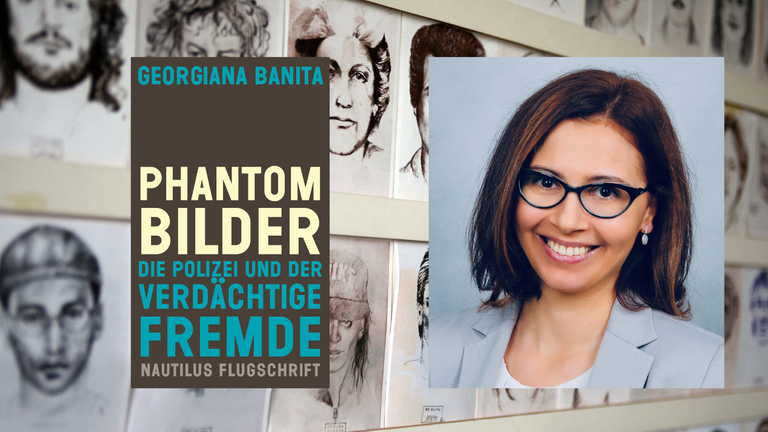Dieses Buch ist eigentlich für Menschen mit Wurzeln in Wuppertal, Karlsruhe oder Lübeck geschrieben, aber es wird wohl trotzdem erstmal mehr Menschen mit einer Ostbiographie erreichen. Warum? Da sind wir schon mitten im Thema.
Die Autorin und Journalistin Nicole Zepter schreibt darüber, was viele Menschen der dritten Generation Ost, der Nachwendekinder gerade umtreibt: die Verletzungen, Schmerzen und Herausforderungen der Nachwendezeit. Sie schreibt über das Erbe der DDR und die Vielschichtigkeit der Erfahrungen dort. Nur mit einem Unterschied: Sie erklärt das „ihren eigenen Leuten“. Also Menschen, die in Westdeutschland sozialisiert sind.
Nicole Zepter schreibt: „Die oft einschneidenden Konsequenzen des Mauerfalls im individuellen Lebenslauf erlitten ausschließlich Ostdeutsche, während im Westen das Leben zumindest bis zu den Hartz IV-Reformen wie gewohnt weiterging.“
Häme statt Hochachtung
Das wirklich Spannende an diesem Buch ist dann der zweite Teil. Zepter will klären: Warum sind Westdeutsche seit Jahren und noch immer so herablassend und höhnisch? Wie konnte es passieren, dass ein einzigartiger historischer Moment der Euphorie – als kurz mal alle „Brüder und Schwestern“ waren – so schnell in Verwunderung, Ablehnung, Spott umgeschlagen ist? Bis heute. Man denke nur an den viel kritisierten Titel des Spiegels vor drei Jahren: „So isser, der Ossi.“
Vielleicht wäre in Anlehnung daran auch „So isser, der Wessi“ ein passenderer und provokanterer Titel für Zepters Buch gewesen. Denn „Wer lacht noch über Zonen-Gaby?“ dürfte bei vielen unter 40 erstmal die Frage aufwerfen: Wer ist denn jetzt Zonen-Gaby? Die Frau vom ikonischen Titel der Satirezeitschrift „Titanic“ vom November `89 müssen viele potentielle Leserinnen und Leser vermutlich erstmal googlen.
Der Witz funktioniert aber eben immer noch: Nicole Zepter trägt Wissen, Erfahrungen und Erlebnisse ostdeutscher Historiker, Journalistinnen, Schriftsteller und Künstlerinnen sehr einfühlsam zusammen. Sie erklärt, wie tief das Label der angeblich Rückständigen, Diktatursozialisierten sitzt bei Menschen zwischen Rostock und Suhl, was Treuhand, Arbeitslosigkeit und Abwertung in vielen ausgelöst haben. Und sie zeigt, was versäumt wurde:
„Die Wiedervereinigung ist keine Leistung von Westdeutschen. Die Friedliche Revolution ist zunächst eine Leistung von Ostdeutschen, die ein großes persönliches Risiko auf sich genommen haben, um den politischen Umsturz zu schaffen. Diese Leistung von Ostdeutschen wurde und wird bis heute oftmals nicht wertgeschätzt oder überhaupt verstanden.“
"Ignoranz gegenüber Ostdeutschen"
Das klingt sicher schön in den Ohren vieler Menschen im Osten Deutschlands. Aber aus ihnen allen „Held:innen“ zu machen, wie Zepter das formuliert, wirkt doch etwas übertrieben. So einfach ist es eben nicht. Zepter spricht deshalb aber auch die offensichtlichen Probleme in den fünf Bundesländern an – nur eben jenseits der üblichen Erklärungsklischees:
„Mehr als drei Jahrzehnte nach der deutschen Wiedervereinigung reagieren die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern deutlich skeptischer auf andere gesellschaftliche Gruppen als diejenigen in den westdeutschen Bundesländern. […] Doch ich konnte die Skepsis nachempfinden, ich verstand das Misstrauen. Es resultierte für mich direkt aus der jahrelangen Ignoranz gegenüber Ostdeutschen.“
Woher kommt die Ignoranz? Nicole Zepter geht zurück bis in die 1950er Jahre, um den Blick der Westdeutschen zu erklären. Der Kalte Krieg, der jahrzehntelang die Welt schwarz-weiß malte; als immer unterschieden wurde zwischen „denen“ und „uns“. Leistung zählte im Kapitalismus der Wirtschaftswunderzeit – und war auch gern genommen, um die eigene braune Vergangenheit wegzudrücken.
Trübe Klischees über Ost- und Westdeutsche
Der Wessi als der Überlegene, als Sieger der Geschichte. Und so habe man dann auch auf den Osten nach der Wende geguckt: Der Ossi als Opfer. Und gleichzeitig die Angst, dass die alte Ordnung untergeht:
„Wer in den Fünfzigerjahren in Westdeutschland sozialisiert wurde, kennt das Prinzip: Härte gegen Härte, da saß noch der Drill der Nachkriegszeit. Und so war in diesen Jahren mit einer Meldung über die emotionale Verfassung der Menschen ‚im Osten‘ keine Schlagzeile zu machen. Mit ‚Sollen die Ossis bleiben, wo sie sind‘ schon.“
Zepter findet das zynisch. Und attestiert auch ihrer eigenen Generation, dass sie den zynischen Blick übernommen habe: „Für die Mehrheit meiner Generation, der ‚Generation Golf‘, fand die Wiedervereinigung nur als Nachricht statt. Begegnungen, Austausch, Kennenlernen, das blieb alles aus. Trotz Partnerstadt und Klassenreise nach Berlin spürte auch ich als Teenager in meiner westdeutschen Kleinstadt kaum etwas von dem Wunder, das sich gerade in Europa ereignet hatte.“
Plädoyer für Dialog, Interesse, Versöhnung
Damit müsse Schluss sein, findet Zepter. Und dafür müssten eben auch die Westdeutschen sich der Diskussion stellen: Woher sie kommen und was sie in den vergangenen 30 Jahren versäumt haben.
„Es gibt eine Chance auf Seiten der ‚Westdeutschen‘, die Sorgen und Ungerechtigkeiten ernst zu nehmen – und ihnen zu begegnen. Dafür bedarf es des Wissens um die Geschichte und des Erkennens der eigenen Verantwortung. Wir müssen es besser machen als die vorherigen Generationen.“
Zepter hat mit ihrem Buch angefangen. Ihre große Entschuldigung am Ende - gar nicht entscheidend. Wichtiger wäre, dass sie nicht alleine bleibt. Und sich Menschen zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg auch dafür interessieren.
Nicole Zepter: „Wer lacht noch über Zonen-Gaby? Ein Vorschlag zur Versöhnung“
Tropen Verlag, 192 Seiten, 18 Euro.
Tropen Verlag, 192 Seiten, 18 Euro.