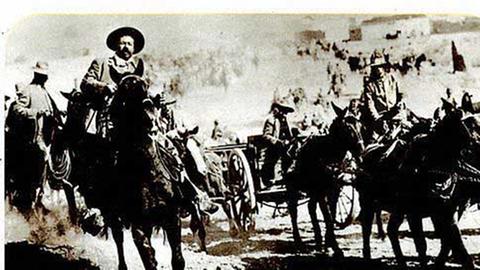Schumann: Dieser letzte Teil ist der Mexicanidad, der kulturellen Identität, gewidmet, und mein Gesprächspartner ist der Schriftsteller Juan Villoro. Er gehört zur jüngeren Autoren-Generation, ist einer ihrer profiliertesten Vertreter und den deutschen Lesern durch die Romane „Das Spiel der sieben Fehler“ und „Die Augen von San Lorenzo“ bekannt geworden.
Juan Villoro, auch Sie will ich zunächst fragen: Was halten Sie von den vorgesehenen Feierlichkeiten zu 200 Jahren Unabhängigkeit und 100 Jahren Revolution in Mexiko?
Villoro: Die Situation ist kompliziert, denn die Feierlichkeiten muss eine konservative Regierung ausrichten, die weder an Unabhängigkeit noch an Revolution glaubt. Die Regierungspartei PAN war schon immer sehr auf Spanien fixiert. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen wurde beispielsweise Felipe Calderón vom konservativen spanischen Ex-Präsidenten Aznar unterstützt. Und die Kategorie Revolution liegt einer konservativen Partei sowieso sehr fern ... Das kommt mir so vor, wie wenn die Eskimos die Tropen feiern wollten.
Schumann: Was für besondere Maßnahmen hat denn die Regierung bisher unternommen, um diese beiden historischen Ereignisse ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen?
Villoro: Die mexikanischen Autobahnen wurden in ‚Autobahnen des Bicentenario‘ umgetauft. Brücken erhielten die Bezeichnung ‚Bicentenario‘. Das Fest wurde zur Marke. Am Tag der Unabhängigkeit, dem 16. September, wird es ein Fest auf dem Zócalo, dem größten Platz in Mexiko-Stadt geben. Es soll 60 Millionen Dollar kosten und wird von dem Künstler gestaltet, der für die Eröffnungsshow der Olympischen Spiele in Sydney zuständig war. Es wird sicher von hoher technischer Qualität sein, aber so etwas halte ich nicht für die beste Form, Geschichte zu würdigen. Hier wird die große Chance verpasst, über die wirkliche Geschichte Mexikos nachzudenken. Es gibt so vieles, über das nicht gesprochen wurde.
Schumann: Dann wollen wir damit beginnen. Wie weit ist Mexiko heute unabhängig?
Villoro: Wir sind heute von Spanien sicher nicht mehr politisch abhängig. Aber die Mehrheit der Mexikaner besäße am liebsten eine Kreditkarte von einer spanischen Bank. In der wichtigsten lateinamerikanischen Fußballliga ging es früher um den Befreier-Pokal, weil damit an die Vorkämpfer der Unabhängigkeit erinnert werden sollte. Dann wurde er in Santander-Befreier umbenannt, weil er von der spanischen Bank Santander gesponsert wird ... Gas Natural gehört zu einem spanischen Energie-Konzern, das Strom-Unternehmen Endesa ist spanisch genauso wie Telefónica. Eigentlich müsste Spanien diese Unabhängigkeit mehr feiern als wir.
Schumann: Gilt das auch für die Kultur? Beeinflusst Spanien noch immer die mexikanische Kulturlandschaft?
Sprecher:
Die drei größten Verlage, die in Mexiko tätig sind, gehören zu spanischen Konzernen. Die größte Zeitung ist in spanischen Händen. Das mexikanische Radio wird zum Teil von Spaniern kontrolliert. Unsere kulturelle Unabhängigkeit ist also sehr relativ.
Schumann: Ist das Erbe der Mexikanischen Revolution noch existent? Was ist davon übrig geblieben?
Villoro: Dazu muss ich sagen, dass ihre wichtigsten Ziele nie völlig verwirklicht wurden. Der österreichische Historiker Friedrich Katz schrieb in seinem Buch „Der geheime Krieg in Mexico“: Die Mexikanische Revolution ist die einzige der Welt, die sich ihre ideologische Gültigkeit bewahrt hat. Das kann man daran sehen, dass sehr unterschiedliche politische Kräfte ihr Erbe für sich in Anspruch nehmen: zum Beispiel die PRD, die Partei der demokratischen Revolution, die unsere Linke vertritt; aber auch die PRI, die Institutionelle Partei der Revolution, die jahrzehntelang regiert hat; genauso wie die eher virtuelle als reale Guerrilla der Zapatista mit Subcomandante Marcos an der Spitze. Außer der PAN kann fast jede politische Richtung mit der Revolution etwas anfangen, was wohl damit zusammenhängt, dass die großen Ziele der Revolution unvollendet blieben: die soziale Gerechtigkeit und die Demokratie. Unsere Demokratie ist gerade erst im Entstehen, und den heutigen Zustand unseres Landes hat bereits im 19. Jahrhundert Alexander von Humboldt beschrieben: das Land der Ungerechtigkeit.
Schumann: Mexiko ist jedoch nicht nur von Spanien abhängig. Ist es heute nicht viel stärker an die USA gebunden, an den nördlichen Nachbarn geradezu angekettet?
Villoro: Natürlich sind wir vor allem von den Vereinigten Staaten abhängig. Nahezu 20 Millionen Mexikaner arbeiten dort, das zeigt, wie sehr unsere Wirtschaft von ihnen abhängt. Zehn Prozent des Bruttosozialprodukts stammen von den Überweisungen der Mexikaner in den USA. Eine sehr ernste Form von Abhängigkeit.
Schumann: Ich habe Mexiko in den 70er-Jahren kennengelernt und als ein sehr monolithisches Land empfunden, mit einer einzigartigen indigenen Kulturtradition. Hat sie verhindert, dass Mexiko als Brücke dienen konnte zwischen der angelsächsischen und der lateinamerikanischen Welt?
Villoro: Ich glaube, dass es in Mexiko den Komplex des kleineren Bruders gab. Anstatt sich verschiedenen Ländern zuzuwenden, hat Mexiko die Unterstützung eines größeren Bruders gesucht. Anfangs war es Spanien, später waren es die USA. In vielen lateinamerikanischen Konferenzen hat Mexiko eher für die Ziele der Vereinigten Staaten Position bezogen, denn es glaubte, dadurch eine privilegierte Beziehung zu den USA zu erhalten ... Es gibt übrigens eine sympathische, kolumbianische Telenovela, die das zum Ausdruck bringt: Kaffee mit dem Aroma einer Frau. Dort wurde ständig über den internationalen Kaffee-Handel diskutiert. Wann immer eine Szene an der Kaffee-Börse in London spielte: Das erste lateinamerikanische Land, das die anderen verriet und sich mit den Mächtigen verbündete, war Mexiko.
Schumann: Ich möchte noch einmal auf diesen monolithischen Charakter Mexikos zurückkommen. Wo hat er sich Ihrer Meinung nach am stärksten gezeigt?
Villoro: Wir haben drei monolithischen Gesellschaften gehabt: die aztekische Kultur, die ein sehr strenges, monolithisches Imperium war; dann die Kolonie, die drei Jahrhunderte lang ein Gesellschaftssystem pflegte, das auf Spanien ausgerichtet war; und schließlich die PRI, die 70 Jahre lang an der Macht war, eine weitere Herrschafts-Pyramide. Mexiko war kaum an Alternativen interessiert. Es war aber andererseits auch ein Asylland für viele Lateinamerikaner. Meine Generation konnte sich an Professoren orientieren, die aus Guatemala, Chile, Peru, Argentinien, Brasilien kamen ... Wir wurden eher durch Zufall von diesen Menschen bereichert, die bei uns Zuflucht suchten. Deshalb wurde die mexikanische Gesellschaft immer kosmopolitischer in den 70er-Jahren. Aber es gab kein nach außen orientiertes Projekt.
Schumann: Dennoch haben die Mexikaner durch die massenhafte Emigration in die USA die Kultur des nördlichen Nachbarn sehr stark beeinflusst. Man könnte fast sagen: Sie haben sie unterwandert. Denn die dort ansässig gewordenen Mexikaner, die sogenannten Chicanos, haben eine eigene Kultur entwickelt. Gehört sie noch zur mexikanischen Identität?
Villoro: Sie ist ein sehr fruchtbares Element und hat das Leben in den USA hat nachhaltig verändert. In der Alltagskultur lässt sich das am besten studieren. Der in Kalifornien am meisten verwendete Vorname ist José. Die Guacamole, die Avocado-Kreme, macht längst den Pommes frites den Rang streitig ... Viele Kinder werden von mexikanischen Hausmädchen aufgezogen und haben dabei spanisch gelernt. Ich habe vor einigen Jahren an der Yale-Universität einen Kursus über mexikanische Literatur gegeben, und ich war erstaunt, dass kaum einer meiner Studenten von den Geisteswissenschaften kam. Die jungen Leute wollten die kulturelle Realität besser kennenlernen, auf die sie im Alltag ständig stießen: die mexikanischen Wertvorstellungen, die Bedeutung von Symbolen, die Mythologien und den Aberglauben.
Schumann: Ich habe die Chicano-Kultur immer als eine seltsam hybride Mischform empfunden.
Villoro: Es ist eine Art dritter Kultur in der Mitte zwischen der mexikanischen und der nordamerikanischen, diese Chicano- oder Tex-Mex-Kultur. Sie besitzt aber durchaus eigene Werte. In der Chicano-Kultur wird nicht der Tag der Unabhängigkeit, der 16. September, gefeiert, sondern der Tag der Schlacht von Puebla, der 5. Mai, als die Franzosen geschlagen wurden, die den Kaiser verteidigen wollten. Es ist ein anti-imperiales Fest. Die Chicanos haben auch die Jungfrau von Guadalupe, die Schutzheilige Mexikos, neu entdeckt. Sie ist bei uns zwar ein sehr geachtetes, aber auch sehr konventionelles Sinnbild. Die Chicanos sehen in ihr wieder das Symbol des Kampfes genauso wie Pater Hidalgo, der 1810 in die erste Schlacht um die Unabhängigkeit zog, mit der Jungfrau auf seiner Fahne.
Schumann: Seit wann kann man denn überhaupt von einer mexikanischen Kultur sprechen?
Villoro: Ich glaube, sie hat nach der Eroberung begonnen als diese Mischung aus spanischen und indigenen Elementen, die es auch heute noch gibt. Sie ist also von ihrem Ursprung her multikulturell. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Azteken nicht das einzige indigene Volk waren und dass nicht alle indigenen Völker die gleichen Werte und die gleichen gesellschaftlichen Vorstellungen besitzen ... In Mexiko gibt es 62 unterschiedliche indigene Kulturen, die teilweise recht gegensätzlich sind.
Schumann: Ist die mexikanische Kultur nicht aus einem Kulturschock entstanden: aus dem Zusammenprall der indigenen und der spanischen Kultur?
Villoro: Ja, und dieser Kulturschock ist teilweise noch immer ein Trauma. Die Grabstätte des spanischen Eroberers Hernán Cortés hat keinen Namen, und in Mexiko-Stadt gibt es noch nicht mal ein Denkmal von ihm. In Lima wurde dagegen eine Statue von Pizarro errichtet, der Peru erobert hat. Die Figur von Cortés angemessen zu würdigen, bedeutet ja nicht, die Eroberung zu rechtfertigen und alles, was sich damit an Raub und Blut verbindet. Aber Cortés ist ein Teil von uns. Wir sprechen ja heute auch noch meist spanisch in Mexiko. Wir müssen endlich die Vielfalt unseres Wesens anerkennen und uns von solchen Komplexen freimachen. Darauf hat uns unser großer Künstler José Clemente Orozco bereits vor Jahrzehnten auf seinen berühmten Wandbildern hingewiesen. Er teilte nicht die weitverbreitete Meinung, dass die Eroberung ein reiner Akt der Niedertracht war. Bei ihm küsst ein Eroberer eine Indigena. José Clemente Orozco wollte damit zum Ausdruck bringen: Wer diesen Kuss nicht akzeptiert, akzeptiert nicht unser mestizisches Wesen.
Schumann: Andere lateinamerikanische Länder sind durch Einwanderer aus Europa oder auch aus Asien stark verändert worden. Was für andere ausländische Einflüsse haben die kulturelle Identität Mexikos geprägt?
Villoro: Die Vermischung unserer Kulturen und Rassen beruht auf verschiedenartigen Gemeinschaften, die sich mit der Zeit in unser Leben integriert haben: die jüdische Gemeinde beispielsweise. Sie ist nicht so groß wie in Frankreich oder Argentinien, sie hat aber die Unternehmenskultur, die Medizin und das kulturelle Leben vielfach geprägt. Oder die libanesische Gemeinde, die heute etwa 10 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes hervorbringt. Der reichste Mann Mexikos und der Welt, Carlos Slim, ist Libanese. Wir Mexikaner von heute stammen aus diesem Schmelztiegel, in dem der reichste von uns ein Libanese ist.
Schumann: Mexiko besitzt also eine starke kulturelle Basis, auf der sich die Vielfalt der heutigen mexikanischen Kultur entwickelt hat. Wo drückt sie sich besonders aus? Vielleicht in der mexikanischen Kunst?
Villoro: Es gibt sicher eine Kunst, die als typisch mexikanisch gilt, die mit Farben arbeitet, die für besonders mexikanisch gehalten werden: rot oder rosa. Oder Künstler wie Rufino Tamayo und Francisco Toledo oder die mexikanische Wandmalerei. Doch ich glaube, dass sich das spezifisch Mexikanische eher auf eine subtile Weise ausdrückt. Trotzdem gibt es unverkennbare Merkmale ... In der Literatur war beispielsweise die Figur des Kaziken sehr wichtig, nicht nur der feudale Typ, der über große Ländereien herrscht wie Pedro Páramo, die Hauptfigur des Meisterwerks von Juan Rulfo, auch der autoritäre Familienvater oder der Politiker der PRI, der Kapo eines Drogenkartells oder ein Kriminalbeamter, der niemand Rechenschaft leistet.
Schumann: Sind das die Hauptdarsteller der immer wieder zitierten Kultur der Straflosigkeit? Und was versteht man darunter?
Villoro: Die Kultur der Straflosigkeit ist leider für das heutige Mexiko ganz typisch, ... denn manche Kreise finden es seit Langem sehr attraktiv, in einem Freiraum der Straflosigkeit zu agieren. Andy Warhol hat einmal über die Kultur des Ruhms in den USA gesagt: „In der Zukunft wird jedermann 15 Minuten lang berühmt sein können.“ Auf Mexiko übertragen, hieße das: Jeder kann künftig 15 Minuten lang straflos sein. Es ist auch nicht zufällig, dass die mexikanische Politik gern Begriffe wie ‚Schatten‘ und ‚Dunkelheit‘ benutzt. Politik nennt man ‚die Finstere‘, etwas, das im ‚Dunkeln‘ geschieht ... Macht wird oft ‚hinter den Kulissen‘ ausgeübt, das heißt im ‚Schatten‘. Einer unserer berühmtesten Romane heißt: „Der Schatten des Caudillo“ von Martín Luís Guzmán ... Unser bekanntestes Theaterstück hat den Titel „Der Grimassenschneider“ von Rodolfo Usigli. Der Titel signalisiert: Der mexikanische Politiker verbirgt sich hinter Masken, er täuscht, stellt sich keiner Rechenschaft, herrscht über die anderen.
Schumann: Herr Villoro, Sie haben eindrucksvoll beschrieben, dass die mexikanische Kultur tief verwurzelt ist. Aber ist diese Mexicanidad, diese kulturelle Identität, heute in Zeiten der Globalisierung und der Internationalisierung von Kultur nicht bedroht?
Villoro: Es gibt Länder wie China, Indien oder Mexiko, die Jahrtausende alte Kulturen haben. Sie sind ein großer Schutz, weil sie Jahrhunderte lang der geistige Horizont geblieben sind. Sie können aber auch wie eine Grabplatte wirken, die einen niederdrückt. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass die mexikanische Kultur offen bleiben muss für Neubewertungen.
Schumann: Gilt das auch für die umstrittene Gestalt der Malinche, der indianischen Frau des spanischen Eroberers Cortés?
Villoro: Sie ist von zentraler Bedeutung ... Wenn heute allerdings jemand als malinchista bezeichnet wird, dann gilt er als Verräter der Seinen. Tatsächlich war Malinche eine Frau, die versklavt wurde ... , sich aber aus eigenen Kräften einen ungewöhnlich hohen Grad an Kultur angeeignet hat. Sie wurde die erste Übersetzerin Mexikos, denn sie beherrschte die Sprachen der Azteken wie der Mayas und konnte sie ins Spanische übersetzen und so die Verständigung ermöglichen. Sie ist wahrscheinlich auch die Mutter des ersten mexikanischen Mestizen. Deshalb ist es sehr wichtig, diese Figur in ihrer wirklichen Bedeutung wiederzuentdecken: als Essenz unseres Seins und eines Volkes, das verurteilt war und sich kraft der Kultur zu befreien und den Anderen zu verstehen lernte. Die Malinche durchlief einen anthropologischen Prozess: Sie wurde zunächst von ihrer Familie anderen Indigenas ausgeliefert, kam dann zu den Spaniern und versuchte dort das Wesen der Unbekannten zu begreifen ... Es gibt viele offene Fragen, die bei den Feierlichkeiten des Bicentenario behandelt werden könnten.
Schumann: Zur mexikanischen Kultur gehören nicht nur solche faszinierenden Gestalten der Geschichte. Dazu zählt heute auch ein eher deprimierendes Kapitel, dem man die Bezeichnung Narco-Kultur verpasst hat. Was umfasst dieser Begriff?
Villoro: Seit mehr als 100 Jahren gibt es Schmuggel und Drogenhandel in Mexiko. Und seit etwa 40 Jahren operiert das organisierte Verbrechen mit zunehmender Macht, sodass sich so etwas wie eine Subkultur gebildet hat, eine parallele Normalität des Lebens. Heute kann man in bestimmten Gebieten Mexicos ein Leben führen, das völlig mit dem Drogenhandel verbunden ist. Es gibt Schulen und Kirchen, die von der Mafia kontrolliert werden ..., sowie Festsäle, Sportclubs und Krankenhäuser. Man kann dort geboren werden, aufwachsen, zur Schule gehen, heiraten, Sport treiben und befindet sich dabei in einem völlig von der Mafia kontrollierten Kreislauf. Das ist für mich die parallele Normalität. Alle Verwandten und Bekannten arbeiten vielleicht in der Landwirtschaft, aber tatsächlich für den Drogenhandel.
Schumann: Wird diese ‚parallele Normalität‘, dieses Falschspiel, allgemein toleriert?
Villoro: Die Leute wissen genau, wer die Drogenhändler sind. Ich habe verschiedene Orte im Bundesstaat Sinaloa besucht, und man hat mir ihre Häuser gezeigt. Es gibt sogar Führungen dorthin, ähnlich wie die zu den Prominenten in Hollywood. Man weiß genau, wo sie sind, wie sie leben, was sie essen, wie sie sich kleiden. Aber sie werden nicht verhaftet, weil das organisierte Verbrechen seit 40 Jahren auch die meisten Behörden unterwandert hat.
Schumann: Wir haben in unserem letzten Gespräch mit Carmen Aristegui ausführlich über die ständig steigende Zahl der Morde und die fatale Politik der Regierung gesprochen. Wenn das organisierte Verbrechen quasi das gesamte Leben einer Gemeinde bestimmt, wie weit reicht dann sein Einfluss auf die Kultur?
Villoro: Es gibt die sogenannten Narcocorridos, die das Verhalten der Narcos beschreiben. Die Mehrzahl dieser Lieder wird von ihnen bezahlt: Sie sollen ihr Leben verherrlichen. Radiosender strahlen sie aus. Auf CDs zirkulieren sie. Es gibt sogar öffentliche Konzerte: eine parallele Normalität. Kürzlich hat der Vorsitzende der Wahlkommission gesagt: Wenn heute Wahlen stattfänden, dann wäre es möglich, dass in 15 Prozent unseres Staatsgebietes keine Wahllokale eingerichtet werden können, weil es keine ausreichende Sicherheit gibt. Es geht also hier also nicht nur um eine Subkultur, um den Anschein von Normalität, sondern um den realen Verlust von staatlicher Souveränität, der – nach dieser Berechnung – in 15 Prozent unserer Regionen herrschen soll.
Schumann: Bedeutet dieser Verlust staatlicher Kontrolle nicht auch einen Verlust gesellschaftlicher Werte?
Villoro: Natürlich hat der Drogenhandel auch das Wertesystem deformiert. Die Regierung will das aber nicht begreifen. Die Anthropologin Rosana Rojillo hat in einer Untersuchung nachgewiesen, dass die Killer der Drogenmafia sich ganz ähnlich verhalten wie die Teilnehmer an einem heiligen Krieg. Die Allgemeinheit glaubt, wenn einer von denen getötet wird, dann ist das ein Schritt zur Lösung des Problems. Aber tatsächlich gehört der Tod zum Lebensbild der Mafiosi. Er stellt für sie keine Barriere dar, sondern eher einen Antrieb. Die Killer wissen, dass sie in ihrem kurzen Leben jede Art von Horror erfahren werden. Deshalb möchten sie etwas hinterlassen, zum Beispiel ein Häuschen für ihre Mutter. Fast die gesamte Drogenmafia ist katholisch ... Wir erleben also einen Krieg unter radikalen Katholiken auf beiden Seiten: die Regierung der PAN, die katholisch ist, gegen die Narcos, die auch katholisch sind oder es jedenfalls behaupten.
Schumann: Es gibt inzwischen eine Fülle von Literatur, deren Autoren sich in analytischer, dokumentarischer oder fiktionaler Form mit der Gewalt der Mafia, aber auch mit dem staatlichen Terror durch den Einsatz des Militärs auseinandersetzen. Darin werden besonders brutale Praktiken dargestellt wie zum Beispiel die Enthauptung der Opfer. Wieso greifen diese Killer zu solchen Methoden?
Villoro: Das organisierte Verbrechen begeht ‚Urheber-Morde‘, das heißt ein Kartell identifiziert sich durch die Art der ausgeübten Gewalt. Es gibt eine Grammatik des Terrors, die leider den Kampf gegen diese Grammatik übertrifft. Ich habe den Eindruck, dass die Narcos in den letzten Jahren zweimal zugeschlagen haben: zum einen durch ihre Taten und dann durch die Resonanz, die das Fernsehen und die Medien ihnen verschafft haben ... Diese überzogene Darstellung der Gewalt könnte zu zwei extremen und gleicherweise negativen Reaktionen führen: der Banalisierung durch Gewöhnung an die Gewalt. Es gibt bereits Geschichten von Kindern, die in Ciudad Juárez, die als gewaltreichste Stadt der Welt gilt, mit Leichen spielen. Das andere Extrem wäre die Paranoia: Wir gehen nicht mehr auf die Straße aus Angst vor der in den Medien geschilderten Gewalt.
Schumann: Verlangen Sie eine Zensur der Bilder, die die Medien verbreiten?
Villoro: Es wundert mich, dass es bis heute keine Diskussion und keinen Konsens oder eine nationale Konferenz darüber gibt ... , wie man mit der Gewalt umgehen, wie weit man sie darstellen oder ob man überhaupt darauf verzichten sollte. Denn die Art ihrer Darstellung kann das organisierte Verbrechen schwächen oder stärken. Auf dieses Problem kann man auch nur in konzertierter Form antworten, denn wenn eine Zeitung solche Bilder nicht mehr veröffentlicht, die andere aber doch, dann ist die Zeitung im Nachteil, die diese Information nicht bietet ... Natürlich will ich keine Zensur, aber einen verantwortungsvollen Umgang mit der Gewalt.
Schumann: Dazu würde auch die Frage gehören: Gibt es unter der Fülle von Büchern eine Literatur – ähnlich wie in dem anderen Drogenland Kolumbien –, die spekulativ mit dem Thema umgeht?
Villoro: Glücklicherweise gab es bis jetzt keine unverantwortliche oder oberflächliche Darstellung der Drogenmafia. Die Lage ist auch zu ernst. Reporter ohne Grenzen zählt Mexiko – neben dem Irak – zu den für Journalisten gefährlichsten Ländern der Welt: Wenigstens einer von ihnen stirbt jeden Monat, sie arbeiten also mit hohem Risiko. Ich glaube, dass sich deshalb auch unter den Schriftstellern die Überzeugung verbreitet hat, dieses Thema sehr ernst zu nehmen.
Schumann: Auch in Filmen wird das organisierte Verbrechen dargestellt. Jüngst erschien sogar eine DVD über die Drogenkartelle. Gibt es auch Beispiele in der bildenden Kunst?
Villoro: Auf der letzten Biennale in Venedig hat Teresa Margolles beispielsweise eine Installation zeigt mit dem Titel: Wovon sollen wir denn sonst sprechen? In einem alten, völlig leeren Palast ließ sie täglich den Fußboden mit dem Blut von Opfern der Drogenkartelle aufwischen. Sie inszenierte in die Leere hinein eine rhetorische Frage und zugleich den Schrecken ... Eine andere Künstlerin, Rosa María Robles, schuf die Installation „Der rote Teppich“. Sie beschaffte sich in einem Gericht Leinentücher, in denen Opfer eingewickelt waren. Es gehört zu dieser ‚Grammatik des Terrors‘, dass eines der Kartelle seine Leichen verpackt ... Diese blutigen Hüllen legte sie in einer Galerie wie einen roten Teppich aus. Doch anders als jener für Feierlichkeiten war dieser rot von Blut. Als das bekannt wurde, mussten diese ‚Beweisstücke‘ entfernt werden. Also machte Rosa María Robles etwas sehr Bemerkenswertes: sie kaufte neue Leinentücher und tränkte sie mit ihrem eigenen Blut.
Schumann: Und machte so den Schrecken fassbar.
Villoro: Das ist eine wichtige symbolische Aussage. Lange glaubten wir, dass das organisierte Verbrechen und die Drogenmafia weit weg von uns operierten. Und dass die Narcos sich nur untereinander umbrachten. Natürlich waren diese Meinungen eine defensive Reaktion um die Tragödie zu mildern. Aber inzwischen mussten wir erleben, wie mitten in der Stadt Michoacán Granaten in einer wehrlosen Menschenmenge explodierten; wie in Monterrey alle Ausfallstraßen vom organisierten Verbrechen gesperrt wurden; und wie in Ciudad Juárez eine Gruppe von Jugendlichen bei einem Fest umgebracht wurde. Das Blut kann heute von jedem von uns stammen.
Schumann: Ist die mexikanische Kultur stark genug, um dem System der täglichen Gewalt und dem ständigen Werteverlust Widerstand zu leisten?
Villoro: Die mexikanische Kultur ist unser wichtigster Aktivposten. Sie ist sehr stark und vital, die populäre Musik ebenso wie der Film, die Poesie genauso wie der Roman und das Theater. Es gibt überall sehr interessante Beiträge über die Vorgänge in Mexiko. Ich glaube aber auch, dass gerade die großen nationalen Probleme eine Kunst von hoher Qualität hervorbringen. Ich erinnere mich immer gern an den Dialog in dem Film „Der Dritte Mann“, wo Orson Welles sagt: „Am Ende haben Frieden und Wohlstand in der Schweiz doch nicht mehr als die Kuckucksuhr hervorgebracht. Dagegen haben Korruption, Kriege und Intrigen in Italien die Renaissance bewirkt.“ Insofern bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Renaissance-Künstler zu werden.
Schumann: Die Probleme liegen ja sozusagen auf der Straße. Die Künstler müssen sie nur aufgreifen.
Villoro: Probleme haben wir jedenfalls genug, um daraus etwas Bedeutendes zu schaffen. Das heißt jedoch nicht, dass wir Feinschmecker der Gewalt werden und uns mit dem gegenwärtigen Mexiko abfinden. Trotz der zahllosen Schwierigkeiten ist unsere Kultur nicht gefährdet. Alle großen kulturellen Werke entstehen aus einer malträtierten Wirklichkeit und der Idee von einer anderen Bestimmung. Für Mexiko sehe ich nur eine Zukunft, die aus der Reflexion und der Kultur hervorgeht.
Juan Villoro, auch Sie will ich zunächst fragen: Was halten Sie von den vorgesehenen Feierlichkeiten zu 200 Jahren Unabhängigkeit und 100 Jahren Revolution in Mexiko?
Villoro: Die Situation ist kompliziert, denn die Feierlichkeiten muss eine konservative Regierung ausrichten, die weder an Unabhängigkeit noch an Revolution glaubt. Die Regierungspartei PAN war schon immer sehr auf Spanien fixiert. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen wurde beispielsweise Felipe Calderón vom konservativen spanischen Ex-Präsidenten Aznar unterstützt. Und die Kategorie Revolution liegt einer konservativen Partei sowieso sehr fern ... Das kommt mir so vor, wie wenn die Eskimos die Tropen feiern wollten.
Schumann: Was für besondere Maßnahmen hat denn die Regierung bisher unternommen, um diese beiden historischen Ereignisse ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen?
Villoro: Die mexikanischen Autobahnen wurden in ‚Autobahnen des Bicentenario‘ umgetauft. Brücken erhielten die Bezeichnung ‚Bicentenario‘. Das Fest wurde zur Marke. Am Tag der Unabhängigkeit, dem 16. September, wird es ein Fest auf dem Zócalo, dem größten Platz in Mexiko-Stadt geben. Es soll 60 Millionen Dollar kosten und wird von dem Künstler gestaltet, der für die Eröffnungsshow der Olympischen Spiele in Sydney zuständig war. Es wird sicher von hoher technischer Qualität sein, aber so etwas halte ich nicht für die beste Form, Geschichte zu würdigen. Hier wird die große Chance verpasst, über die wirkliche Geschichte Mexikos nachzudenken. Es gibt so vieles, über das nicht gesprochen wurde.
Schumann: Dann wollen wir damit beginnen. Wie weit ist Mexiko heute unabhängig?
Villoro: Wir sind heute von Spanien sicher nicht mehr politisch abhängig. Aber die Mehrheit der Mexikaner besäße am liebsten eine Kreditkarte von einer spanischen Bank. In der wichtigsten lateinamerikanischen Fußballliga ging es früher um den Befreier-Pokal, weil damit an die Vorkämpfer der Unabhängigkeit erinnert werden sollte. Dann wurde er in Santander-Befreier umbenannt, weil er von der spanischen Bank Santander gesponsert wird ... Gas Natural gehört zu einem spanischen Energie-Konzern, das Strom-Unternehmen Endesa ist spanisch genauso wie Telefónica. Eigentlich müsste Spanien diese Unabhängigkeit mehr feiern als wir.
Schumann: Gilt das auch für die Kultur? Beeinflusst Spanien noch immer die mexikanische Kulturlandschaft?
Sprecher:
Die drei größten Verlage, die in Mexiko tätig sind, gehören zu spanischen Konzernen. Die größte Zeitung ist in spanischen Händen. Das mexikanische Radio wird zum Teil von Spaniern kontrolliert. Unsere kulturelle Unabhängigkeit ist also sehr relativ.
Schumann: Ist das Erbe der Mexikanischen Revolution noch existent? Was ist davon übrig geblieben?
Villoro: Dazu muss ich sagen, dass ihre wichtigsten Ziele nie völlig verwirklicht wurden. Der österreichische Historiker Friedrich Katz schrieb in seinem Buch „Der geheime Krieg in Mexico“: Die Mexikanische Revolution ist die einzige der Welt, die sich ihre ideologische Gültigkeit bewahrt hat. Das kann man daran sehen, dass sehr unterschiedliche politische Kräfte ihr Erbe für sich in Anspruch nehmen: zum Beispiel die PRD, die Partei der demokratischen Revolution, die unsere Linke vertritt; aber auch die PRI, die Institutionelle Partei der Revolution, die jahrzehntelang regiert hat; genauso wie die eher virtuelle als reale Guerrilla der Zapatista mit Subcomandante Marcos an der Spitze. Außer der PAN kann fast jede politische Richtung mit der Revolution etwas anfangen, was wohl damit zusammenhängt, dass die großen Ziele der Revolution unvollendet blieben: die soziale Gerechtigkeit und die Demokratie. Unsere Demokratie ist gerade erst im Entstehen, und den heutigen Zustand unseres Landes hat bereits im 19. Jahrhundert Alexander von Humboldt beschrieben: das Land der Ungerechtigkeit.
Schumann: Mexiko ist jedoch nicht nur von Spanien abhängig. Ist es heute nicht viel stärker an die USA gebunden, an den nördlichen Nachbarn geradezu angekettet?
Villoro: Natürlich sind wir vor allem von den Vereinigten Staaten abhängig. Nahezu 20 Millionen Mexikaner arbeiten dort, das zeigt, wie sehr unsere Wirtschaft von ihnen abhängt. Zehn Prozent des Bruttosozialprodukts stammen von den Überweisungen der Mexikaner in den USA. Eine sehr ernste Form von Abhängigkeit.
Schumann: Ich habe Mexiko in den 70er-Jahren kennengelernt und als ein sehr monolithisches Land empfunden, mit einer einzigartigen indigenen Kulturtradition. Hat sie verhindert, dass Mexiko als Brücke dienen konnte zwischen der angelsächsischen und der lateinamerikanischen Welt?
Villoro: Ich glaube, dass es in Mexiko den Komplex des kleineren Bruders gab. Anstatt sich verschiedenen Ländern zuzuwenden, hat Mexiko die Unterstützung eines größeren Bruders gesucht. Anfangs war es Spanien, später waren es die USA. In vielen lateinamerikanischen Konferenzen hat Mexiko eher für die Ziele der Vereinigten Staaten Position bezogen, denn es glaubte, dadurch eine privilegierte Beziehung zu den USA zu erhalten ... Es gibt übrigens eine sympathische, kolumbianische Telenovela, die das zum Ausdruck bringt: Kaffee mit dem Aroma einer Frau. Dort wurde ständig über den internationalen Kaffee-Handel diskutiert. Wann immer eine Szene an der Kaffee-Börse in London spielte: Das erste lateinamerikanische Land, das die anderen verriet und sich mit den Mächtigen verbündete, war Mexiko.
Schumann: Ich möchte noch einmal auf diesen monolithischen Charakter Mexikos zurückkommen. Wo hat er sich Ihrer Meinung nach am stärksten gezeigt?
Villoro: Wir haben drei monolithischen Gesellschaften gehabt: die aztekische Kultur, die ein sehr strenges, monolithisches Imperium war; dann die Kolonie, die drei Jahrhunderte lang ein Gesellschaftssystem pflegte, das auf Spanien ausgerichtet war; und schließlich die PRI, die 70 Jahre lang an der Macht war, eine weitere Herrschafts-Pyramide. Mexiko war kaum an Alternativen interessiert. Es war aber andererseits auch ein Asylland für viele Lateinamerikaner. Meine Generation konnte sich an Professoren orientieren, die aus Guatemala, Chile, Peru, Argentinien, Brasilien kamen ... Wir wurden eher durch Zufall von diesen Menschen bereichert, die bei uns Zuflucht suchten. Deshalb wurde die mexikanische Gesellschaft immer kosmopolitischer in den 70er-Jahren. Aber es gab kein nach außen orientiertes Projekt.
Schumann: Dennoch haben die Mexikaner durch die massenhafte Emigration in die USA die Kultur des nördlichen Nachbarn sehr stark beeinflusst. Man könnte fast sagen: Sie haben sie unterwandert. Denn die dort ansässig gewordenen Mexikaner, die sogenannten Chicanos, haben eine eigene Kultur entwickelt. Gehört sie noch zur mexikanischen Identität?
Villoro: Sie ist ein sehr fruchtbares Element und hat das Leben in den USA hat nachhaltig verändert. In der Alltagskultur lässt sich das am besten studieren. Der in Kalifornien am meisten verwendete Vorname ist José. Die Guacamole, die Avocado-Kreme, macht längst den Pommes frites den Rang streitig ... Viele Kinder werden von mexikanischen Hausmädchen aufgezogen und haben dabei spanisch gelernt. Ich habe vor einigen Jahren an der Yale-Universität einen Kursus über mexikanische Literatur gegeben, und ich war erstaunt, dass kaum einer meiner Studenten von den Geisteswissenschaften kam. Die jungen Leute wollten die kulturelle Realität besser kennenlernen, auf die sie im Alltag ständig stießen: die mexikanischen Wertvorstellungen, die Bedeutung von Symbolen, die Mythologien und den Aberglauben.
Schumann: Ich habe die Chicano-Kultur immer als eine seltsam hybride Mischform empfunden.
Villoro: Es ist eine Art dritter Kultur in der Mitte zwischen der mexikanischen und der nordamerikanischen, diese Chicano- oder Tex-Mex-Kultur. Sie besitzt aber durchaus eigene Werte. In der Chicano-Kultur wird nicht der Tag der Unabhängigkeit, der 16. September, gefeiert, sondern der Tag der Schlacht von Puebla, der 5. Mai, als die Franzosen geschlagen wurden, die den Kaiser verteidigen wollten. Es ist ein anti-imperiales Fest. Die Chicanos haben auch die Jungfrau von Guadalupe, die Schutzheilige Mexikos, neu entdeckt. Sie ist bei uns zwar ein sehr geachtetes, aber auch sehr konventionelles Sinnbild. Die Chicanos sehen in ihr wieder das Symbol des Kampfes genauso wie Pater Hidalgo, der 1810 in die erste Schlacht um die Unabhängigkeit zog, mit der Jungfrau auf seiner Fahne.
Schumann: Seit wann kann man denn überhaupt von einer mexikanischen Kultur sprechen?
Villoro: Ich glaube, sie hat nach der Eroberung begonnen als diese Mischung aus spanischen und indigenen Elementen, die es auch heute noch gibt. Sie ist also von ihrem Ursprung her multikulturell. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Azteken nicht das einzige indigene Volk waren und dass nicht alle indigenen Völker die gleichen Werte und die gleichen gesellschaftlichen Vorstellungen besitzen ... In Mexiko gibt es 62 unterschiedliche indigene Kulturen, die teilweise recht gegensätzlich sind.
Schumann: Ist die mexikanische Kultur nicht aus einem Kulturschock entstanden: aus dem Zusammenprall der indigenen und der spanischen Kultur?
Villoro: Ja, und dieser Kulturschock ist teilweise noch immer ein Trauma. Die Grabstätte des spanischen Eroberers Hernán Cortés hat keinen Namen, und in Mexiko-Stadt gibt es noch nicht mal ein Denkmal von ihm. In Lima wurde dagegen eine Statue von Pizarro errichtet, der Peru erobert hat. Die Figur von Cortés angemessen zu würdigen, bedeutet ja nicht, die Eroberung zu rechtfertigen und alles, was sich damit an Raub und Blut verbindet. Aber Cortés ist ein Teil von uns. Wir sprechen ja heute auch noch meist spanisch in Mexiko. Wir müssen endlich die Vielfalt unseres Wesens anerkennen und uns von solchen Komplexen freimachen. Darauf hat uns unser großer Künstler José Clemente Orozco bereits vor Jahrzehnten auf seinen berühmten Wandbildern hingewiesen. Er teilte nicht die weitverbreitete Meinung, dass die Eroberung ein reiner Akt der Niedertracht war. Bei ihm küsst ein Eroberer eine Indigena. José Clemente Orozco wollte damit zum Ausdruck bringen: Wer diesen Kuss nicht akzeptiert, akzeptiert nicht unser mestizisches Wesen.
Schumann: Andere lateinamerikanische Länder sind durch Einwanderer aus Europa oder auch aus Asien stark verändert worden. Was für andere ausländische Einflüsse haben die kulturelle Identität Mexikos geprägt?
Villoro: Die Vermischung unserer Kulturen und Rassen beruht auf verschiedenartigen Gemeinschaften, die sich mit der Zeit in unser Leben integriert haben: die jüdische Gemeinde beispielsweise. Sie ist nicht so groß wie in Frankreich oder Argentinien, sie hat aber die Unternehmenskultur, die Medizin und das kulturelle Leben vielfach geprägt. Oder die libanesische Gemeinde, die heute etwa 10 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes hervorbringt. Der reichste Mann Mexikos und der Welt, Carlos Slim, ist Libanese. Wir Mexikaner von heute stammen aus diesem Schmelztiegel, in dem der reichste von uns ein Libanese ist.
Schumann: Mexiko besitzt also eine starke kulturelle Basis, auf der sich die Vielfalt der heutigen mexikanischen Kultur entwickelt hat. Wo drückt sie sich besonders aus? Vielleicht in der mexikanischen Kunst?
Villoro: Es gibt sicher eine Kunst, die als typisch mexikanisch gilt, die mit Farben arbeitet, die für besonders mexikanisch gehalten werden: rot oder rosa. Oder Künstler wie Rufino Tamayo und Francisco Toledo oder die mexikanische Wandmalerei. Doch ich glaube, dass sich das spezifisch Mexikanische eher auf eine subtile Weise ausdrückt. Trotzdem gibt es unverkennbare Merkmale ... In der Literatur war beispielsweise die Figur des Kaziken sehr wichtig, nicht nur der feudale Typ, der über große Ländereien herrscht wie Pedro Páramo, die Hauptfigur des Meisterwerks von Juan Rulfo, auch der autoritäre Familienvater oder der Politiker der PRI, der Kapo eines Drogenkartells oder ein Kriminalbeamter, der niemand Rechenschaft leistet.
Schumann: Sind das die Hauptdarsteller der immer wieder zitierten Kultur der Straflosigkeit? Und was versteht man darunter?
Villoro: Die Kultur der Straflosigkeit ist leider für das heutige Mexiko ganz typisch, ... denn manche Kreise finden es seit Langem sehr attraktiv, in einem Freiraum der Straflosigkeit zu agieren. Andy Warhol hat einmal über die Kultur des Ruhms in den USA gesagt: „In der Zukunft wird jedermann 15 Minuten lang berühmt sein können.“ Auf Mexiko übertragen, hieße das: Jeder kann künftig 15 Minuten lang straflos sein. Es ist auch nicht zufällig, dass die mexikanische Politik gern Begriffe wie ‚Schatten‘ und ‚Dunkelheit‘ benutzt. Politik nennt man ‚die Finstere‘, etwas, das im ‚Dunkeln‘ geschieht ... Macht wird oft ‚hinter den Kulissen‘ ausgeübt, das heißt im ‚Schatten‘. Einer unserer berühmtesten Romane heißt: „Der Schatten des Caudillo“ von Martín Luís Guzmán ... Unser bekanntestes Theaterstück hat den Titel „Der Grimassenschneider“ von Rodolfo Usigli. Der Titel signalisiert: Der mexikanische Politiker verbirgt sich hinter Masken, er täuscht, stellt sich keiner Rechenschaft, herrscht über die anderen.
Schumann: Herr Villoro, Sie haben eindrucksvoll beschrieben, dass die mexikanische Kultur tief verwurzelt ist. Aber ist diese Mexicanidad, diese kulturelle Identität, heute in Zeiten der Globalisierung und der Internationalisierung von Kultur nicht bedroht?
Villoro: Es gibt Länder wie China, Indien oder Mexiko, die Jahrtausende alte Kulturen haben. Sie sind ein großer Schutz, weil sie Jahrhunderte lang der geistige Horizont geblieben sind. Sie können aber auch wie eine Grabplatte wirken, die einen niederdrückt. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass die mexikanische Kultur offen bleiben muss für Neubewertungen.
Schumann: Gilt das auch für die umstrittene Gestalt der Malinche, der indianischen Frau des spanischen Eroberers Cortés?
Villoro: Sie ist von zentraler Bedeutung ... Wenn heute allerdings jemand als malinchista bezeichnet wird, dann gilt er als Verräter der Seinen. Tatsächlich war Malinche eine Frau, die versklavt wurde ... , sich aber aus eigenen Kräften einen ungewöhnlich hohen Grad an Kultur angeeignet hat. Sie wurde die erste Übersetzerin Mexikos, denn sie beherrschte die Sprachen der Azteken wie der Mayas und konnte sie ins Spanische übersetzen und so die Verständigung ermöglichen. Sie ist wahrscheinlich auch die Mutter des ersten mexikanischen Mestizen. Deshalb ist es sehr wichtig, diese Figur in ihrer wirklichen Bedeutung wiederzuentdecken: als Essenz unseres Seins und eines Volkes, das verurteilt war und sich kraft der Kultur zu befreien und den Anderen zu verstehen lernte. Die Malinche durchlief einen anthropologischen Prozess: Sie wurde zunächst von ihrer Familie anderen Indigenas ausgeliefert, kam dann zu den Spaniern und versuchte dort das Wesen der Unbekannten zu begreifen ... Es gibt viele offene Fragen, die bei den Feierlichkeiten des Bicentenario behandelt werden könnten.
Schumann: Zur mexikanischen Kultur gehören nicht nur solche faszinierenden Gestalten der Geschichte. Dazu zählt heute auch ein eher deprimierendes Kapitel, dem man die Bezeichnung Narco-Kultur verpasst hat. Was umfasst dieser Begriff?
Villoro: Seit mehr als 100 Jahren gibt es Schmuggel und Drogenhandel in Mexiko. Und seit etwa 40 Jahren operiert das organisierte Verbrechen mit zunehmender Macht, sodass sich so etwas wie eine Subkultur gebildet hat, eine parallele Normalität des Lebens. Heute kann man in bestimmten Gebieten Mexicos ein Leben führen, das völlig mit dem Drogenhandel verbunden ist. Es gibt Schulen und Kirchen, die von der Mafia kontrolliert werden ..., sowie Festsäle, Sportclubs und Krankenhäuser. Man kann dort geboren werden, aufwachsen, zur Schule gehen, heiraten, Sport treiben und befindet sich dabei in einem völlig von der Mafia kontrollierten Kreislauf. Das ist für mich die parallele Normalität. Alle Verwandten und Bekannten arbeiten vielleicht in der Landwirtschaft, aber tatsächlich für den Drogenhandel.
Schumann: Wird diese ‚parallele Normalität‘, dieses Falschspiel, allgemein toleriert?
Villoro: Die Leute wissen genau, wer die Drogenhändler sind. Ich habe verschiedene Orte im Bundesstaat Sinaloa besucht, und man hat mir ihre Häuser gezeigt. Es gibt sogar Führungen dorthin, ähnlich wie die zu den Prominenten in Hollywood. Man weiß genau, wo sie sind, wie sie leben, was sie essen, wie sie sich kleiden. Aber sie werden nicht verhaftet, weil das organisierte Verbrechen seit 40 Jahren auch die meisten Behörden unterwandert hat.
Schumann: Wir haben in unserem letzten Gespräch mit Carmen Aristegui ausführlich über die ständig steigende Zahl der Morde und die fatale Politik der Regierung gesprochen. Wenn das organisierte Verbrechen quasi das gesamte Leben einer Gemeinde bestimmt, wie weit reicht dann sein Einfluss auf die Kultur?
Villoro: Es gibt die sogenannten Narcocorridos, die das Verhalten der Narcos beschreiben. Die Mehrzahl dieser Lieder wird von ihnen bezahlt: Sie sollen ihr Leben verherrlichen. Radiosender strahlen sie aus. Auf CDs zirkulieren sie. Es gibt sogar öffentliche Konzerte: eine parallele Normalität. Kürzlich hat der Vorsitzende der Wahlkommission gesagt: Wenn heute Wahlen stattfänden, dann wäre es möglich, dass in 15 Prozent unseres Staatsgebietes keine Wahllokale eingerichtet werden können, weil es keine ausreichende Sicherheit gibt. Es geht also hier also nicht nur um eine Subkultur, um den Anschein von Normalität, sondern um den realen Verlust von staatlicher Souveränität, der – nach dieser Berechnung – in 15 Prozent unserer Regionen herrschen soll.
Schumann: Bedeutet dieser Verlust staatlicher Kontrolle nicht auch einen Verlust gesellschaftlicher Werte?
Villoro: Natürlich hat der Drogenhandel auch das Wertesystem deformiert. Die Regierung will das aber nicht begreifen. Die Anthropologin Rosana Rojillo hat in einer Untersuchung nachgewiesen, dass die Killer der Drogenmafia sich ganz ähnlich verhalten wie die Teilnehmer an einem heiligen Krieg. Die Allgemeinheit glaubt, wenn einer von denen getötet wird, dann ist das ein Schritt zur Lösung des Problems. Aber tatsächlich gehört der Tod zum Lebensbild der Mafiosi. Er stellt für sie keine Barriere dar, sondern eher einen Antrieb. Die Killer wissen, dass sie in ihrem kurzen Leben jede Art von Horror erfahren werden. Deshalb möchten sie etwas hinterlassen, zum Beispiel ein Häuschen für ihre Mutter. Fast die gesamte Drogenmafia ist katholisch ... Wir erleben also einen Krieg unter radikalen Katholiken auf beiden Seiten: die Regierung der PAN, die katholisch ist, gegen die Narcos, die auch katholisch sind oder es jedenfalls behaupten.
Schumann: Es gibt inzwischen eine Fülle von Literatur, deren Autoren sich in analytischer, dokumentarischer oder fiktionaler Form mit der Gewalt der Mafia, aber auch mit dem staatlichen Terror durch den Einsatz des Militärs auseinandersetzen. Darin werden besonders brutale Praktiken dargestellt wie zum Beispiel die Enthauptung der Opfer. Wieso greifen diese Killer zu solchen Methoden?
Villoro: Das organisierte Verbrechen begeht ‚Urheber-Morde‘, das heißt ein Kartell identifiziert sich durch die Art der ausgeübten Gewalt. Es gibt eine Grammatik des Terrors, die leider den Kampf gegen diese Grammatik übertrifft. Ich habe den Eindruck, dass die Narcos in den letzten Jahren zweimal zugeschlagen haben: zum einen durch ihre Taten und dann durch die Resonanz, die das Fernsehen und die Medien ihnen verschafft haben ... Diese überzogene Darstellung der Gewalt könnte zu zwei extremen und gleicherweise negativen Reaktionen führen: der Banalisierung durch Gewöhnung an die Gewalt. Es gibt bereits Geschichten von Kindern, die in Ciudad Juárez, die als gewaltreichste Stadt der Welt gilt, mit Leichen spielen. Das andere Extrem wäre die Paranoia: Wir gehen nicht mehr auf die Straße aus Angst vor der in den Medien geschilderten Gewalt.
Schumann: Verlangen Sie eine Zensur der Bilder, die die Medien verbreiten?
Villoro: Es wundert mich, dass es bis heute keine Diskussion und keinen Konsens oder eine nationale Konferenz darüber gibt ... , wie man mit der Gewalt umgehen, wie weit man sie darstellen oder ob man überhaupt darauf verzichten sollte. Denn die Art ihrer Darstellung kann das organisierte Verbrechen schwächen oder stärken. Auf dieses Problem kann man auch nur in konzertierter Form antworten, denn wenn eine Zeitung solche Bilder nicht mehr veröffentlicht, die andere aber doch, dann ist die Zeitung im Nachteil, die diese Information nicht bietet ... Natürlich will ich keine Zensur, aber einen verantwortungsvollen Umgang mit der Gewalt.
Schumann: Dazu würde auch die Frage gehören: Gibt es unter der Fülle von Büchern eine Literatur – ähnlich wie in dem anderen Drogenland Kolumbien –, die spekulativ mit dem Thema umgeht?
Villoro: Glücklicherweise gab es bis jetzt keine unverantwortliche oder oberflächliche Darstellung der Drogenmafia. Die Lage ist auch zu ernst. Reporter ohne Grenzen zählt Mexiko – neben dem Irak – zu den für Journalisten gefährlichsten Ländern der Welt: Wenigstens einer von ihnen stirbt jeden Monat, sie arbeiten also mit hohem Risiko. Ich glaube, dass sich deshalb auch unter den Schriftstellern die Überzeugung verbreitet hat, dieses Thema sehr ernst zu nehmen.
Schumann: Auch in Filmen wird das organisierte Verbrechen dargestellt. Jüngst erschien sogar eine DVD über die Drogenkartelle. Gibt es auch Beispiele in der bildenden Kunst?
Villoro: Auf der letzten Biennale in Venedig hat Teresa Margolles beispielsweise eine Installation zeigt mit dem Titel: Wovon sollen wir denn sonst sprechen? In einem alten, völlig leeren Palast ließ sie täglich den Fußboden mit dem Blut von Opfern der Drogenkartelle aufwischen. Sie inszenierte in die Leere hinein eine rhetorische Frage und zugleich den Schrecken ... Eine andere Künstlerin, Rosa María Robles, schuf die Installation „Der rote Teppich“. Sie beschaffte sich in einem Gericht Leinentücher, in denen Opfer eingewickelt waren. Es gehört zu dieser ‚Grammatik des Terrors‘, dass eines der Kartelle seine Leichen verpackt ... Diese blutigen Hüllen legte sie in einer Galerie wie einen roten Teppich aus. Doch anders als jener für Feierlichkeiten war dieser rot von Blut. Als das bekannt wurde, mussten diese ‚Beweisstücke‘ entfernt werden. Also machte Rosa María Robles etwas sehr Bemerkenswertes: sie kaufte neue Leinentücher und tränkte sie mit ihrem eigenen Blut.
Schumann: Und machte so den Schrecken fassbar.
Villoro: Das ist eine wichtige symbolische Aussage. Lange glaubten wir, dass das organisierte Verbrechen und die Drogenmafia weit weg von uns operierten. Und dass die Narcos sich nur untereinander umbrachten. Natürlich waren diese Meinungen eine defensive Reaktion um die Tragödie zu mildern. Aber inzwischen mussten wir erleben, wie mitten in der Stadt Michoacán Granaten in einer wehrlosen Menschenmenge explodierten; wie in Monterrey alle Ausfallstraßen vom organisierten Verbrechen gesperrt wurden; und wie in Ciudad Juárez eine Gruppe von Jugendlichen bei einem Fest umgebracht wurde. Das Blut kann heute von jedem von uns stammen.
Schumann: Ist die mexikanische Kultur stark genug, um dem System der täglichen Gewalt und dem ständigen Werteverlust Widerstand zu leisten?
Villoro: Die mexikanische Kultur ist unser wichtigster Aktivposten. Sie ist sehr stark und vital, die populäre Musik ebenso wie der Film, die Poesie genauso wie der Roman und das Theater. Es gibt überall sehr interessante Beiträge über die Vorgänge in Mexiko. Ich glaube aber auch, dass gerade die großen nationalen Probleme eine Kunst von hoher Qualität hervorbringen. Ich erinnere mich immer gern an den Dialog in dem Film „Der Dritte Mann“, wo Orson Welles sagt: „Am Ende haben Frieden und Wohlstand in der Schweiz doch nicht mehr als die Kuckucksuhr hervorgebracht. Dagegen haben Korruption, Kriege und Intrigen in Italien die Renaissance bewirkt.“ Insofern bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Renaissance-Künstler zu werden.
Schumann: Die Probleme liegen ja sozusagen auf der Straße. Die Künstler müssen sie nur aufgreifen.
Villoro: Probleme haben wir jedenfalls genug, um daraus etwas Bedeutendes zu schaffen. Das heißt jedoch nicht, dass wir Feinschmecker der Gewalt werden und uns mit dem gegenwärtigen Mexiko abfinden. Trotz der zahllosen Schwierigkeiten ist unsere Kultur nicht gefährdet. Alle großen kulturellen Werke entstehen aus einer malträtierten Wirklichkeit und der Idee von einer anderen Bestimmung. Für Mexiko sehe ich nur eine Zukunft, die aus der Reflexion und der Kultur hervorgeht.