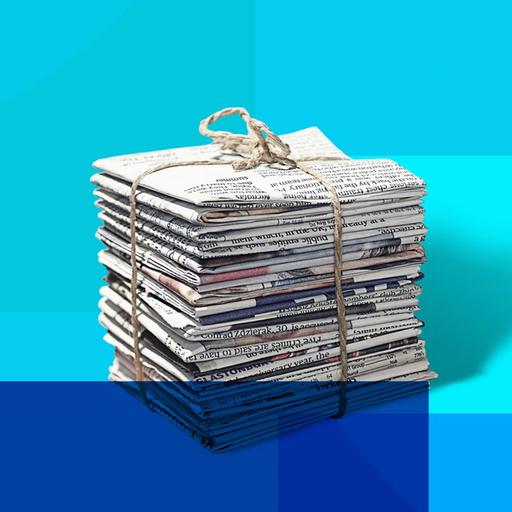HAARETZ aus Tel Aviv schreibt zum ersten Thema: "Ganz gleich, wie sorgfältig eine israelische Militäroperation gegen die Hamas in Rafah auch geplant sein mag: weil in der Gegend mehr als eine Million palästinensische Flüchtlinge ausharren, musste es früher oder später zu einem Vorfall mit vielen Toten kommen. Und so geschah das Unvermeidliche am Sonntagabend. Bei einem Luftangriff des israelischen Militärs wurden große Zerstörungen angerichtet und mindestens 45 Menschen getötet. Aufnahmen zeigen, dass Zivilisten, die in Zelten lebten, in einem Inferno gefangen waren", schreibt HAARETZ aus Israel.
DER STANDARD aus Wien ist schockiert. "Wo jetzt Asche dampft, lebten einmal Menschen. Es sind Familien, die schon mehrmals aus ihren Häusern vertrieben worden sind. Immer sagte man ihnen: Geht woanders hin, hier seid ihr nicht mehr sicher. Die Bilder, die aus Rafah dringen, müssen jeden Menschen erschüttern, der nach acht Monaten Gazakrieg noch nicht restlos dem Zynismus verfallen ist."
EL MUNDO aus Madrid ist ebenfalls bestürzt. "Die Bilder der verkohlten Leichen von Zivilisten, die bei dem Brand im Vertriebenenlager ums Leben kamen, lösten allgemeine Empörung und Verurteilung aus. Solche dramatischen Ereignisse liefern auch in Washington all jenen Argumente, die fordern, dass Ministerpräsident Netanjahu ein Ende des Krieges gegen die Hamas aufgezwungen werden müsse - ob mit oder ohne Abkommen". Sie hörten die spanische Zeitung EL MUNDO.
"Die Bombardierung zeigt einmal mehr, dass die israelische Armee die Vorgaben eines humanitären Vorgehens ignoriert", kritisiert die arabischsprachige Zeitung AL QUDS Al-ARABY aus London. "Der Vorfall zeigt zudem, dass der Krieg aus einer Reihe katastrophaler Misserfolge besteht. Wie will Israel die Welt davon überzeugen, dass das angebliche Ziel, zwei Hamas-Führer ins Visier zu nehmen, die Bombardierung von Flüchtlingszelten legitimiert?"
Im IRISH INDEPENDENT heißt es: "Der Angriff in Rafah ist nur das jüngste abschreckende Beispiel für die schrecklichen Folgen eines unkontrollierten Militarismus. Für die verängstigten Menschenmassen, die nach Rafah geflohen waren, gab es weder Schutz noch Zuflucht. Insofern waren die vielen Todesfälle im Falle eines Raketenangriffs unvermeidlich. Israel hat ein Recht, gegen die Hamas vorzugehen - aber nicht um jeden Preis", kommentiert der IRISH INDEPENDENT aus Dublin.
THE HINDU aus Chennai geht auf einen anderen Aspekt ein. "Die Entscheidung Norwegens, Irlands und Spaniens, den Staat Palästina anzuerkennen, ist ein Beleg dafür, wie sich auch im Westen das Denken ändert. Indem Ministerpräsident Netanjahu versucht, die gesamte palästinensische Bevölkerung in Gaza für die Taten der Hamas zu bestrafen, schwächt er Israels Ansehen - und stärkt zugleich die internationale Unterstützung für die palästinensische Sache", zeigt sich THE HINDU aus Indien überzeugt.
Die norwegische Zeitung AFTENPOSTEN aus Oslo greift den Gedanken auf. "Mit dem heutigen Tag ist die Anerkennung von Palästina als Staat durch Norwegen vollendete Tatsache. 143 Länder sind diesen Schritt bereits gegangen. Von einem mutigen Pioniereinsatz kann also keine Rede sein. Es handelt sich um eine politische Rückendeckung für das schwer geprüfte palästinensische Volk – aber leider auch nicht mehr."
Und EL ESPECTADOR aus Bogotá in Kolumbien fügt hinzu: "Der einzige friedliche Ausweg für den Nahost-Konflikt ist eine Zwei-Staaten-Lösung mit entsprechenden Sicherheitsgarantien. Extreme Positionen, die der jeweils anderen Seite das Existenzrecht absprechen, führen dagegen nur zu noch mehr Tod und Zerstörung."
Die KLEINE ZEITUNG aus Graz geht auf den Staatsbesuch des französischen Präsidenten Macron in Deutschland ein. "Während Olaf Scholz in den Fängen der deutschen Ampel feststeckt, sieht Emmanuel Macron sein Heil im regelmäßigen Zünden von Politbomben. Weit auseinander liegen die beiden Länder in der Frage, wie Europas Antwort auf die wirtschaftliche Dominanz der USA und Chinas sein sollte. Gerade in dieser Phase braucht man Stabilität und Konsensfähigkeit. Im Augenblick aber scheint es gerade daran zu mangeln. Macron gibt Gas, Scholz bremst. Der Motor stottert, es ist Sand im Getriebe. Ein Fall für die Werkstatt", stellt die KLEINE ZEITUNG aus Österreich fest.
Auch die RZECZPOSPOLITA aus Warschau sieht Differenzen. "Während die Bundesregierung sich an der Schuldenbremse festklammert, ist Macrons Versprechen, die französischen Staatsfinanzen zu sanieren, längst vergessen. Frankreich ist der Meinung, dass die EU im Krieg in der Ukraine ein unabhängiges Spiel spielen sollte, während Scholz sich eng mit dem Weißen Haus abstimmt. Beide Hauptstädte haben unterschiedliche Ansätze für die Zusammenarbeit mit China oder die Zukunft der Kernenergie. Während der Bundeskanzler die Liberalisierung der Kapitalströme in der EU als Schlüssel für Wirtschaftswachstum ansieht, setzt Paris lieber auf Protektionismus in der Gemeinschaft", erläutert die polnische RZECZPOSPOLITA.
Die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG verweist darauf, dass Macron auch Dresden besucht hat. "Die anwesenden Dresdner und deutschen Politiker bedachten Macron während seines Vortrages und danach mit viel Applaus, obwohl er wenig Neues sagte. Die Rede dürfte vor allem als Versuch in Erinnerung bleiben, auch in Ostdeutschland eine emotionalere Verbindung zwischen Deutschen und Franzosen zu schaffen. Bislang ist die deutsch-französische Partnerschaft vor allem eine Sache zwischen Westdeutschen und Franzosen."
In Seoul hat das erste Spitzentreffen zwischen Südkorea, China und Japan seit fünf Jahren stattgefunden. ASAHI SHIMBUN aus Tokio ist angetan. "Die Zusammenkunft ist in der angespannten Lage in Ostasien von großer Bedeutung. Wirft man den Blick auf die übrige Welt, wird wegen der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen die Spaltung der internationalen Gemeinschaft immer tiefer. Aktuell sind Japan, China und Südkorea Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates. Wenn sie sich gemeinsam einsetzen, um die UNO wieder funktionsfähig zu machen, könnten sie einen Beitrag für eine Konfliktlösung leisten", vermutet ASAHI SHIMBUN aus Japan.
HUANQIU SHIBAO aus Peking sieht Fortschritte nach dem Dreiergipfel in Seoul. "Man hat erkannt, dass es für einen Neustart der Kooperation auch gemeinsamer Zukunftsvisionen bedarf. So wurden die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen wieder aufgenommen. Die USA müssen erkennen, dass ihre beiden Verbündeten auch eigene Interessen zu wahren haben: Tokio und Seoul können es sich nicht leisten, sich vollständig von China zu lösen - selbst wenn sich die Rivalität zwischen Washington und Peking weiter zuspitzen sollte", betont die staatliche chinesische Zeitung HUANQIU SHIBAO.
LIANHE ZAOBAO aus Singapur ist zurückhaltender. "Japan und Südkorea hätten zwar ein Interesse daran, die Beziehungen zum großen Nachbarn zu entspannen. Die ideologische Kehrtwende von Chinas Präsident Xi Jinping hin zu nationaler Sicherheit und einer aggressiven Diplomatie dient aber nicht gerade dazu, Misstrauen abzubauen. Hinzu kommt, dass der neue südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol fest an der Seite der USA steht. Die militärischen Drohgebärden gegenüber Taiwan tun ihr Übriges dazu, dass immer mehr Menschen in Japan und Südkorea Angst vor China haben", glaubt LIANHE ZAOBAO aus Singapur.