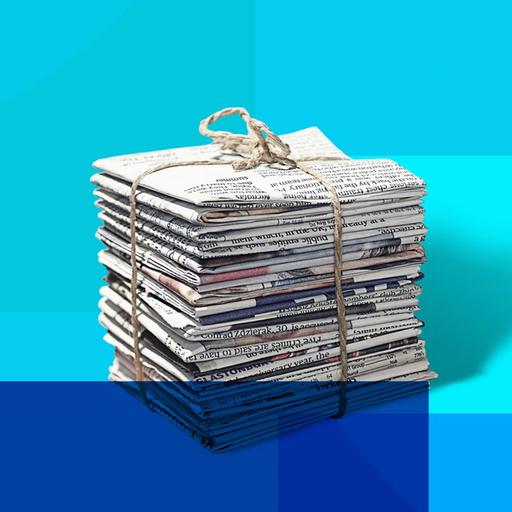"Das Publikum bekam anderthalb Stunden Geplänkel zweier mittelalter Männer serviert. Keiner von beiden vermochte die deutschen Wähler zu begeistern. Allerdings liegt die SPD in Umfragen deutlich hinter der Union, und Scholz‘ Chancen schrumpfen, den aktuellen Trend doch noch umzukehren. Was hat er eigentlich zu bieten? Schenkt man ihm Glauben, geht es Deutschland eigentlich richtig gut, und was nicht so richtig läuft, liegt an Putin und seinem Überfall auf die Ukraine. Merz verwies dagegen auf die gigantischen Probleme, die durch die Migration verursacht würden. Am interessantesten an dem Duell war eigentlich, was alles nicht gesagt wurde. Die katastrophalen Folgen der Politik von US-Präsident Trump für Deutschland und Europa wurden allenfalls gestreift. Kein Wort über den Klimawandel oder die explosionsartige Ausbreitung der Künstlichen Intelligenz, kein Wort über Bildung, Gesundheit und Soziales", notiert POLITIKEN aus Kopenhagen.
"Beide sahen in dem Duell eine Chance, ihre Position zu verbessern", analysiert DER STANDARD aus Österreich: "Der CDU-Chef wollte Kanzlertauglichkeit und die dazugehörige Besonnenheit unter Beweis stellen. Scholz hatte ein anderes Ziel: zu zeigen, dass er sich trotz der schlechten Umfragewerte noch nicht abschreiben lässt. In der SPD hatten viele auf den Scholz’schen Befreiungsschlag gehofft. Vergeblich – auch wenn sich der Kanzler wacker schlug. Aber eine Klarheit hat es doch gebracht: Obwohl sich SPD und Union im Bundestag heftige Attacken geliefert haben, das Tischtuch zwischen den beiden ist nicht zerschnitten. Bei all der wechselseitigen Ablehnung war es wohltuend, in der politischen Mitte Kompromissbereitschaft zu vernehmen", befindet DER STANDARD aus Wien.
Die russische Zeitung NESAWISSIMAJA GASETA bemerkt: "In der Frage des russisch-ukrainischen Konflikts waren sich Merz und Scholz darin einig, den Widerstand Kiews gegen das Vorgehen Russlands weiter unterstützen zu wollen. Doch während Merz bereit ist, der Ukraine Langstrecken-Marschflugkörper zu liefern, ist Scholz gegen diesen Schritt, weil er ihn für eine Eskalation hält und glaubt, dass er zu einem Zusammenstoß zwischen der NATO und Russland führen werde. Beide halten es für notwendig, dass der Westen Sicherheitsgarantien für die Ukraine entwickle. Sie vermieden es jedoch, im Duell über die Frage der NATO-Mitgliedschaft zu diskutieren", hält die NESAWISSIMAJA GASETA aus Moskau fest.
Die chinesische Zeitung JIEFANG RIBAO blickt auf den internationalen Aktionsgipfel zur Künstlichen Intelligenz, den Frankreich und Indien gemeinsam in Paris ausrichten: "Bei der zweitägigen Veranstaltung liegt der Schwerpunkt auf machbaren Lösungen. Aufgrund der rasanten Entwicklung der KI-Technologie stellt sich immer drängender die Frage, wie sicher künstliche Intelligenz überhaupt ist. Andererseits wird die Zusammenarbeit bei der globalen Steuerung der KI durch geopolitische Faktoren wie den Wettstreit zwischen den Großmächten behindert. Dabei wäre eine Abstimmung bei der Regulierung notwendiger denn je. Dem steht aber die radikale Deregulierung der KI in den USA durch die Trump-Administration im Wege. Der Rest der Welt sollte den Rahmen der Vereinten Nationen nutzen, um hegemoniale Auswüchse bei der Entwicklung und Nutzung von KI zu verhindern", verlangt JIEFANG RIBAO aus Schanghai.
Die französische Zeitung LE FIGARO führt aus: "Die Technologie-Schlacht, die sich die USA und China in diesem Bereich liefern, zeigt, dass die Zukunft der KI für alle Länder der Welt auch ein politisches Thema ist, bei dem es um Souveränität und strategische Autonomie geht. Die EU hat in diesem Wettlauf zahlreiche Trümpfe in der Hand: wertvolle Industriedaten, Talente, Infrastruktur, emissionsarme Energie, einen nunmehr einheitlichen digitalen Markt. Allerdings muss sich Europa schneller und mit mehr Nachdruck finanzielle Mittel verschaffen, um in diesem Rennen mithalten zu können und echte Technologie-Champions heranwachsen zu lassen", unterstreicht LE FIGARO aus Paris.
Nun in die USA. Die türkische Zeitung DÜNYA beobachtet dort ein "innenpolitisches Chaos": "Der vielleicht lauteste Aspekt dieses Chaos ist zweifellos Elon Musk mit seinem berühmtem DOGE-Team, das im Auftrag von US-Präsident Trump den Staat verschlanken soll. Doch schon nach kurzer Zeit nahm die Arbeit des Teams eine sehr interessante Dimension an. Es hat bei den Bundesbehörden tiefgreifende Entscheidungen getroffen, von Entlassungen bis hin zur Schließung von Abteilungen. Musks Stil empört inzwischen nicht nur die Demokraten, sondern auch die Republikaner im Kongress. Und kaum jemand im DOGE-Team hat Regierungserfahrung. Manchmal ist es ein schmaler Grat zwischen großen Erfolgen und großen Fehlern. Musk befindet sich derzeit genau auf dieser Linie und verliert die Balance", schreibt DÜNYA aus Istanbul.
Ein Gastkommentator der LOS ANGELES TIMES sorgt sich um die Demokratie in den USA: "Müsste man einen Weg hin zu einer autoritären Herrschaft zeichnen, dann würde er dem sehr ähneln, was wir in den ersten Wochen der Trump-Regierung gesehen haben. Wenn Demokratien sterben und durch autoritäre Regime ersetzt werden, dann sind die Herrscher eher demokratisch gewählt, statt dass sie durch einen Staatsstreich an die Macht kämen, Und dann festigen sie ihre Autorität und bringen ihre Kritiker zum Schweigen. Die Trump-Administration testet offensichtlich Grenzen aus. Es steht zu befürchten, dass es die autoritären Kräfte im Weißen Haus ermutigt, wie viel sie mit relativ wenig Gegenwehr erreichen konnten. Es bleibt zu hoffen, dass Gerichte auch weiter unrechtmäßige Maßnahmen der Trump-Regierung blockieren und dass sich die Mehrheit der Republikaner im Kongress an die Verfassung hält", ist in der die L.A. TIMES aus den USA zu lesen.
Trump setzt in seiner Wirtschaftspolitik weiter auf Zölle – zuletzt hatte er Abgaben in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA angekündigt. Die spanische Zeitung LA VANGUARDIA meint: "Die Gründe für Trumps Entscheidung dürften vielfältig sein. Sie reichen von einer Reduzierung der Abhängigkeit von anderen Ländern bis zum Schutz der eigenen Industrie und der nationalen Sicherheit. Manches davon mag verständlich erscheinen, aber die Maßnahme trifft auch die eigene Bevölkerung in Form höherer Preise. Die Märkte zeigten sich relativ unbeeindruckt, allerdings macht sich in den Industrieländern Unruhe breit. Handelskriege treffen alle und treiben die Inflation in die Höhe. Es bleibt abzuwarten, was aus den Drohungen und Ankündigungen wird: Sie können für globale Erschütterungen sorgen, oder aber sie werden schrittweise abgeschwächt", vermerkt LA VANGUARDIA aus Barcelona.
Die italienische Zeitung CORRIERE DELLA SERA vermutet: "Trump nutzt seine Zollpolitik, um zu testen, wie weit er bei der Einschüchterung seines Hauptgegners China gehen kann: ein Tauziehen derjenigen, die sich mit Einschüchterung auskennen. Es könnte in einem großen Deal enden, bei dem sich der Rest der Welt an die vereinbarten Einflusssphären anpassen muss: dramatisch für Taiwan, schlecht für Europa. Oder mit einem Bruch zwischen Washington und Peking und einer allmählichen Entkopplung zwischen zwei oder mehr politisch-wirtschaftlichen Lagern", überlegt der CORRIERE DELLA SERA aus Mailand.
THE GUARDIAN aus London ist sich sicher: "Trumps Gerede von amerikanischer Stärke durch Isolation lenkt von seinem unmittelbaren politischen Ziel ab: die Macht von Unternehmen durch Wirtschaftspopulismus zu verschleiern. Dabei verkauft er Zölle als Schutzschild gegen die Globalisierung und behauptet, so die Arbeitnehmer zu schützen, aber in Wirklichkeit geht es darum, die Gewinne der Wall Street zu steigern", heißt es im britischen GUARDIAN, und damit endet die internationale Presseschau.