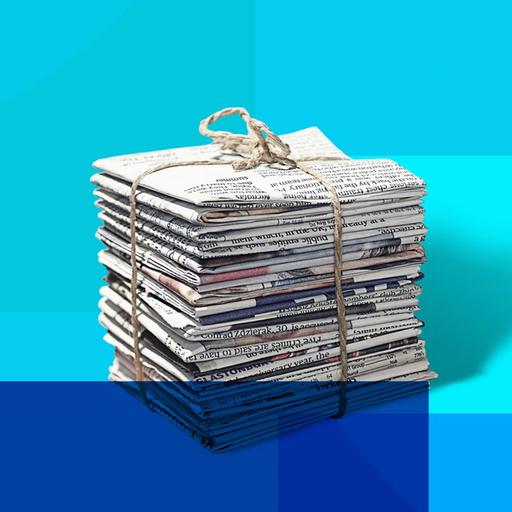US-Präsident Trump hat Sonderzölle auf nicht in den Vereinigten Staaten produzierte Autos angeordnet. Dazu schreibt die japanische Zeitung NIHON KEIZAI SHIMBUN: "Das Thema, das Japan seit Wochen größte Sorgen bereitet, ist nun Realität geworden. Sollten die Zölle von 25 Prozent tatsächlich dauerhaft beibehalten bleiben, dann wird das für Japan eine ernsthaft große Gefahr in Form einer Deindustrialisierung bedeuten. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Regierung in Tokio weiterhin mit Washington verhandelt, hartnäckig und um jeden Preis. Denn das ist eine Krise, in der es für die japanische Wirtschaft ums Überleben geht", konstatiert der Gastkommentator in NIHON KEIZAI SHIMBUN aus Tokio.
Die Schweizer NEUE ZÜRCHER ZEITUNG führt aus: "Trump denkt beim Stichwort Handel an Stahl, Aluminium, Weizen oder Autos: also an Güter, die greifbar sind und eindrückliche Bilder evozieren, weil sie in riesigen Mengen gefertigt werden. Die USA einerseits und ihre Handelspartner andererseits befinden sich mitten in der frühen Phase eines Handelskriegs. Er richtet bereits Schäden an, aber ein Ende des Konflikts tritt frühestens dann ein, wenn die Gegner die erdenklichen Maßnahmen und Gegenmaßnahmen ausgeschöpft haben." Soweit die NZZ.
Die spanische Zeitung EL PAÍS blickt auf die Bemühungen um eine eingeschränkte Waffenruhe im Krieg Russlands gegen die Ukraine: "Die Verringerung der Feindseligkeiten ist ein positiver Schritt in Richtung einer Lösung des Konflikts. Zwingend erforderlich ist es, bei dieser Vereinbarung Vorsicht walten zu lassen. Man muss von Russland solide Garantien verlangen. Es wäre unklug, zu ignorieren, dass Präsident Putin frühere Abkommen als Mittel genutzt hat, um seine eigenen Interessen voranzutreiben", warnt EL PAÍS aus Madrid.
Bei den Verhandlungen war es zuletzt um einen Verzicht auf Angriffe im Schwarzen Meer gegangen. Die in Shanghai erscheinende Zeitung JIEFANG RIBAO meint: "Es ist anzuerkennen, dass die USA, Russland und die Ukraine in Riad einen kleinen Konsens erzielt haben. Für die Schifffahrt im Schwarzen Meer ist dieses Verhandlungsergebnis ein kleiner Erfolg. Wenn nicht mehr auf die Anlagen zur Energieerzeugung in Russland und in der Ukraine geschossen wird, ist es ebenfalls ein erster Schritt zum Frieden. Bloß das Kernanliegen der Ukraine hinsichtlich der territorialen Integrität war kein Gegenstand bei den Gesprächen. Bei dieser Frage zeigt sich bisher Kiew nicht kompromissbereit. Auch Moskau sieht seine Ziele in der Ukraine nicht erreicht."
Die italienische Zeitung CORRIERE DELLA SERA aus Mailand beklagt: "Es ist nun klar, dass die Vereinigten Staaten sich anschicken, der Ukraine einen ungerechten 'Deal' mit dem Aggressor aufzuzwingen. Donald Trump und Wladimir Putin lassen unisono und auf jede erdenkliche Art und Weise durchblicken, dass sie ein Abkommen anstreben, das eine Bestrafung der Ukraine umfasst. Begleitet von einer möglichst weitgehenden Demütigung ganz Europas."
Auch die österreichische Zeitung DIE PRESSE bleibt skeptisch: "Selbst wenn der Gesprächsreigen in Saudi Arabien weitergeht, dürfte Moskau immer neue Gründe finden, warum es einem Deal nicht zustimmen will. Das schwächt die Legitimität der Vermittlungsmission insgesamt. Fraglich ist, ob Trump die richtigen Schlüsse aus der russischen Sabotagetaktik ziehen wird. Er sollte den Druck gegenüber dem Kreml erhöhen", verlangt DIE PRESSE, die in Wien erscheint.
In Estland hat das Parlament die Abschaffung des kommunalen Wahlrechts für die russische Minderheit beschlossen. Die estnische Zeitung POSTIMEES kommentiert hierzu: "Das war dringend nötig, um unsere Eigenstaatlichkeit zu sichern. Seit der Wiederherstellung unserer Unabhängigkeit sind mehr als 30 Jahre vergangen, und das reicht, um Estnisch zu lernen, einen Integrationskurs zu besuchen und die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Estland ist nicht Russland und muss nicht dulden, dass in Kommunen von russischen Bürgern gewählte Vertreter regieren", betont POSTIMEES aus Tallinn.
Der Chat hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter über Angriffspläne im Jemen bleibt ein Thema in den Kommentarspalten. Die ungarische Zeitung NEPSZAVA beobachtet: "Der US-Journalist Jeffrey Goldberg glaubte, wie er es selbst darstellte, seinen Augen nicht, als ihm in einer internen Signal-Gruppe hoher Regierungsbeamter Ziele, eingesetzte Waffen und Zeitplan dargeboten wurden. Was wäre geschehen, wenn der Sicherheitsberater Mike Waltz versehentlich den chinesischen Botschafter oder einen russischen Diplomaten der Gruppe hinzugefügt hätte?", fragt NEPSZAVA aus Budapest.
Die lettische Zeitung DIENA beleuchtet die Affäre wie folgt: "Wichtiger ist die politische Gesamtbedeutung dieses Skandals, da er das tiefste Innere der Trump-Regierung anschaulich charakterisiert. Wie man so schön sagt, wird ein System nicht so sehr durch Fehler selbst definiert, sondern vielmehr durch die Reaktion darauf. Kommentatoren sagten voraus, dass Waltz wahrscheinlich zum Sündenbock gemacht und für den allgemeinen Frieden geopfert werden würde. Aber das wäre vielleicht früher der Fall gewesen. Denn in Trumps Team gibt es nur eine Sünde, und Unprofessionalität ist es nicht. Für gemachte Fehler gibt es keine Strafe. Eine Strafe kann nur durch Illoyalität verdient werden", ist in DIENA aus Riga zu lesen.
Die Zeitung THE AUSTRALIAN notiert: "Inmitten der Sicherheits- und Geheimdienstverstöße gab es eine klare Botschaft für Europäer und Freunde anderswo, was Beamte an der Spitze der Trump-Administration wirklich über die Art der Beziehungen der USA selbst zu engen Verbündeten denken. Herr Trump sollte nicht überrascht sein, wenn einige Verbündete der USA nach dem Debakel mit der Signal-App zu dem Schluss kommen, dass es ihnen schwerfallen könnte, den USA in einer künftigen Krise zu vertrauen." Sie hörten einen Kommentar aus THE AUSTRALIAN aus Sydney.
Zum letzten Thema. Grönland sorgt sich weiter um seine Souveränität. Anlass ist der Besuch einer US-amerikanischen Delegation. Die norwegische Zeitung VERDENS GANG führt aus: "Sowohl die grönländischen als auch die dänischen Behörden können erleichtert aufatmen: Das Weiße Haus hat das Programm für den Besuch einer hochrangigen Delegation in Grönland vollständig geändert. Vizepräsidentengattin Usha Vance verzichtet auf die Teilnahme an einem Schlittenhunderennen und einen Stadtrundgang in der Hauptstadt Nuuk, und offenbar bleiben Sicherheitsberater Waltz und Energieminister Wright zu Hause. Niemand hat die Trump-Leute offiziell eingeladen. Nun reist zwar Vizepräsident JD Vance mit, aber das Paar besucht nur eine US-Militärbasis, und das dürfen die beiden natürlich. Der Grund für die Programmänderung dürfte gewesen sein, dass man in Nuuk Demonstrationen mit 'Yankee, go home'-Transparenten befürchten musste", hält VERDENS GANG aus Oslo fest.
"Das ist nur der Anfang, und es wird noch mehr von dieser Art kommen", ist sich die dänische Zeitung POLITIKEN sicher: "Die diplomatische Kriegserklärung der USA ist nicht etwa aufgehoben worden, nur weil man einen Fehler gemacht hat – man wartet lediglich auf eine günstigere Gelegenheit. Premierministerin Mette Frederiksen hat es auf den Punkt gebracht: Trump will Grönland, und er meint es ernst. Außerdem hat sich die Tonlage verändert: Die Forderungen sind direkt und barsch geworden. Aber deshalb ist es auch an der Zeit, dass Dänemark und seine Verbündeten die Maske fallen lassen und Klartext sprechen wie zuletzt NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Die akute Bedrohung für die territoriale Integrität eines Mitglieds kommt zurzeit nämlich nicht von außen, sondern von innen." Das war POLITIKEN aus Kopenhagen. Und damit endet diese Presseschau.